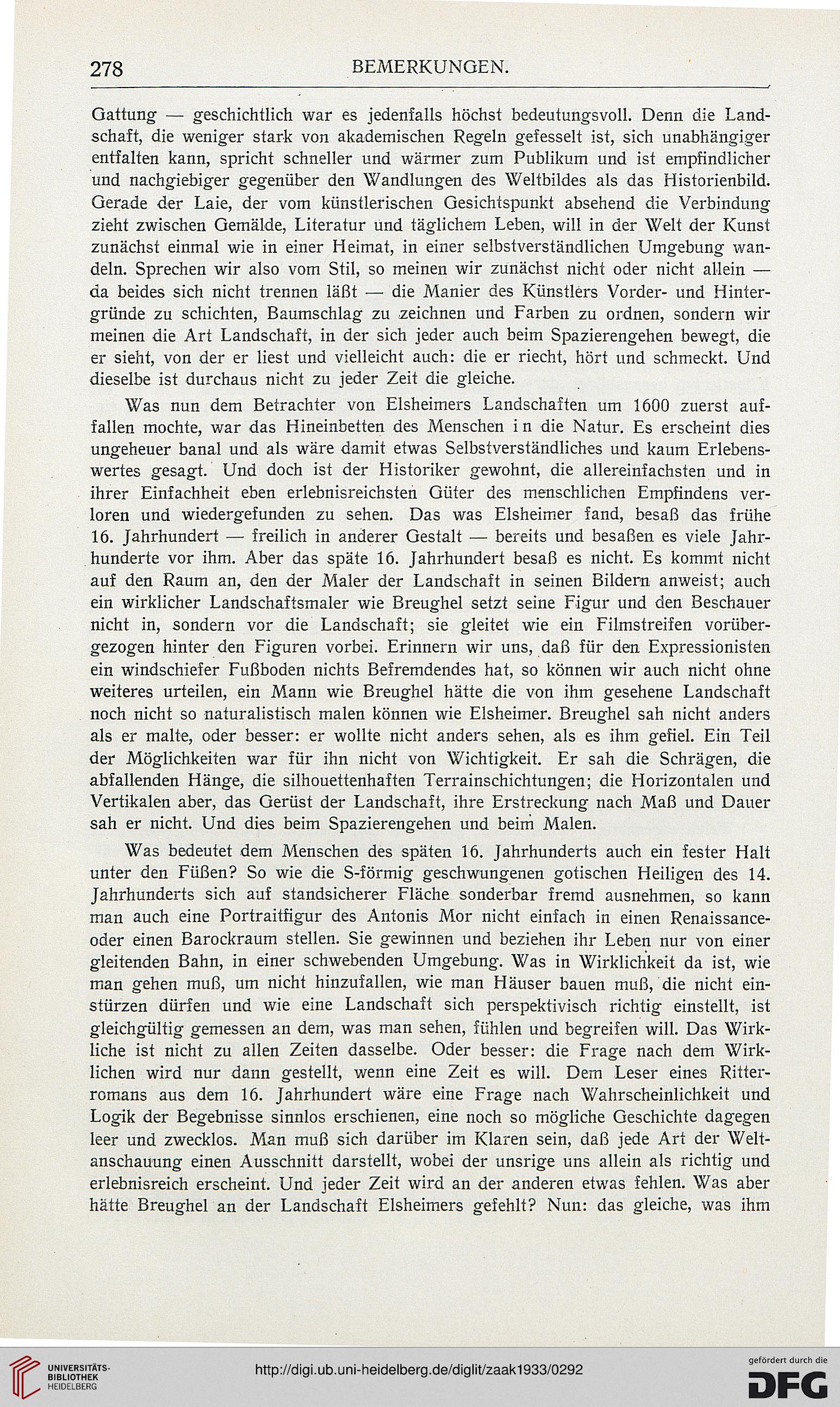278
BEMERKUNGEN.
Gattung — geschichtlich war es jedenfalls höchst bedeutungsvoll. Denn die Land-
schaft, die weniger stark von akademischen Regeln gefesselt ist, sich unabhängiger
entfalten kann, spricht schneller und wärmer zum Publikum und ist empfindlicher
und nachgiebiger gegenüber den Wandlungen des Weltbildes als das Historienbild.
Gerade der Laie, der vom künstlerischen Gesichtspunkt absehend die Verbindung
zieht zwischen Gemälde, Literatur und täglichem Leben, will in der Welt der Kunst
zunächst einmal wie in einer Heimat, in einer selbstverständlichen Umgebung wan-
deln. Sprechen wir also vom Stil, so meinen wir zunächst nicht oder nicht allein —
da beides sich nicht trennen läßt ■— die Manier des Künstlers Vorder- und Hinter-
gründe zu schichten, Baumschlag zu zeichnen und Farben zu ordnen, sondern wir
meinen die Art Landschaft, in der sich jeder auch beim Spazierengehen bewegt, die
er sieht, von der er liest und vielleicht auch: die er riecht, hört und schmeckt. Und
dieselbe ist durchaus nicht zu jeder Zeit die gleiche.
Was nun dem Betrachter von Elsheimers Landschaften um 1600 zuerst auf-
fallen mochte, war das Hineinbetten des Menschen in die Natur. Es erscheint dies
ungeheuer banal und als wäre damit etwas Selbstverständliches und kaum Erlebens-
wertes gesagt. Und doch ist der Historiker gewohnt, die allereinfachsten und in
ihrer Einfachheit eben erlebnisreichsten Güter des menschlichen Empfindens ver-
loren und wiedergefunden zu sehen. Das was Elsheimer fand, besaß das frühe
16. Jahrhundert — freilich in anderer Gestalt — bereits und besaßen es viele Jahr-
hunderte vor ihm. Aber das späte 16. Jahrhundert besaß es nicht. Es kommt nicht
auf den Raum an, den der Maler der Landschaft in seinen Bildern anweist; auch
ein wirklicher Landschaftsmaler wie Breughel setzt seine Figur und den Beschauer
nicht in, sondern vor die Landschaft; sie gleitet wie ein Filmstreifen vorüber-
gezogen hinter den Figuren vorbei. Erinnern wir uns, daß für den Expressionisten
ein windschiefer Fußboden nichts Befremdendes hat, so können wir auch nicht ohne
weiteres urteilen, ein Mann wie Breughel hätte die von ihm gesehene Landschaft
noch nicht so naturalistisch malen können wie Elsheimer. Breughel sah nicht anders
als er malte, oder besser: er wollte nicht anders sehen, als es ihm gefiel. Ein Teil
der Möglichkeiten war für ihn nicht von Wichtigkeit. Er sah die Schrägen, die
abfallenden Hänge, die silhouettenhaften Terrainschichtungen; die Horizontalen und
Vertikalen aber, das Gerüst der Landschaft, ihre Erstreckung nach Maß und Dauer
sah er nicht. Und dies beim Spazierengehen und beim Malen.
Was bedeutet dem Menschen des späten 16. Jahrhunderts auch ein fester Halt
unter den Füßen? So wie die S-förmig geschwungenen gotischen Heiligen des 14.
Jahrhunderts sich auf standsicherer Fläche sonderbar fremd ausnehmen, so kann
man auch eine Portraitfigur des Antonis Mor nicht einfach in einen Renaissance-
oder einen Barockraum stellen. Sie gewinnen und beziehen ihr Leben nur von einer
gleitenden Bahn, in einer schwebenden Umgebung. Was in Wirklichkeit da ist, wie
man gehen muß, um nicht hinzufallen, wie man Häuser bauen muß, die nicht ein-
stürzen dürfen und wie eine Landschaft sich perspektivisch richtig einstellt, ist
gleichgültig gemessen an dem, was man sehen, fühlen und begreifen will. Das Wirk-
liche ist nicht zu allen Zeiten dasselbe. Oder besser: die Frage nach dem Wirk-
lichen wird nur dann gestellt, wenn eine Zeit es will. Dem Leser eines Ritter-
romans aus dem 16. Jahrhundert wäre eine Frage nach Wahrscheinlichkeit und
Logik der Begebnisse sinnlos erschienen, eine noch so mögliche Geschichte dagegen
leer und zwecklos. Man muß sich darüber im Klaren sein, daß jede Art der Welt-
anschauung einen Ausschnitt darstellt, wobei der unsrige uns allein als richtig und
erlebnisreich erscheint. Und jeder Zeit wird an der anderen etwas fehlen. Was aber
hätte Breughel an der Landschaft Elsheimers gefehlt? Nun: das gleiche, was ihm
BEMERKUNGEN.
Gattung — geschichtlich war es jedenfalls höchst bedeutungsvoll. Denn die Land-
schaft, die weniger stark von akademischen Regeln gefesselt ist, sich unabhängiger
entfalten kann, spricht schneller und wärmer zum Publikum und ist empfindlicher
und nachgiebiger gegenüber den Wandlungen des Weltbildes als das Historienbild.
Gerade der Laie, der vom künstlerischen Gesichtspunkt absehend die Verbindung
zieht zwischen Gemälde, Literatur und täglichem Leben, will in der Welt der Kunst
zunächst einmal wie in einer Heimat, in einer selbstverständlichen Umgebung wan-
deln. Sprechen wir also vom Stil, so meinen wir zunächst nicht oder nicht allein —
da beides sich nicht trennen läßt ■— die Manier des Künstlers Vorder- und Hinter-
gründe zu schichten, Baumschlag zu zeichnen und Farben zu ordnen, sondern wir
meinen die Art Landschaft, in der sich jeder auch beim Spazierengehen bewegt, die
er sieht, von der er liest und vielleicht auch: die er riecht, hört und schmeckt. Und
dieselbe ist durchaus nicht zu jeder Zeit die gleiche.
Was nun dem Betrachter von Elsheimers Landschaften um 1600 zuerst auf-
fallen mochte, war das Hineinbetten des Menschen in die Natur. Es erscheint dies
ungeheuer banal und als wäre damit etwas Selbstverständliches und kaum Erlebens-
wertes gesagt. Und doch ist der Historiker gewohnt, die allereinfachsten und in
ihrer Einfachheit eben erlebnisreichsten Güter des menschlichen Empfindens ver-
loren und wiedergefunden zu sehen. Das was Elsheimer fand, besaß das frühe
16. Jahrhundert — freilich in anderer Gestalt — bereits und besaßen es viele Jahr-
hunderte vor ihm. Aber das späte 16. Jahrhundert besaß es nicht. Es kommt nicht
auf den Raum an, den der Maler der Landschaft in seinen Bildern anweist; auch
ein wirklicher Landschaftsmaler wie Breughel setzt seine Figur und den Beschauer
nicht in, sondern vor die Landschaft; sie gleitet wie ein Filmstreifen vorüber-
gezogen hinter den Figuren vorbei. Erinnern wir uns, daß für den Expressionisten
ein windschiefer Fußboden nichts Befremdendes hat, so können wir auch nicht ohne
weiteres urteilen, ein Mann wie Breughel hätte die von ihm gesehene Landschaft
noch nicht so naturalistisch malen können wie Elsheimer. Breughel sah nicht anders
als er malte, oder besser: er wollte nicht anders sehen, als es ihm gefiel. Ein Teil
der Möglichkeiten war für ihn nicht von Wichtigkeit. Er sah die Schrägen, die
abfallenden Hänge, die silhouettenhaften Terrainschichtungen; die Horizontalen und
Vertikalen aber, das Gerüst der Landschaft, ihre Erstreckung nach Maß und Dauer
sah er nicht. Und dies beim Spazierengehen und beim Malen.
Was bedeutet dem Menschen des späten 16. Jahrhunderts auch ein fester Halt
unter den Füßen? So wie die S-förmig geschwungenen gotischen Heiligen des 14.
Jahrhunderts sich auf standsicherer Fläche sonderbar fremd ausnehmen, so kann
man auch eine Portraitfigur des Antonis Mor nicht einfach in einen Renaissance-
oder einen Barockraum stellen. Sie gewinnen und beziehen ihr Leben nur von einer
gleitenden Bahn, in einer schwebenden Umgebung. Was in Wirklichkeit da ist, wie
man gehen muß, um nicht hinzufallen, wie man Häuser bauen muß, die nicht ein-
stürzen dürfen und wie eine Landschaft sich perspektivisch richtig einstellt, ist
gleichgültig gemessen an dem, was man sehen, fühlen und begreifen will. Das Wirk-
liche ist nicht zu allen Zeiten dasselbe. Oder besser: die Frage nach dem Wirk-
lichen wird nur dann gestellt, wenn eine Zeit es will. Dem Leser eines Ritter-
romans aus dem 16. Jahrhundert wäre eine Frage nach Wahrscheinlichkeit und
Logik der Begebnisse sinnlos erschienen, eine noch so mögliche Geschichte dagegen
leer und zwecklos. Man muß sich darüber im Klaren sein, daß jede Art der Welt-
anschauung einen Ausschnitt darstellt, wobei der unsrige uns allein als richtig und
erlebnisreich erscheint. Und jeder Zeit wird an der anderen etwas fehlen. Was aber
hätte Breughel an der Landschaft Elsheimers gefehlt? Nun: das gleiche, was ihm