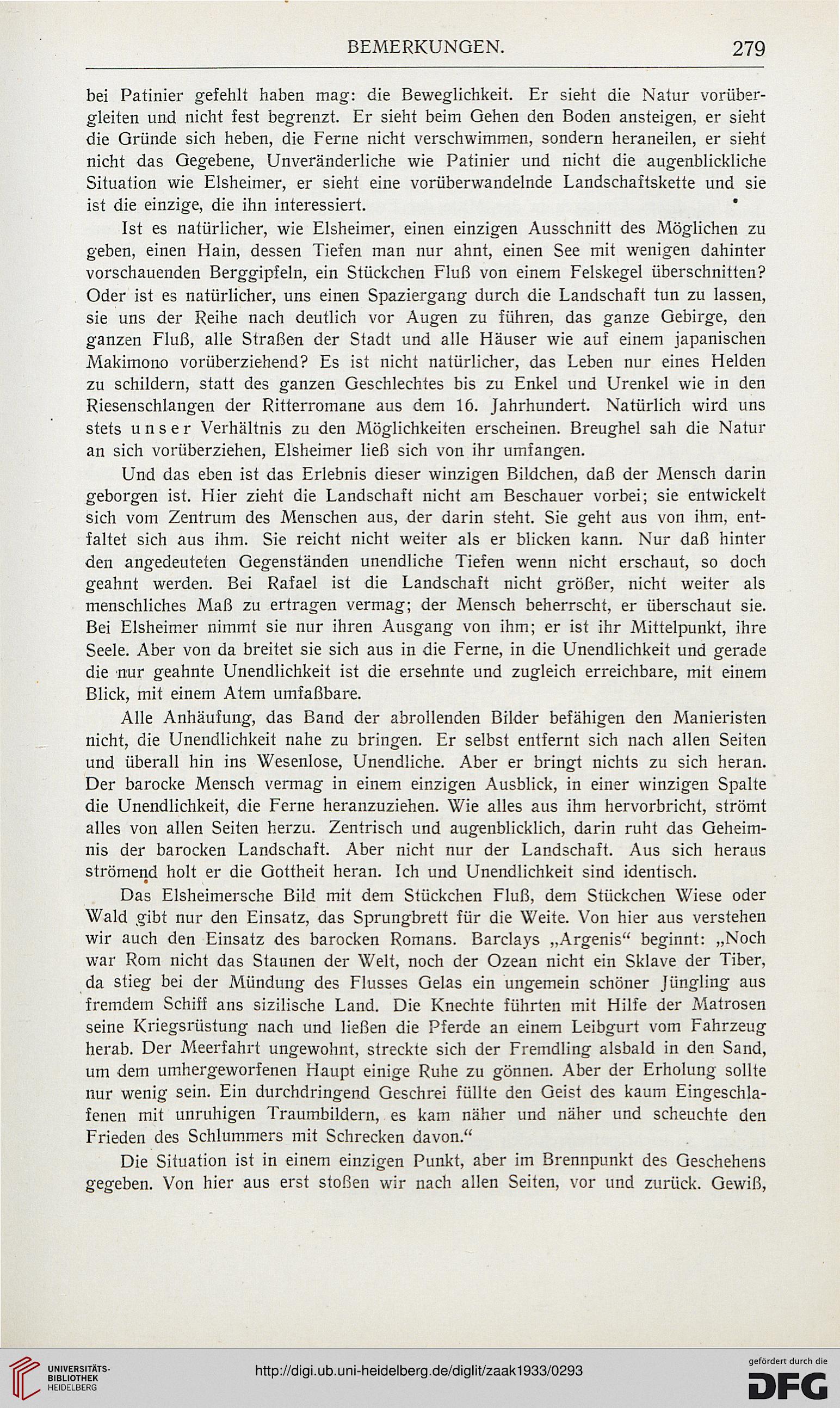BEMERKUNGEN.
279
bei Patinier gefehlt haben mag: die Beweglichkeit. Er sieht die Natur vorüber-
gleiten und nicht fest begrenzt. Er sieht beim Gehen den Boden ansteigen, er sieht
die Gründe sich heben, die Ferne nicht verschwimmen, sondern heraneilen, er sieht
nicht das Gegebene, Unveränderliche wie Patinier und nicht die augenblickliche
Situation wie Elsheimer, er sieht eine vorüberwandelnde Landschaftskette und sie
ist die einzige, die ihn interessiert. *
Ist es natürlicher, wie Elsheimer, einen einzigen Ausschnitt des Möglichen zu
geben, einen Hain, dessen Tiefen man nur ahnt, einen See mit wenigen dahinter
vorschauenden Berggipfeln, ein Stückchen Fluß von einem Felskegel überschnitten?
Oder ist es natürlicher, uns einen Spaziergang durch die Landschaft tun zu lassen,
sie uns der Reihe nach deutlich vor Augen zu führen, das ganze Gebirge, den
ganzen Fluß, alle Straßen der Stadt und alle Häuser wie auf einem japanischen
Makimono vorüberziehend? Es ist nicht natürlicher, das Leben nur eines Helden
zu schildern, statt des ganzen Geschlechtes bis zu Enkel und Urenkel wie in den
Riesenschlangen der Ritterromane aus dem 16. Jahrhundert. Natürlich wird uns
stets unser Verhältnis zu den Möglichkeiten erscheinen. Breughel sah die Natur
an sich vorüberziehen, Elsheimer ließ sich von ihr umfangen.
Und das eben ist das Erlebnis dieser winzigen Bildchen, daß der Mensch darin
geborgen ist. Hier zieht die Landschaft nicht am Beschauer vorbei; sie entwickelt
sich vom Zentrum des Menschen aus, der darin steht. Sie geht aus von ihm, ent-
faltet sich aus ihm. Sie reicht nicht weiter als er blicken kann. Nur daß hinter
den angedeuteten Gegenständen unendliche Tiefen wenn nicht erschaut, so doch
geahnt werden. Bei Rafael ist die Landschaft nicht größer, nicht weiter als
menschliches Maß zu ertragen vermag; der Mensch beherrscht, er überschaut sie.
Bei Elsheimer nimmt sie nur ihren Ausgang von ihm; er ist ihr Mittelpunkt, ihre
Seele. Aber von da breitet sie sich aus in die Ferne, in die Unendlichkeit und gerade
die nur geahnte Unendlichkeit ist die ersehnte und zugleich erreichbare, mit einem
Blick, mit einem Atem umfaßbare.
Alle Anhäufung, das Band der abrollenden Bilder befähigen den Manieristen
nicht, die Unendlichkeit nahe zu bringen. Er selbst entfernt sich nach allen Seiten
und überall hin ins Wesenlose, Unendliche. Aber er bringt nichts zu sich heran.
Der barocke Mensch vermag in einem einzigen Ausblick, in einer winzigen Spalte
die Unendlichkeit, die Ferne heranzuziehen. Wie alles aus ihm hervorbricht, strömt
alles von allen Seiten herzu. Zentrisch und augenblicklich, darin ruht das Geheim-
nis der barocken Landschaft. Aber nicht nur der Landschaft. Aus sich heraus
strömend holt er die Gottheit heran. Ich und Unendlichkeit sind identisch.
Das Elsheimersche Bild mit dem Stückchen Fluß, dem Stückchen Wiese oder
Wald gibt nur den Einsatz, das Sprungbrett für die Weite. Von hier aus verstehen
wir auch den Einsatz des barocken Romans. Barclays „Argenis" beginnt: „Noch
war Rom nicht das Staunen der Welt, noch der Ozean nicht ein Sklave der Tiber,
da stieg bei der Mündung des Flusses Gelas ein ungemein schöner Jüngling aus
fremdem Schiff ans sizilische Land. Die Knechte führten mit Hilfe der Matrosen
seine Kriegsrüstung nach und ließen die Pferde an einem Leibgurt vom Fahrzeug
herab. Der Meerfahrt ungewohnt, streckte sich der Fremdling alsbald in den Sand,
um dem umhergeworfenen Haupt einige Ruhe zu gönnen. Aber der Erholung sollte
nur wenig sein. Ein durchdringend Geschrei füllte den Geist des kaum Eingeschla-
fenen mit unruhigen Traumbildern, es kam näher und näher und scheuchte den
Frieden des Schlummers mit Schrecken davon."
Die Situation ist in einem einzigen Punkt, aber im Brennpunkt des Geschehens
gegeben. Von hier aus erst stoßen wir nach allen Seiten, vor und zurück. Gewiß,
279
bei Patinier gefehlt haben mag: die Beweglichkeit. Er sieht die Natur vorüber-
gleiten und nicht fest begrenzt. Er sieht beim Gehen den Boden ansteigen, er sieht
die Gründe sich heben, die Ferne nicht verschwimmen, sondern heraneilen, er sieht
nicht das Gegebene, Unveränderliche wie Patinier und nicht die augenblickliche
Situation wie Elsheimer, er sieht eine vorüberwandelnde Landschaftskette und sie
ist die einzige, die ihn interessiert. *
Ist es natürlicher, wie Elsheimer, einen einzigen Ausschnitt des Möglichen zu
geben, einen Hain, dessen Tiefen man nur ahnt, einen See mit wenigen dahinter
vorschauenden Berggipfeln, ein Stückchen Fluß von einem Felskegel überschnitten?
Oder ist es natürlicher, uns einen Spaziergang durch die Landschaft tun zu lassen,
sie uns der Reihe nach deutlich vor Augen zu führen, das ganze Gebirge, den
ganzen Fluß, alle Straßen der Stadt und alle Häuser wie auf einem japanischen
Makimono vorüberziehend? Es ist nicht natürlicher, das Leben nur eines Helden
zu schildern, statt des ganzen Geschlechtes bis zu Enkel und Urenkel wie in den
Riesenschlangen der Ritterromane aus dem 16. Jahrhundert. Natürlich wird uns
stets unser Verhältnis zu den Möglichkeiten erscheinen. Breughel sah die Natur
an sich vorüberziehen, Elsheimer ließ sich von ihr umfangen.
Und das eben ist das Erlebnis dieser winzigen Bildchen, daß der Mensch darin
geborgen ist. Hier zieht die Landschaft nicht am Beschauer vorbei; sie entwickelt
sich vom Zentrum des Menschen aus, der darin steht. Sie geht aus von ihm, ent-
faltet sich aus ihm. Sie reicht nicht weiter als er blicken kann. Nur daß hinter
den angedeuteten Gegenständen unendliche Tiefen wenn nicht erschaut, so doch
geahnt werden. Bei Rafael ist die Landschaft nicht größer, nicht weiter als
menschliches Maß zu ertragen vermag; der Mensch beherrscht, er überschaut sie.
Bei Elsheimer nimmt sie nur ihren Ausgang von ihm; er ist ihr Mittelpunkt, ihre
Seele. Aber von da breitet sie sich aus in die Ferne, in die Unendlichkeit und gerade
die nur geahnte Unendlichkeit ist die ersehnte und zugleich erreichbare, mit einem
Blick, mit einem Atem umfaßbare.
Alle Anhäufung, das Band der abrollenden Bilder befähigen den Manieristen
nicht, die Unendlichkeit nahe zu bringen. Er selbst entfernt sich nach allen Seiten
und überall hin ins Wesenlose, Unendliche. Aber er bringt nichts zu sich heran.
Der barocke Mensch vermag in einem einzigen Ausblick, in einer winzigen Spalte
die Unendlichkeit, die Ferne heranzuziehen. Wie alles aus ihm hervorbricht, strömt
alles von allen Seiten herzu. Zentrisch und augenblicklich, darin ruht das Geheim-
nis der barocken Landschaft. Aber nicht nur der Landschaft. Aus sich heraus
strömend holt er die Gottheit heran. Ich und Unendlichkeit sind identisch.
Das Elsheimersche Bild mit dem Stückchen Fluß, dem Stückchen Wiese oder
Wald gibt nur den Einsatz, das Sprungbrett für die Weite. Von hier aus verstehen
wir auch den Einsatz des barocken Romans. Barclays „Argenis" beginnt: „Noch
war Rom nicht das Staunen der Welt, noch der Ozean nicht ein Sklave der Tiber,
da stieg bei der Mündung des Flusses Gelas ein ungemein schöner Jüngling aus
fremdem Schiff ans sizilische Land. Die Knechte führten mit Hilfe der Matrosen
seine Kriegsrüstung nach und ließen die Pferde an einem Leibgurt vom Fahrzeug
herab. Der Meerfahrt ungewohnt, streckte sich der Fremdling alsbald in den Sand,
um dem umhergeworfenen Haupt einige Ruhe zu gönnen. Aber der Erholung sollte
nur wenig sein. Ein durchdringend Geschrei füllte den Geist des kaum Eingeschla-
fenen mit unruhigen Traumbildern, es kam näher und näher und scheuchte den
Frieden des Schlummers mit Schrecken davon."
Die Situation ist in einem einzigen Punkt, aber im Brennpunkt des Geschehens
gegeben. Von hier aus erst stoßen wir nach allen Seiten, vor und zurück. Gewiß,