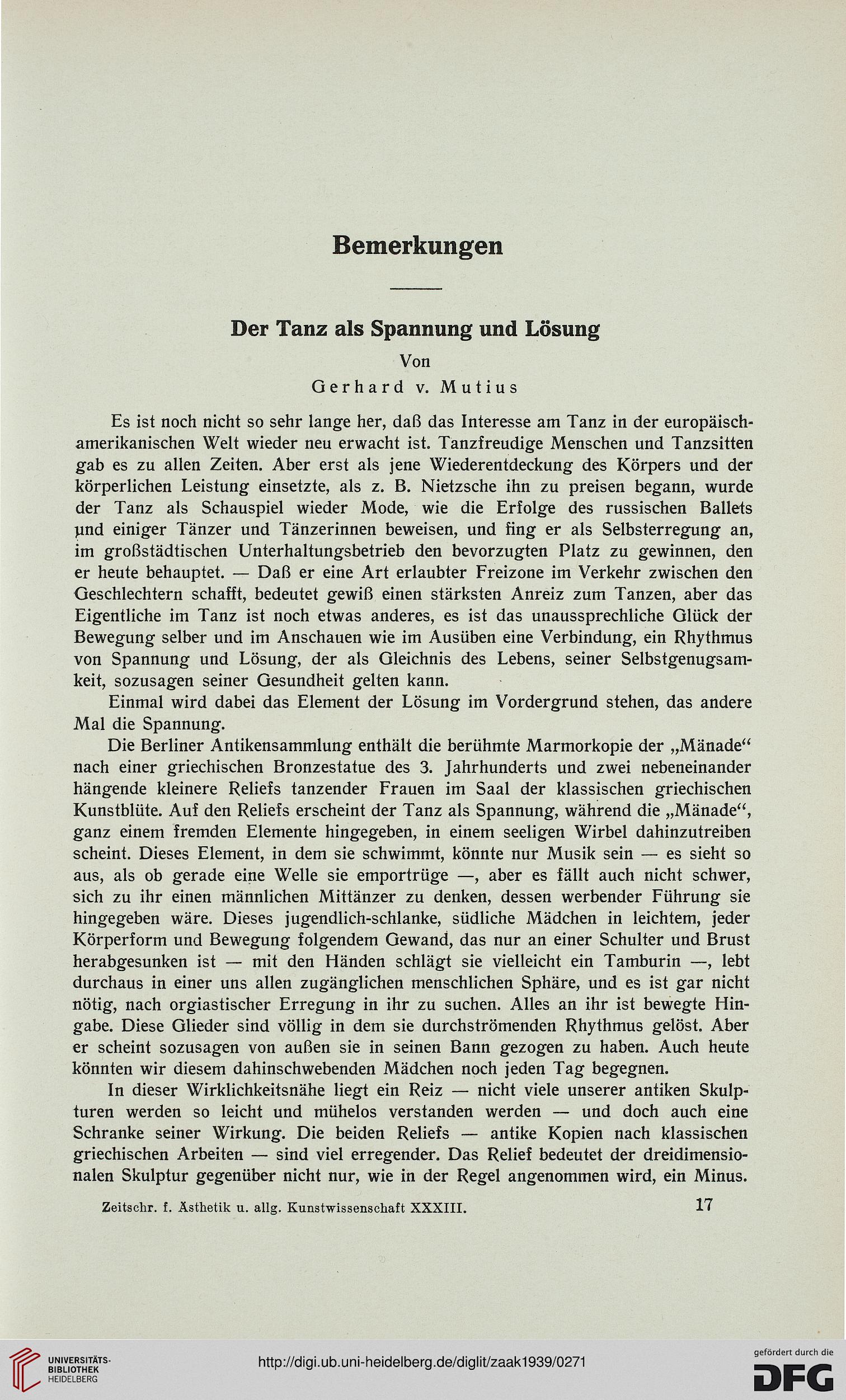Bemerkungen
Der Tanz als Spannung und Lösung
Von
Gerhard v. Mutius
Es ist noch nicht so sehr lange her, daß das Interesse am Tanz in der europäisch-
amerikanischen Welt wieder neu erwacht ist. Tanzfreudige Menschen und Tanzsitten
gab es zu allen Zeiten. Aber erst als jene Wiederentdeckung des Körpers und der
körperlichen Leistung einsetzte, als z. B. Nietzsche ihn zu preisen begann, wurde
der Tanz als Schauspiel wieder Mode, wie die Erfolge des russischen Ballets
und einiger Tänzer und Tänzerinnen beweisen, und fing er als Selbsterregung an,
im großstädtischen Unterhaltungsbetrieb den bevorzugten Platz zu gewinnen, den
er heute behauptet. — Daß er eine Art erlaubter Freizone im Verkehr zwischen den
Geschlechtern schafft, bedeutet gewiß einen stärksten Anreiz zum Tanzen, aber das
Eigentliche im Tanz ist noch etwas anderes, es ist das unaussprechliche Glück der
Bewegung selber und im Anschauen wie im Ausüben eine Verbindung, ein Rhythmus
von Spannung und Lösung, der als Gleichnis des Lebens, seiner Selbstgenügsam-
keit, sozusagen seiner Gesundheit gelten kann.
Einmal wird dabei das Element der Lösung im Vordergrund stehen, das andere
Mal die Spannung.
Die Berliner Antikensammlung enthält die berühmte Marmorkopie der „Mänade"
nach einer griechischen Bronzestatue des 3. Jahrhunderts und zwei nebeneinander
hängende kleinere Reliefs tanzender Frauen im Saal der klassischen griechischen
Kunstblüte. Auf den Reliefs erscheint der Tanz als Spannung, während die „Mänade",
ganz einem fremden Elemente hingegeben, in einem seeligen Wirbel dahinzutreiben
scheint. Dieses Element, in dem sie schwimmt, könnte nur Musik sein — es sieht so
aus, als ob gerade eine Welle sie emportrüge —, aber es fällt auch nicht schwer,
sich zu ihr einen männlichen Mittänzer zu denken, dessen werbender Führung sie
hingegeben wäre. Dieses jugendlich-schlanke, südliche Mädchen in leichtem, jeder
Körperform und Bewegung folgendem Gewand, das nur an einer Schulter und Brust
herabgesunken ist — mit den Händen schlägt sie vielleicht ein Tamburin —, lebt
durchaus in einer uns allen zugänglichen menschlichen Sphäre, und es ist gar nicht
nötig, nach orgiastischer Erregung in ihr zu suchen. Alles an ihr ist bewegte Hin-
gabe. Diese Glieder sind völlig in dem sie durchströmenden Rhythmus gelöst. Aber
er scheint sozusagen von außen sie in seinen Bann gezogen zu haben. Auch heute
könnten wir diesem dahinschwebenden Mädchen noch jeden Tag begegnen.
In dieser Wirklichkeitsnähe liegt ein Reiz — nicht viele unserer antiken Skulp-
turen werden so leicht und mühelos verstanden werden — und doch auch eine
Schranke seiner Wirkung. Die beiden Reliefs — antike Kopien nach klassischen
griechischen Arbeiten — sind viel erregender. Das Relief bedeutet der dreidimensio-
nalen Skulptur gegenüber nicht nur, wie in der Regel angenommen wird, ein Minus.
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft XXXIII. 17
Der Tanz als Spannung und Lösung
Von
Gerhard v. Mutius
Es ist noch nicht so sehr lange her, daß das Interesse am Tanz in der europäisch-
amerikanischen Welt wieder neu erwacht ist. Tanzfreudige Menschen und Tanzsitten
gab es zu allen Zeiten. Aber erst als jene Wiederentdeckung des Körpers und der
körperlichen Leistung einsetzte, als z. B. Nietzsche ihn zu preisen begann, wurde
der Tanz als Schauspiel wieder Mode, wie die Erfolge des russischen Ballets
und einiger Tänzer und Tänzerinnen beweisen, und fing er als Selbsterregung an,
im großstädtischen Unterhaltungsbetrieb den bevorzugten Platz zu gewinnen, den
er heute behauptet. — Daß er eine Art erlaubter Freizone im Verkehr zwischen den
Geschlechtern schafft, bedeutet gewiß einen stärksten Anreiz zum Tanzen, aber das
Eigentliche im Tanz ist noch etwas anderes, es ist das unaussprechliche Glück der
Bewegung selber und im Anschauen wie im Ausüben eine Verbindung, ein Rhythmus
von Spannung und Lösung, der als Gleichnis des Lebens, seiner Selbstgenügsam-
keit, sozusagen seiner Gesundheit gelten kann.
Einmal wird dabei das Element der Lösung im Vordergrund stehen, das andere
Mal die Spannung.
Die Berliner Antikensammlung enthält die berühmte Marmorkopie der „Mänade"
nach einer griechischen Bronzestatue des 3. Jahrhunderts und zwei nebeneinander
hängende kleinere Reliefs tanzender Frauen im Saal der klassischen griechischen
Kunstblüte. Auf den Reliefs erscheint der Tanz als Spannung, während die „Mänade",
ganz einem fremden Elemente hingegeben, in einem seeligen Wirbel dahinzutreiben
scheint. Dieses Element, in dem sie schwimmt, könnte nur Musik sein — es sieht so
aus, als ob gerade eine Welle sie emportrüge —, aber es fällt auch nicht schwer,
sich zu ihr einen männlichen Mittänzer zu denken, dessen werbender Führung sie
hingegeben wäre. Dieses jugendlich-schlanke, südliche Mädchen in leichtem, jeder
Körperform und Bewegung folgendem Gewand, das nur an einer Schulter und Brust
herabgesunken ist — mit den Händen schlägt sie vielleicht ein Tamburin —, lebt
durchaus in einer uns allen zugänglichen menschlichen Sphäre, und es ist gar nicht
nötig, nach orgiastischer Erregung in ihr zu suchen. Alles an ihr ist bewegte Hin-
gabe. Diese Glieder sind völlig in dem sie durchströmenden Rhythmus gelöst. Aber
er scheint sozusagen von außen sie in seinen Bann gezogen zu haben. Auch heute
könnten wir diesem dahinschwebenden Mädchen noch jeden Tag begegnen.
In dieser Wirklichkeitsnähe liegt ein Reiz — nicht viele unserer antiken Skulp-
turen werden so leicht und mühelos verstanden werden — und doch auch eine
Schranke seiner Wirkung. Die beiden Reliefs — antike Kopien nach klassischen
griechischen Arbeiten — sind viel erregender. Das Relief bedeutet der dreidimensio-
nalen Skulptur gegenüber nicht nur, wie in der Regel angenommen wird, ein Minus.
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft XXXIII. 17