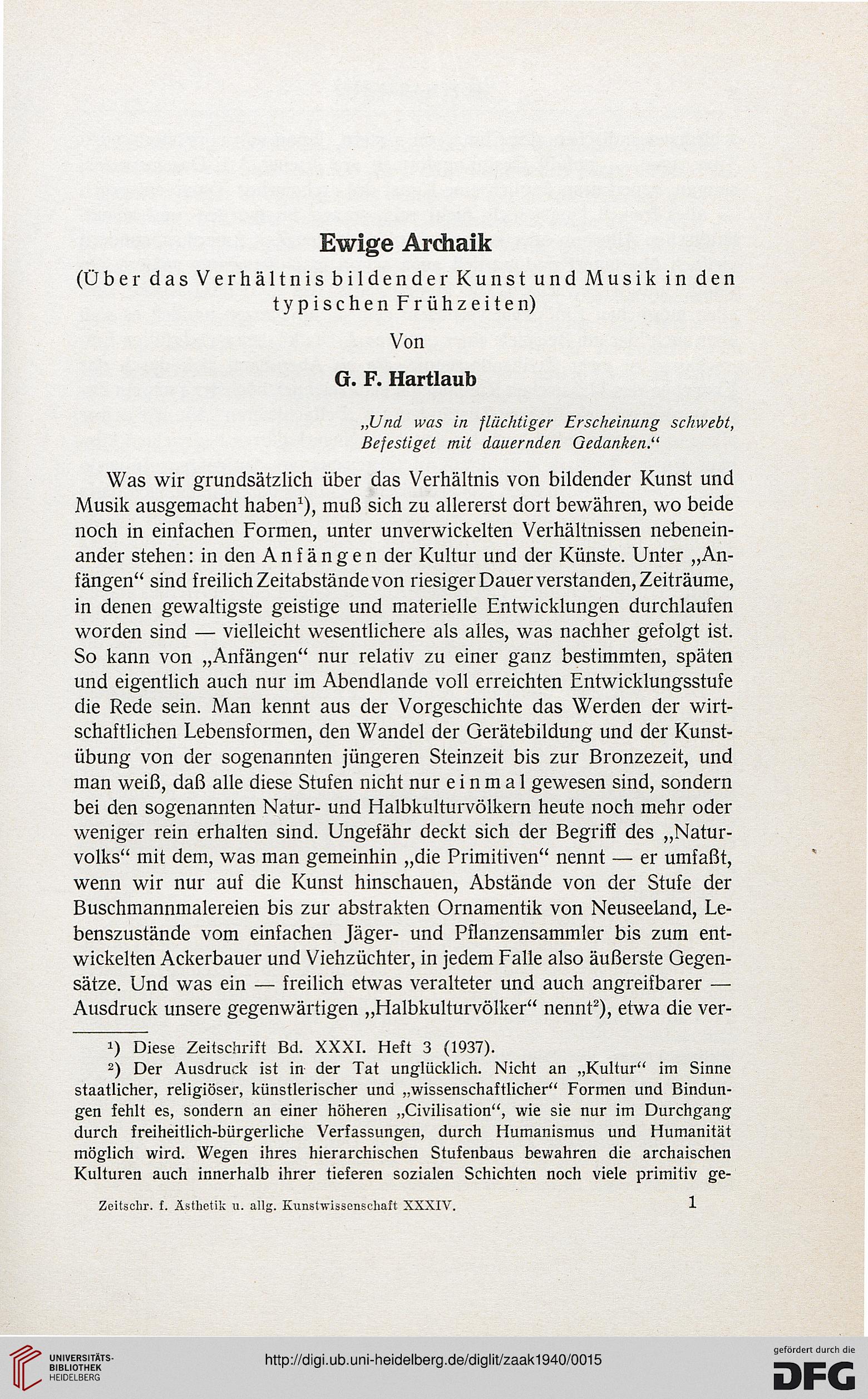Ewige Archaik
(Über das Verhältnis bildender Kunst und Musik in den
typischen Frühzeiten)
Von
G. F. Hartlaub
„Und was in flüchtiger Erscheinung schwebt,
Befestiget mit dauernden Gedanken."
Was wir grundsätzlich über das Verhältnis von bildender Kunst und
Musik ausgemacht haben1), muß sich zu allererst dort bewähren, wo beide
noch in einfachen Formen, unter unverwickelten Verhältnissen nebenein-
ander stehen: in den Anfängen der Kultur und der Künste. Unter „An-
fängen" sind freilich Zeitabstände von riesiger Dauer verstanden, Zeiträume,
in denen gewaltigste geistige und materielle Entwicklungen durchlaufen
worden sind — vielleicht wesentlichere als alles, was nachher gefolgt ist.
So kann von „Anfängen" nur relativ zu einer ganz bestimmten, späten
und eigentlich auch nur im Abendlande voll erreichten Entwicklungsstufe
die Rede sein. Man kennt aus der Vorgeschichte das Werden der wirt-
schaftlichen Lebensformen, den Wandel der Gerätebildung und der Kunst-
übung von der sogenannten jüngeren Steinzeit bis zur Bronzezeit, und
man weiß, daß alle diese Stufen nicht nur einmal gewesen sind, sondern
bei den sogenannten Natur- und Halbkulturvölkern heute noch mehr oder
weniger rein erhalten sind. Ungefähr deckt sich der Begriff des „Natur-
volks" mit dem, was man gemeinhin „die Primitiven" nennt — er umfaßt,
wenn wir nur auf die Kunst hinschauen, Abstände von der Stufe der
Buschmannmalereien bis zur abstrakten Ornamentik von Neuseeland, Le-
benszustände vom einfachen Jäger- und Pflanzensammler bis zum ent-
wickelten Ackerbauer und Viehzüchter, in jedem Falle also äußerste Gegen-
sätze. Und was ein — freilich etwas veralteter und auch angreifbarer —
Ausdruck unsere gegenwärtigen „Halbkulturvölker" nennt2), etwa die ver-
J) Diese Zeitschrift Bd. XXXI. Heft 3 (1937).
2) Der Ausdruck ist in der Tat unglücklich. Nicht an „Kultur" im Sinne
staatlicher, religiöser, künstlerischer und „wissenschaftlicher" Formen und Bindun-
gen fehlt es, sondern an einer höheren „Civilisation", wie sie nur im Durchgang
durch freiheitlich-bürgerliche Verfassungen, durch Humanismus und Humanität
möglich wird. Wegen ihres hierarchischen Stufenbaus bewahren die archaischen
Kulturen auch innerhalb ihrer tieferen sozialen Schichten noch viele primitiv ge-
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft XXXIV. 1
(Über das Verhältnis bildender Kunst und Musik in den
typischen Frühzeiten)
Von
G. F. Hartlaub
„Und was in flüchtiger Erscheinung schwebt,
Befestiget mit dauernden Gedanken."
Was wir grundsätzlich über das Verhältnis von bildender Kunst und
Musik ausgemacht haben1), muß sich zu allererst dort bewähren, wo beide
noch in einfachen Formen, unter unverwickelten Verhältnissen nebenein-
ander stehen: in den Anfängen der Kultur und der Künste. Unter „An-
fängen" sind freilich Zeitabstände von riesiger Dauer verstanden, Zeiträume,
in denen gewaltigste geistige und materielle Entwicklungen durchlaufen
worden sind — vielleicht wesentlichere als alles, was nachher gefolgt ist.
So kann von „Anfängen" nur relativ zu einer ganz bestimmten, späten
und eigentlich auch nur im Abendlande voll erreichten Entwicklungsstufe
die Rede sein. Man kennt aus der Vorgeschichte das Werden der wirt-
schaftlichen Lebensformen, den Wandel der Gerätebildung und der Kunst-
übung von der sogenannten jüngeren Steinzeit bis zur Bronzezeit, und
man weiß, daß alle diese Stufen nicht nur einmal gewesen sind, sondern
bei den sogenannten Natur- und Halbkulturvölkern heute noch mehr oder
weniger rein erhalten sind. Ungefähr deckt sich der Begriff des „Natur-
volks" mit dem, was man gemeinhin „die Primitiven" nennt — er umfaßt,
wenn wir nur auf die Kunst hinschauen, Abstände von der Stufe der
Buschmannmalereien bis zur abstrakten Ornamentik von Neuseeland, Le-
benszustände vom einfachen Jäger- und Pflanzensammler bis zum ent-
wickelten Ackerbauer und Viehzüchter, in jedem Falle also äußerste Gegen-
sätze. Und was ein — freilich etwas veralteter und auch angreifbarer —
Ausdruck unsere gegenwärtigen „Halbkulturvölker" nennt2), etwa die ver-
J) Diese Zeitschrift Bd. XXXI. Heft 3 (1937).
2) Der Ausdruck ist in der Tat unglücklich. Nicht an „Kultur" im Sinne
staatlicher, religiöser, künstlerischer und „wissenschaftlicher" Formen und Bindun-
gen fehlt es, sondern an einer höheren „Civilisation", wie sie nur im Durchgang
durch freiheitlich-bürgerliche Verfassungen, durch Humanismus und Humanität
möglich wird. Wegen ihres hierarchischen Stufenbaus bewahren die archaischen
Kulturen auch innerhalb ihrer tieferen sozialen Schichten noch viele primitiv ge-
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft XXXIV. 1