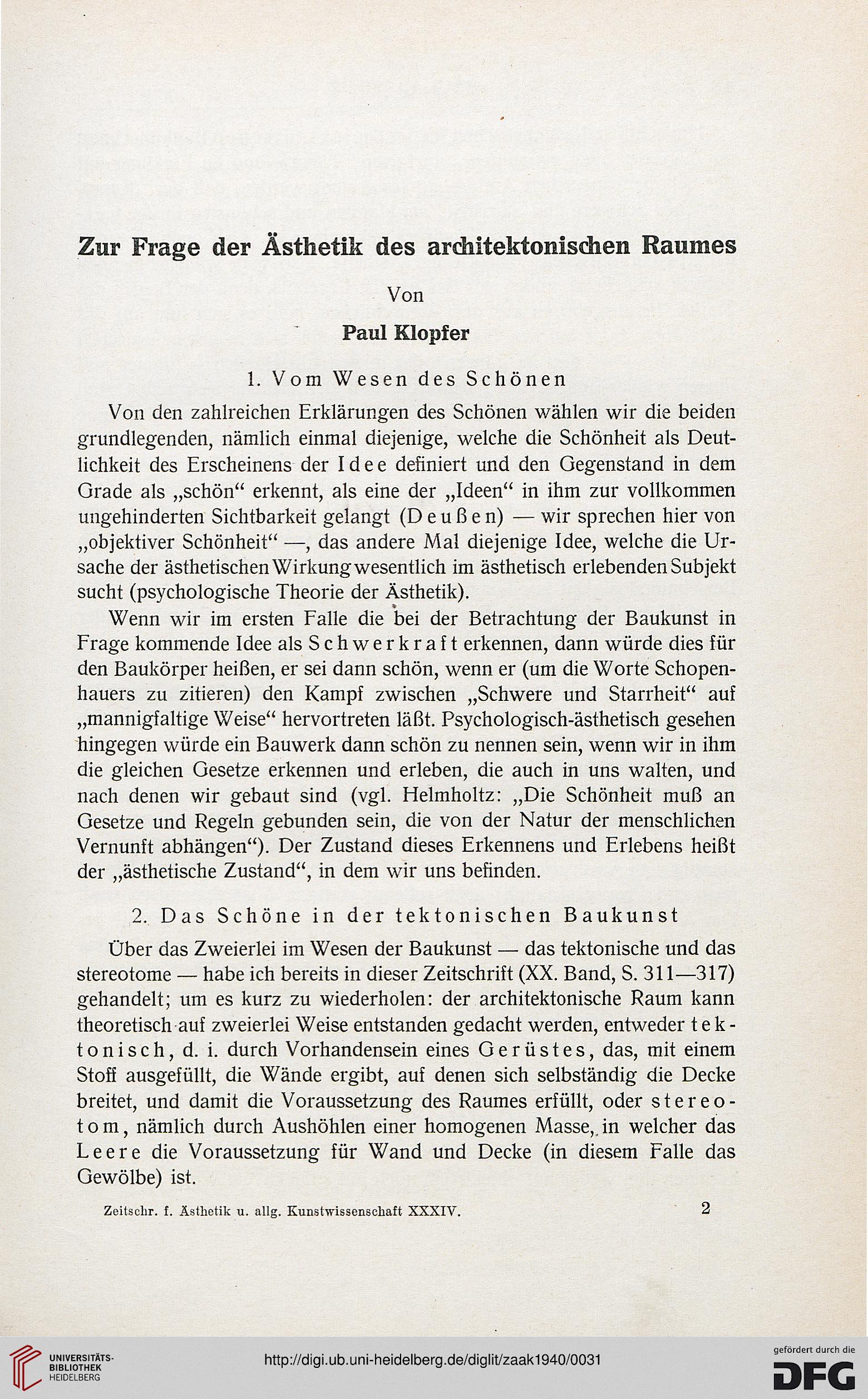Zur Frage der Ästhetik des architektonischen Raumes
Von
Paul Klopfer
1. Vom Wesen des Schönen
Von den zahlreichen Erklärungen des Schönen wählen wir die beiden
grundlegenden, nämlich einmal diejenige, welche die Schönheit als Deut-
lichkeit des Erscheinens der Idee definiert und den Gegenstand in dem
Grade als „schön" erkennt, als eine der „Ideen" in ihm zur vollkommen
ungehinderten Sichtbarkeit gelangt (D e u ß e n) — wir sprechen hier von
„objektiver Schönheit" —, das andere Mal diejenige Idee, welche die Ur-
sache der ästhetischen Wirkung wesentlich im ästhetisch erlebenden Subjekt
sucht (psychologische Theorie der Ästhetik).
Wenn wir im ersten Falle die bei der Betrachtung der Baukunst in
Frage kommende Idee als Schwerkraft erkennen, dann würde dies für
den Baukörper heißen, er sei dann schön, wenn er (um die Worte Schopen-
hauers zu zitieren) den Kampf zwischen „Schwere und Starrheit" auf
„mannigfaltige Weise" hervortreten läßt. Psychologisch-ästhetisch gesehen
hingegen würde ein Bauwerk dann schön zu nennen sein, wenn wir in ihm
die gleichen Gesetze erkennen und erleben, die auch in uns walten, und
nach denen wir gebaut sind (vgl. Helmholtz: „Die Schönheit muß an
Gesetze und Regeln gebunden sein, die von der Natur der menschlichen
Vernunft abhängen"). Der Zustand dieses Erkennens und Erlebens heißt
der „ästhetische Zustand", in dem wir uns befinden.
2. Das Schöne in der tektonischen Baukunst
Über das Zweierlei im Wesen der Baukunst — das tektonische und das
stereotome — habe ich bereits in dieser Zeitschrift (XX. Band, S. 311—317)
gehandelt; um es kurz zu wiederholen: der architektonische Raum kann
theoretisch auf zweierlei Weise entstanden gedacht werden, entweder t e k -
tonisch, d. i. durch Vorhandensein eines Gerüstes, das, mit einem
Stoff ausgefüllt, die Wände ergibt, auf denen sich selbständig die Decke
breitet, und damit die Voraussetzung des Raumes erfüllt, oder stereo-
tom, nämlich durch Aushöhlen einer homogenen Masse,.in welcher das
Leere die Voraussetzung für Wand und Decke (in diesem Falle das
Gewölbe) ist.
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft XXXIV.
2
Von
Paul Klopfer
1. Vom Wesen des Schönen
Von den zahlreichen Erklärungen des Schönen wählen wir die beiden
grundlegenden, nämlich einmal diejenige, welche die Schönheit als Deut-
lichkeit des Erscheinens der Idee definiert und den Gegenstand in dem
Grade als „schön" erkennt, als eine der „Ideen" in ihm zur vollkommen
ungehinderten Sichtbarkeit gelangt (D e u ß e n) — wir sprechen hier von
„objektiver Schönheit" —, das andere Mal diejenige Idee, welche die Ur-
sache der ästhetischen Wirkung wesentlich im ästhetisch erlebenden Subjekt
sucht (psychologische Theorie der Ästhetik).
Wenn wir im ersten Falle die bei der Betrachtung der Baukunst in
Frage kommende Idee als Schwerkraft erkennen, dann würde dies für
den Baukörper heißen, er sei dann schön, wenn er (um die Worte Schopen-
hauers zu zitieren) den Kampf zwischen „Schwere und Starrheit" auf
„mannigfaltige Weise" hervortreten läßt. Psychologisch-ästhetisch gesehen
hingegen würde ein Bauwerk dann schön zu nennen sein, wenn wir in ihm
die gleichen Gesetze erkennen und erleben, die auch in uns walten, und
nach denen wir gebaut sind (vgl. Helmholtz: „Die Schönheit muß an
Gesetze und Regeln gebunden sein, die von der Natur der menschlichen
Vernunft abhängen"). Der Zustand dieses Erkennens und Erlebens heißt
der „ästhetische Zustand", in dem wir uns befinden.
2. Das Schöne in der tektonischen Baukunst
Über das Zweierlei im Wesen der Baukunst — das tektonische und das
stereotome — habe ich bereits in dieser Zeitschrift (XX. Band, S. 311—317)
gehandelt; um es kurz zu wiederholen: der architektonische Raum kann
theoretisch auf zweierlei Weise entstanden gedacht werden, entweder t e k -
tonisch, d. i. durch Vorhandensein eines Gerüstes, das, mit einem
Stoff ausgefüllt, die Wände ergibt, auf denen sich selbständig die Decke
breitet, und damit die Voraussetzung des Raumes erfüllt, oder stereo-
tom, nämlich durch Aushöhlen einer homogenen Masse,.in welcher das
Leere die Voraussetzung für Wand und Decke (in diesem Falle das
Gewölbe) ist.
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft XXXIV.
2