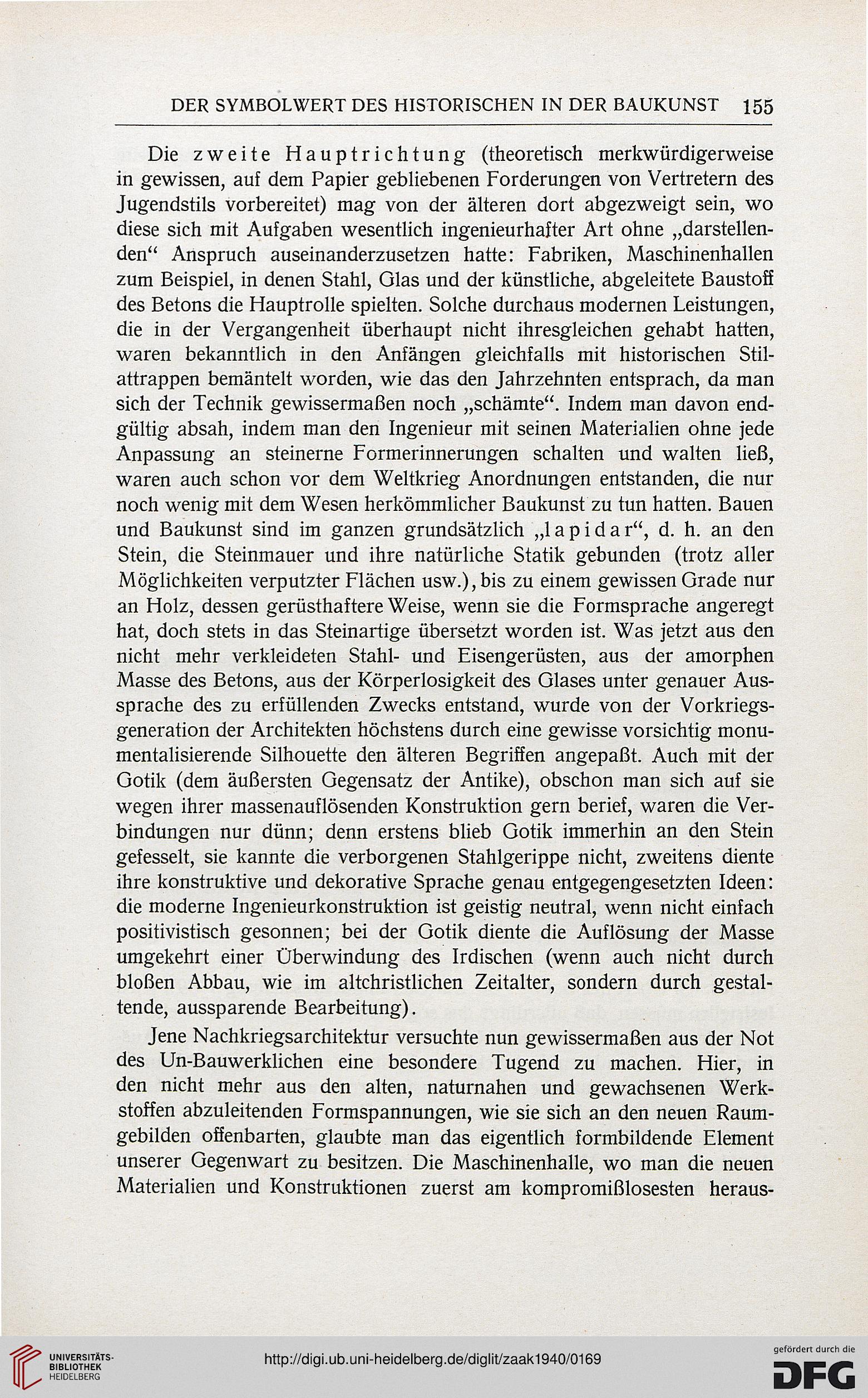DER SYMBOLWERT DES HISTORISCHEN IN DER BAUKUNST 155
Die zweite Hauptrichtung (theoretisch merkwürdigerweise
in gewissen, auf dem Papier gebliebenen Forderungen von Vertretern des
Jugendstils vorbereitet) mag von der älteren dort abgezweigt sein, wo
diese sich mit Aufgaben wesentlich ingenieurhafter Art ohne „darstellen-
den" Anspruch auseinanderzusetzen hatte: Fabriken, Maschinenhallen
zum Beispiel, in denen Stahl, Olas und der künstliche, abgeleitete Baustoff
des Betons die Hauptrolle spielten. Solche durchaus modernen Leistungen,
die in der Vergangenheit überhaupt nicht ihresgleichen gehabt hatten,
waren bekanntlich in den Anfängen gleichfalls mit historischen Stil-
attrappen bemäntelt worden, wie das den Jahrzehnten entsprach, da man
sich der Technik gewissermaßen noch „schämte". Indem man davon end-
gültig absah, indem man den Ingenieur mit seinen Materialien ohne jede
Anpassung an steinerne Formerinnerungen schalten und walten ließ,
waren auch schon vor dem Weltkrieg Anordnungen entstanden, die nur
noch wenig mit dem Wesen herkömmlicher Baukunst zu tun hatten. Bauen
und Baukunst sind im ganzen grundsätzlich „lapidar", d. h. an den
Stein, die Steinmauer und ihre natürliche Statik gebunden (trotz aller
Möglichkeiten verputzter Flächen usw.), bis zu einem gewissen Grade nur
an Holz, dessen gerüsthaftere Weise, wenn sie die Formsprache angeregt
hat, doch stets in das Steinartige übersetzt worden ist. Was jetzt aus den
nicht mehr verkleideten Stahl- und Eisengerüsten, aus der amorphen
Masse des Betons, aus der Körperlosigkeit des Glases unter genauer Aus-
sprache des zu erfüllenden Zwecks entstand, wurde von der Vorkriegs-
generation der Architekten höchstens durch eine gewisse vorsichtig monu-
mentalisierende Silhouette den älteren Begriffen angepaßt. Auch mit der
Gotik (dem äußersten Gegensatz der Antike), obschon man sich auf sie
wegen ihrer massenauflösenden Konstruktion gern berief, waren die Ver-
bindungen nur dünn; denn erstens blieb Gotik immerhin an den Stein
gefesselt, sie kannte die verborgenen Stahlgerippe nicht, zweitens diente
ihre konstruktive und dekorative Sprache genau entgegengesetzten Ideen:
die moderne Ingenieurkonstruktion ist geistig neutral, wenn nicht einfach
positivistisch gesonnen; bei der Gotik diente die Auflösung der Masse
umgekehrt einer Überwindung des Irdischen (wenn auch nicht durch
bloßen Abbau, wie im altchristlichen Zeitalter, sondern durch gestal-
tende, aussparende Bearbeitung).
Jene Nachkriegsarchitektur versuchte nun gewissermaßen aus der Not
des Un-Bauwerklichen eine besondere Tugend zu machen. Hier, in
den nicht mehr aus den alten, naturnahen und gewachsenen Werk-
stoffen abzuleitenden Formspannungen, wie sie sich an den neuen Raum-
gebilden offenbarten, glaubte man das eigentlich formbildende Element
unserer Gegenwart zu besitzen. Die Maschinenhalle, wo man die neuen
Materialien und Konstruktionen zuerst am kompromißlosesten heraus-
Die zweite Hauptrichtung (theoretisch merkwürdigerweise
in gewissen, auf dem Papier gebliebenen Forderungen von Vertretern des
Jugendstils vorbereitet) mag von der älteren dort abgezweigt sein, wo
diese sich mit Aufgaben wesentlich ingenieurhafter Art ohne „darstellen-
den" Anspruch auseinanderzusetzen hatte: Fabriken, Maschinenhallen
zum Beispiel, in denen Stahl, Olas und der künstliche, abgeleitete Baustoff
des Betons die Hauptrolle spielten. Solche durchaus modernen Leistungen,
die in der Vergangenheit überhaupt nicht ihresgleichen gehabt hatten,
waren bekanntlich in den Anfängen gleichfalls mit historischen Stil-
attrappen bemäntelt worden, wie das den Jahrzehnten entsprach, da man
sich der Technik gewissermaßen noch „schämte". Indem man davon end-
gültig absah, indem man den Ingenieur mit seinen Materialien ohne jede
Anpassung an steinerne Formerinnerungen schalten und walten ließ,
waren auch schon vor dem Weltkrieg Anordnungen entstanden, die nur
noch wenig mit dem Wesen herkömmlicher Baukunst zu tun hatten. Bauen
und Baukunst sind im ganzen grundsätzlich „lapidar", d. h. an den
Stein, die Steinmauer und ihre natürliche Statik gebunden (trotz aller
Möglichkeiten verputzter Flächen usw.), bis zu einem gewissen Grade nur
an Holz, dessen gerüsthaftere Weise, wenn sie die Formsprache angeregt
hat, doch stets in das Steinartige übersetzt worden ist. Was jetzt aus den
nicht mehr verkleideten Stahl- und Eisengerüsten, aus der amorphen
Masse des Betons, aus der Körperlosigkeit des Glases unter genauer Aus-
sprache des zu erfüllenden Zwecks entstand, wurde von der Vorkriegs-
generation der Architekten höchstens durch eine gewisse vorsichtig monu-
mentalisierende Silhouette den älteren Begriffen angepaßt. Auch mit der
Gotik (dem äußersten Gegensatz der Antike), obschon man sich auf sie
wegen ihrer massenauflösenden Konstruktion gern berief, waren die Ver-
bindungen nur dünn; denn erstens blieb Gotik immerhin an den Stein
gefesselt, sie kannte die verborgenen Stahlgerippe nicht, zweitens diente
ihre konstruktive und dekorative Sprache genau entgegengesetzten Ideen:
die moderne Ingenieurkonstruktion ist geistig neutral, wenn nicht einfach
positivistisch gesonnen; bei der Gotik diente die Auflösung der Masse
umgekehrt einer Überwindung des Irdischen (wenn auch nicht durch
bloßen Abbau, wie im altchristlichen Zeitalter, sondern durch gestal-
tende, aussparende Bearbeitung).
Jene Nachkriegsarchitektur versuchte nun gewissermaßen aus der Not
des Un-Bauwerklichen eine besondere Tugend zu machen. Hier, in
den nicht mehr aus den alten, naturnahen und gewachsenen Werk-
stoffen abzuleitenden Formspannungen, wie sie sich an den neuen Raum-
gebilden offenbarten, glaubte man das eigentlich formbildende Element
unserer Gegenwart zu besitzen. Die Maschinenhalle, wo man die neuen
Materialien und Konstruktionen zuerst am kompromißlosesten heraus-