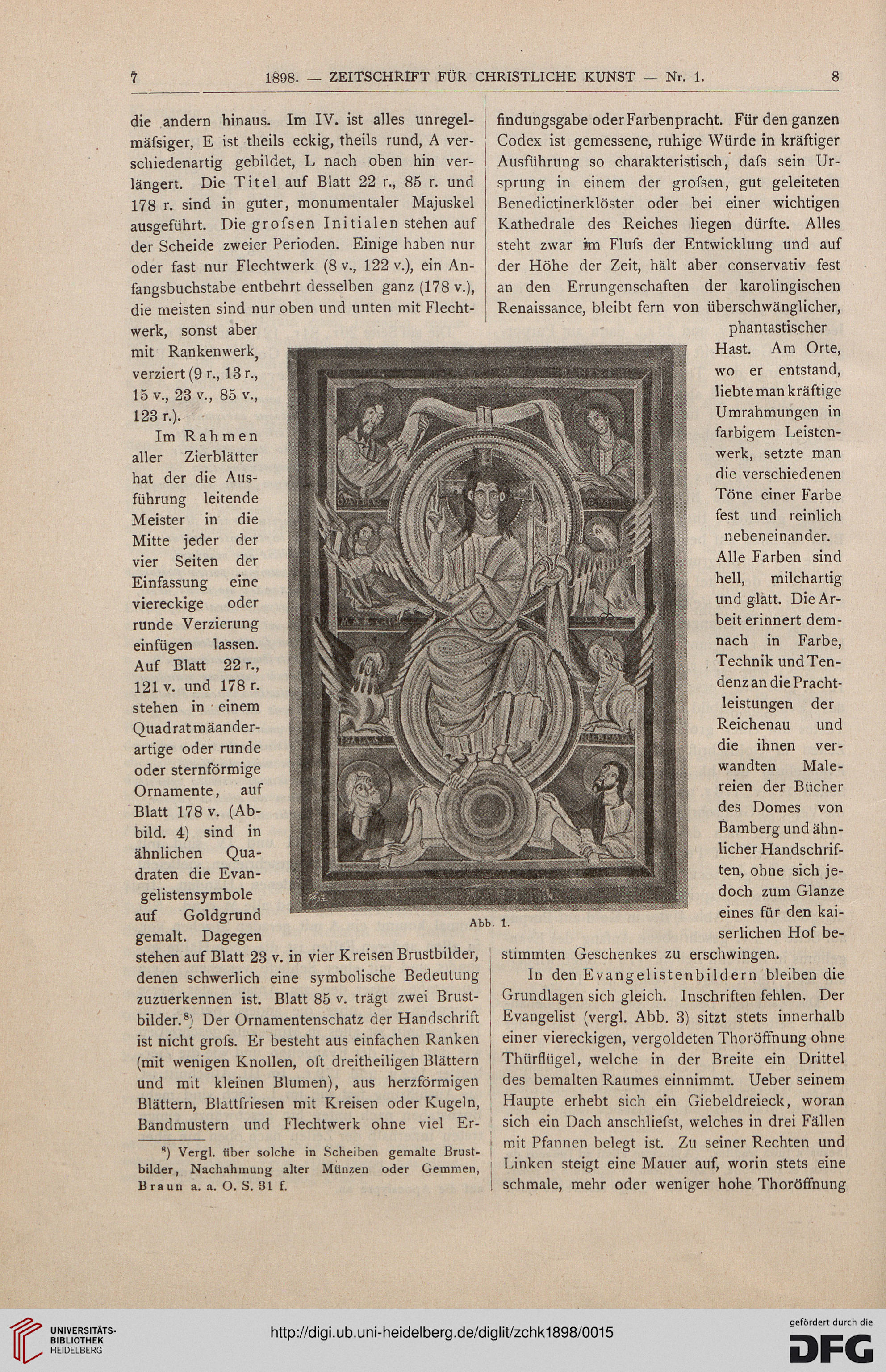1898. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.
der
der
eine
oder
die andern hinaus. Im IV. ist alles unregel-
mäfsiger, E ist theils eckig, theils rund, A ver-
schiedenartig gebildet, L nach oben hin ver-
längert. Die Titel auf Blatt 22 r., 85 r. und
178 r. sind in guter, monumentaler Majuskel
ausgeführt. Die grofsen Initialen stehen auf
der Scheide zweier Perioden. Einige haben nur
oder fast nur Flechtwerk (8 v., 122 v.), ein An-
fangsbuchstabe entbehrt desselben ganz (178 v.),
die meisten sind nur oben und unten mit Flecht-
werk, sonst aber
mit Rankenwerk,
verziert (9 r., 13 r.,
15 v., 23 v., 85 v.,
123 r.).
Im Rahmen
aller Zierblätter
hat der die Aus-
führung leitende
Meister in die
Mitte jeder
vier Seiten
Einfassung
viereckige
runde Verzierung
einfügen lassen.
Auf Blatt 22 r.,
121 v. und 178 r.
stehen in einem
Quadratmäander-
artige oder runde
oder sternförmige
Ornamente, auf
Blatt 178 v. (Ab-
bild. 4) sind in
ähnlichen Qua-
draten die Evan-
gelistensymbole
auf Goldgrund
gemalt. Dagegen
stehen auf Blatt 23 v. in vier Kreisen Brustbilder,
denen schwerlich eine symbolische Bedeutung
zuzuerkennen ist. Blatt 85 v. trägt zwei Brust-
bilder.8) Der Ornamentenschatz der Handschrift
ist nicht grofs. Er besteht aus einfachen Ranken
(mit wenigen Knollen, oft dreitheiligen Blättern
und mit kleinen Blumen), aus herzförmigen
Blättern, Blattfriesen mit Kreisen oder Kugeln,
Bandmustern und Flechtwerk ohne viel Er-
") Vergl. über solche in Scheiben gemalle Brust-
bilder, Nachahmung alter Münzen oder Gemmen,
Braun a. a. O. S. 31 f.
findungsgabe oder Farbenpracht. Für den ganzen
Codex ist gemessene, ruhige Würde in kräftiger
Ausführung so charakteristisch, dafs sein Ur-
sprung in einem der grofsen, gut geleiteten
Benedictinerklöster oder bei einer wichtigen
Kathedrale des Reiches liegen dürfte. Alles
steht zwar im Flufs der Entwicklung und auf
der Höhe der Zeit, hält aber conservativ fest
an den Errungenschaften der karolingischen
Renaissance, bleibt fern von überschwänglicher,
phantastischer
Hast. Am Orte,
wo er entstand,
liebte man kräftige
Umrahmungen in
farbigem Leisten-
werk, setzte man
die verschiedenen
Töne einer Farbe
fest und reinlich
nebeneinander.
Alle Farben sind
hell, milchartig
und glatt. Die Ar-
beit erinnert dem-
nach in Farbe,
Technik und Ten-
denz an die Pracht-
leistungen der
Reichenau und
die ihnen ver-
wandten Male-
reien der Bücher
des Domes von
Bamberg und ähn-
licher Handschrif-
ten, ohne sich je-
doch zum Glänze
eines für den kai-
serlichen Hof be-
stimmten Geschenkes zu erschwingen.
In den Evangelistenbildern bleiben die
Grundlagen sich gleich. Inschriften fehlen. Der
Evangelist (vergl. Abb. 3) sitzt stets innerhalb
einer viereckigen, vergoldeten Thoröffnung ohne
ThUrfliigel, welche in der Breite ein Drittel
des bemalten Raumes einnimmt. Ueber seinem
Haupte erhebt sich ein Giebeldreieck, woran
sich ein Dach anschliefst, welches in drei Fällen
mit Pfannen belegt ist. Zu seiner Rechten und
Linken steigt eine Mauer auf, worin stets eine
schmale, mehr oder weniger hohe Thoröffnung
der
der
eine
oder
die andern hinaus. Im IV. ist alles unregel-
mäfsiger, E ist theils eckig, theils rund, A ver-
schiedenartig gebildet, L nach oben hin ver-
längert. Die Titel auf Blatt 22 r., 85 r. und
178 r. sind in guter, monumentaler Majuskel
ausgeführt. Die grofsen Initialen stehen auf
der Scheide zweier Perioden. Einige haben nur
oder fast nur Flechtwerk (8 v., 122 v.), ein An-
fangsbuchstabe entbehrt desselben ganz (178 v.),
die meisten sind nur oben und unten mit Flecht-
werk, sonst aber
mit Rankenwerk,
verziert (9 r., 13 r.,
15 v., 23 v., 85 v.,
123 r.).
Im Rahmen
aller Zierblätter
hat der die Aus-
führung leitende
Meister in die
Mitte jeder
vier Seiten
Einfassung
viereckige
runde Verzierung
einfügen lassen.
Auf Blatt 22 r.,
121 v. und 178 r.
stehen in einem
Quadratmäander-
artige oder runde
oder sternförmige
Ornamente, auf
Blatt 178 v. (Ab-
bild. 4) sind in
ähnlichen Qua-
draten die Evan-
gelistensymbole
auf Goldgrund
gemalt. Dagegen
stehen auf Blatt 23 v. in vier Kreisen Brustbilder,
denen schwerlich eine symbolische Bedeutung
zuzuerkennen ist. Blatt 85 v. trägt zwei Brust-
bilder.8) Der Ornamentenschatz der Handschrift
ist nicht grofs. Er besteht aus einfachen Ranken
(mit wenigen Knollen, oft dreitheiligen Blättern
und mit kleinen Blumen), aus herzförmigen
Blättern, Blattfriesen mit Kreisen oder Kugeln,
Bandmustern und Flechtwerk ohne viel Er-
") Vergl. über solche in Scheiben gemalle Brust-
bilder, Nachahmung alter Münzen oder Gemmen,
Braun a. a. O. S. 31 f.
findungsgabe oder Farbenpracht. Für den ganzen
Codex ist gemessene, ruhige Würde in kräftiger
Ausführung so charakteristisch, dafs sein Ur-
sprung in einem der grofsen, gut geleiteten
Benedictinerklöster oder bei einer wichtigen
Kathedrale des Reiches liegen dürfte. Alles
steht zwar im Flufs der Entwicklung und auf
der Höhe der Zeit, hält aber conservativ fest
an den Errungenschaften der karolingischen
Renaissance, bleibt fern von überschwänglicher,
phantastischer
Hast. Am Orte,
wo er entstand,
liebte man kräftige
Umrahmungen in
farbigem Leisten-
werk, setzte man
die verschiedenen
Töne einer Farbe
fest und reinlich
nebeneinander.
Alle Farben sind
hell, milchartig
und glatt. Die Ar-
beit erinnert dem-
nach in Farbe,
Technik und Ten-
denz an die Pracht-
leistungen der
Reichenau und
die ihnen ver-
wandten Male-
reien der Bücher
des Domes von
Bamberg und ähn-
licher Handschrif-
ten, ohne sich je-
doch zum Glänze
eines für den kai-
serlichen Hof be-
stimmten Geschenkes zu erschwingen.
In den Evangelistenbildern bleiben die
Grundlagen sich gleich. Inschriften fehlen. Der
Evangelist (vergl. Abb. 3) sitzt stets innerhalb
einer viereckigen, vergoldeten Thoröffnung ohne
ThUrfliigel, welche in der Breite ein Drittel
des bemalten Raumes einnimmt. Ueber seinem
Haupte erhebt sich ein Giebeldreieck, woran
sich ein Dach anschliefst, welches in drei Fällen
mit Pfannen belegt ist. Zu seiner Rechten und
Linken steigt eine Mauer auf, worin stets eine
schmale, mehr oder weniger hohe Thoröffnung