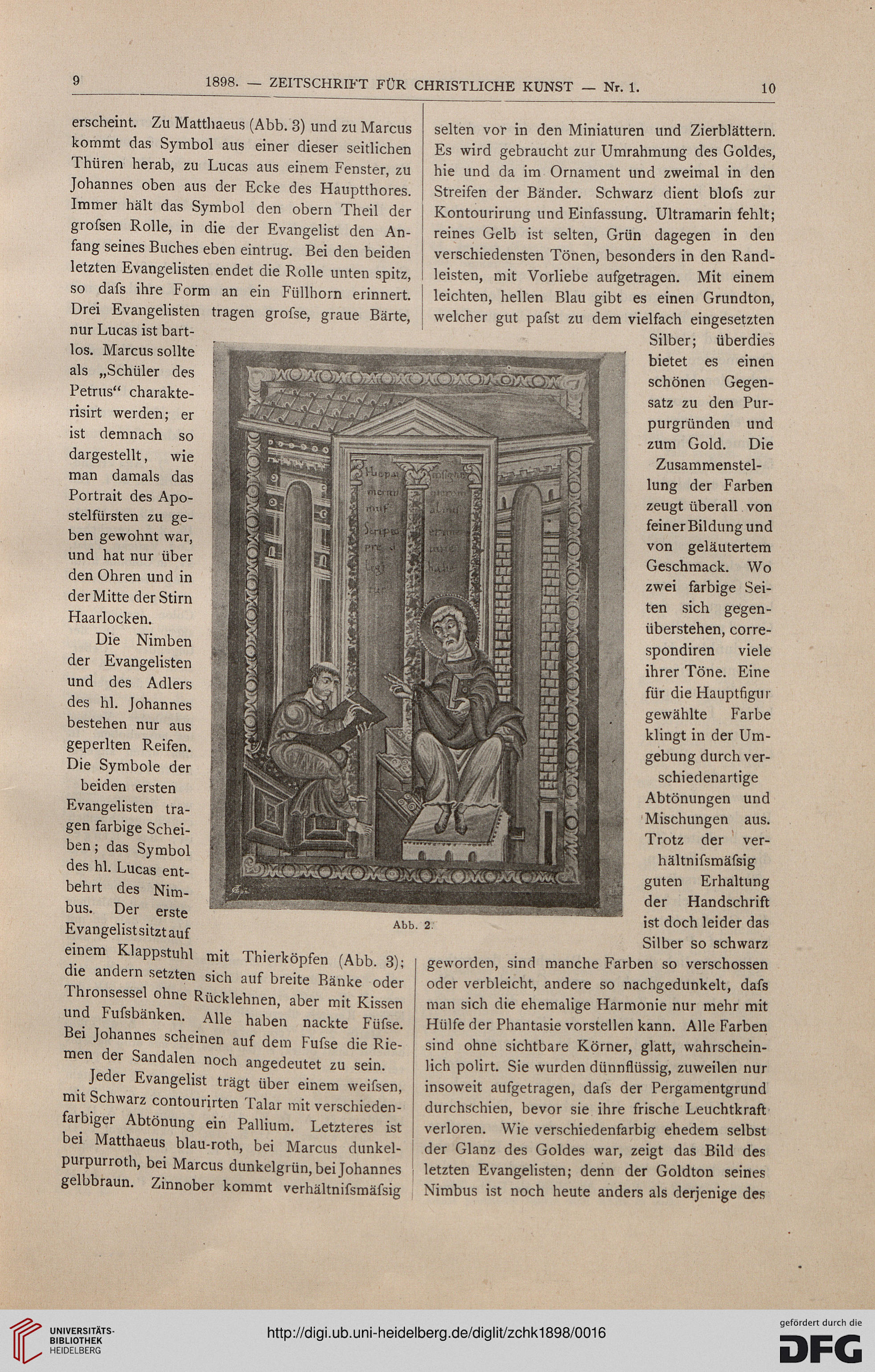1898. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST - Nr. 1.
10
erscheint. Zu Matthaeus (Abb. 3) und zu Marcus
kommt das Symbol aus einer dieser seitlichen
Thüren herab, zu Lucas aus einem Fenster, zu
Johannes oben aus der Ecke des Hauptthores.
Immer hält das Symbol den obern Theil der
grofsen Rolle, in die der Evangelist den An-
fang seines Buches eben eintrug. Bei den beiden
letzten Evangelisten endet die Rolle unten spitz,
so dafs ihre Form an ein Füllhorn erinnert.
Drei Evangelisten tragen grofse, graue Barte,
nur Lucas ist bart-
los. Marcus sollte
als „Schüler des
Petrus" charakte-
risirt werden; er
ist demnach so
dargestellt, wie
man damals das
Portrait des Apo-
stelfürsten zu ge-
ben gewohnt war,
und hat nur über
den Ohren und in
der Mitte der Stirn
Haarlocken.
Die Nimben
der Evangelisten
und des Adlers
des hl. Johannes
bestehen nur aus
geperlten Reifen.
Die Symbole der
beiden ersten
Evangelisten tra-
gen farbige Schei-
ben; das Symbol
des hl. Lucas ent-
behrt des Nim-
bus. Der erste
Evangelist sitzt auf .^^^^^^^^^^^^^^^^m
einem Klappstuhl mit Thierköpfen (Abb. 3);
die andern setzten sich auf breite Bänke oder
Thronsessel ohne Rücklehnen, aber mit Kissen
und Fufsbänken. Alle haben nackte Füfse.
Bei Johannes scheinen auf dem Fufse die Rie-
men der Sandalen noch angedeutet zu sein.
Jeder Evangelist trägt über einem weifsen,
mit Schwarz contourirten Talar mit verschieden-
farbiger Abtönung ein Pallium. Letzteres ist
bei Matthaeus blau-roth, bei Marcus dunkel-
purpurroth, bei Marcus dunkelgrün, bei Johannes
gelbbraun. Zinnober kommt verhältnifsmäfsig
selten vor in den Miniaturen und Zierblättern.
Es wird gebraucht zur Umrahmung des Goldes,
hie und da im Ornament und zweimal in den
Streifen der Bänder. Schwarz dient blofs zur
Kontourirung und Einfassung. Ultramarin fehlt;
reines Gelb ist selten, Grün dagegen in den
verschiedensten Tönen, besonders in den Rand-
leisten, mit Vorliebe aufgetragen. Mit einem
leichten, hellen Blau gibt es einen Grundton,
welcher gut pafst zu dem vielfach eingesetzten
Silber; überdies
bietet es einen
schönen Gegen-
satz zu den Pur-
purgründen und
zum Gold. Die
Zusammenstel-
lung der Farben
zeugt überall von
feiner Bildung und
von geläutertem
Geschmack. Wo
zwei farbige Sei-
ten sich gegen-
überstehen, corre-
spondiren viele
ihrer Töne. Eine
für die Hauptfigur
gewählte Farbe
klingt in der Um-
gebung durch ver-
schiedenartige
Abtönungen und
Mischungen aus.
Trotz der ver-
hältnifsmäfsig
guten Erhaltung
der Handschrift
^^^^^^^^^^^^^^^^ ist doch leider das
Silber so schwarz
geworden, sind manche Farben so verschossen
oder verbleicht, andere so nachgedunkelt, dafs
man sich die ehemalige Harmonie nur mehr mit
Hülfe der Phantasie vorstellen kann. Alle Farben
sind ohne sichtbare Körner, glatt, wahrschein-
lich polirt. Sie wurden dünnflüssig, zuweilen nur
insoweit aufgetragen, dafs der Pergamentgrund
durchschien, bevor sie ihre frische Leuchtkraft
verloren. Wie verschiedenfarbig ehedem selbst
der Glanz des Goldes war, zeigt das Bild des
letzten Evangelisten; denn der Goldton seines
Nimbus ist noch heute anders als derjenige des
10
erscheint. Zu Matthaeus (Abb. 3) und zu Marcus
kommt das Symbol aus einer dieser seitlichen
Thüren herab, zu Lucas aus einem Fenster, zu
Johannes oben aus der Ecke des Hauptthores.
Immer hält das Symbol den obern Theil der
grofsen Rolle, in die der Evangelist den An-
fang seines Buches eben eintrug. Bei den beiden
letzten Evangelisten endet die Rolle unten spitz,
so dafs ihre Form an ein Füllhorn erinnert.
Drei Evangelisten tragen grofse, graue Barte,
nur Lucas ist bart-
los. Marcus sollte
als „Schüler des
Petrus" charakte-
risirt werden; er
ist demnach so
dargestellt, wie
man damals das
Portrait des Apo-
stelfürsten zu ge-
ben gewohnt war,
und hat nur über
den Ohren und in
der Mitte der Stirn
Haarlocken.
Die Nimben
der Evangelisten
und des Adlers
des hl. Johannes
bestehen nur aus
geperlten Reifen.
Die Symbole der
beiden ersten
Evangelisten tra-
gen farbige Schei-
ben; das Symbol
des hl. Lucas ent-
behrt des Nim-
bus. Der erste
Evangelist sitzt auf .^^^^^^^^^^^^^^^^m
einem Klappstuhl mit Thierköpfen (Abb. 3);
die andern setzten sich auf breite Bänke oder
Thronsessel ohne Rücklehnen, aber mit Kissen
und Fufsbänken. Alle haben nackte Füfse.
Bei Johannes scheinen auf dem Fufse die Rie-
men der Sandalen noch angedeutet zu sein.
Jeder Evangelist trägt über einem weifsen,
mit Schwarz contourirten Talar mit verschieden-
farbiger Abtönung ein Pallium. Letzteres ist
bei Matthaeus blau-roth, bei Marcus dunkel-
purpurroth, bei Marcus dunkelgrün, bei Johannes
gelbbraun. Zinnober kommt verhältnifsmäfsig
selten vor in den Miniaturen und Zierblättern.
Es wird gebraucht zur Umrahmung des Goldes,
hie und da im Ornament und zweimal in den
Streifen der Bänder. Schwarz dient blofs zur
Kontourirung und Einfassung. Ultramarin fehlt;
reines Gelb ist selten, Grün dagegen in den
verschiedensten Tönen, besonders in den Rand-
leisten, mit Vorliebe aufgetragen. Mit einem
leichten, hellen Blau gibt es einen Grundton,
welcher gut pafst zu dem vielfach eingesetzten
Silber; überdies
bietet es einen
schönen Gegen-
satz zu den Pur-
purgründen und
zum Gold. Die
Zusammenstel-
lung der Farben
zeugt überall von
feiner Bildung und
von geläutertem
Geschmack. Wo
zwei farbige Sei-
ten sich gegen-
überstehen, corre-
spondiren viele
ihrer Töne. Eine
für die Hauptfigur
gewählte Farbe
klingt in der Um-
gebung durch ver-
schiedenartige
Abtönungen und
Mischungen aus.
Trotz der ver-
hältnifsmäfsig
guten Erhaltung
der Handschrift
^^^^^^^^^^^^^^^^ ist doch leider das
Silber so schwarz
geworden, sind manche Farben so verschossen
oder verbleicht, andere so nachgedunkelt, dafs
man sich die ehemalige Harmonie nur mehr mit
Hülfe der Phantasie vorstellen kann. Alle Farben
sind ohne sichtbare Körner, glatt, wahrschein-
lich polirt. Sie wurden dünnflüssig, zuweilen nur
insoweit aufgetragen, dafs der Pergamentgrund
durchschien, bevor sie ihre frische Leuchtkraft
verloren. Wie verschiedenfarbig ehedem selbst
der Glanz des Goldes war, zeigt das Bild des
letzten Evangelisten; denn der Goldton seines
Nimbus ist noch heute anders als derjenige des