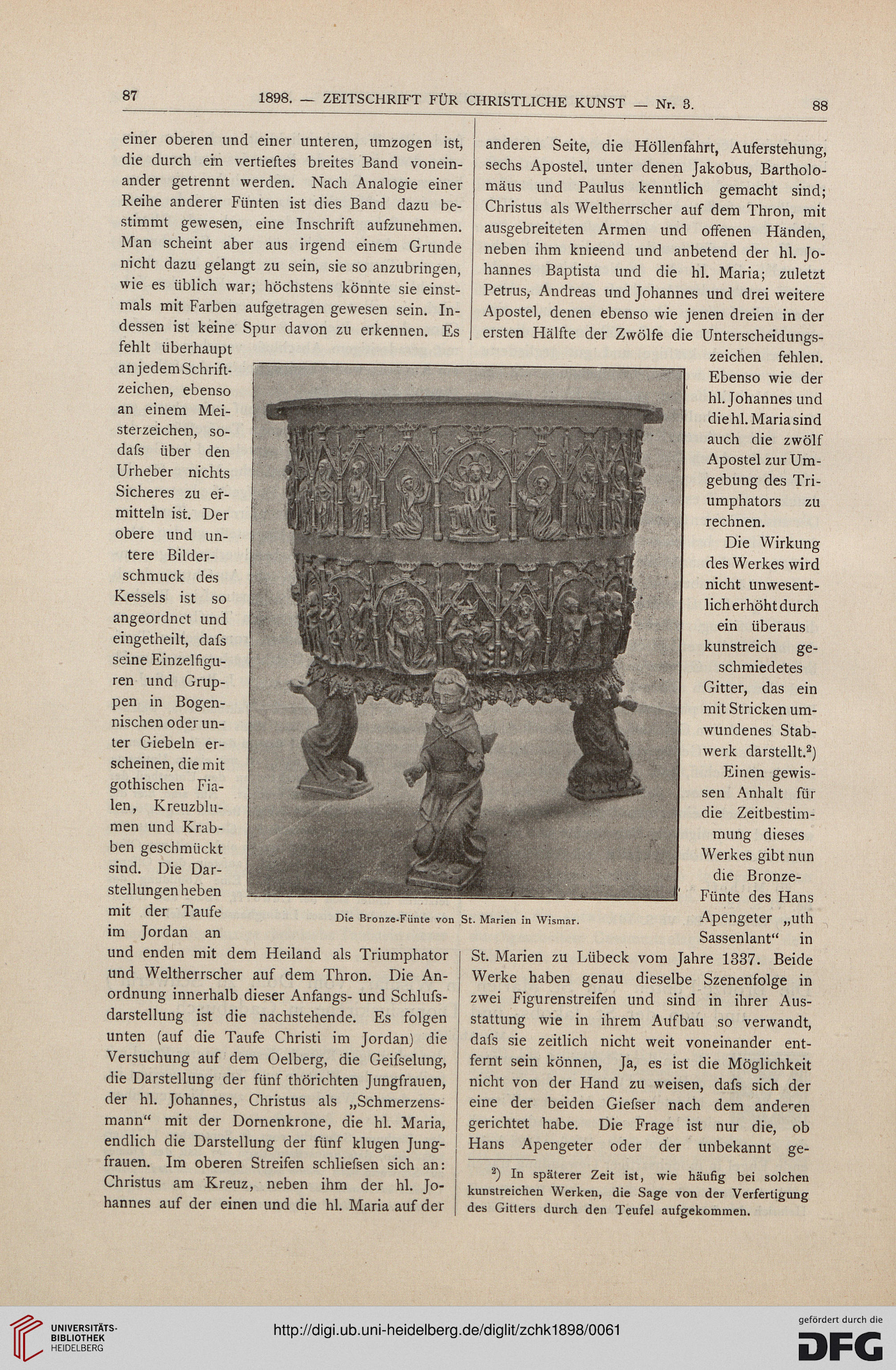87
1898.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.
88
einer oberen und einer unteren, umzogen ist,
die durch ein vertieftes breites Band vonein-
ander getrennt werden. Nach Analogie einer
Reihe anderer Fünten ist dies Band dazu be-
stimmt gewesen, eine Inschrift aufzunehmen.
Man scheint aber aus irgend einem Grunde
nicht dazu gelangt zu sein, sie so anzubringen,
wie es üblich war; höchstens könnte sie einst-
mals mit Farben aufgetragen gewesen sein. In-
dessen ist keine Spur davon zu erkennen. Es
fehlt überhaupt
an jedem Schrift-
zeichen, ebenso
an einem Mei-
sterzeichen, so-
dafs über den
Urheber nichts
Sicheres zu er-
mitteln ist. Der
obere und un-
tere Bilder-
schmuck des
Kessels ist so
angeordnet und
eingetheilt, dafs
seine Einzelfigu-
ren und Grup-
pen in Bogen-
nischen oder un-
ter Giebeln er-
scheinen, die mit
gothischen Fia-
len, Kreuzblu-
men und Krab-
ben geschmückt
sind. Die Dar-
stellungen heben
mit der Taufe
im Jordan an
und enden mit dem Heiland als Triumphator
und Weltherrscher auf dem Thron. Die An-
ordnung innerhalb dieser Anfangs- und Schlufs-
darstellung ist die nachstehende. Es folgen
unten (auf die Taufe Christi im Jordan) die
Versuchung auf dem Oelberg, die Geifselung,
die Darstellung der fünf thörichten Jungfrauen,
der hl. Johannes, Christus als „Schmerzens-
mann" mit der Dornenkrone, die hl. Maria,
endlich die Darstellung der fünf klugen Jung-
frauen. Im oberen Streifen schliefsen sich an:
Christus am Kreuz, neben ihm der hl. Jo-
hannes auf der einen und die hl. Maria auf der
Die Bronze-Fünte von St. Marien in Wi:
anderen Seite, die Höllenfahrt, Auferstehung,
sechs Apostel, unter denen Jakobus, Bartholo-
mäus und Paulus kenntlich gemacht sind;
Christus als Weltherrscher auf dem Thron, mit
ausgebreiteten Armen und offenen Händen,
neben ihm knieend und anbetend der hl. Jo-
hannes Baptista und die hl. Maria; zuletzt
Petrus, Andreas und Johannes und drei weitere
Apostel, denen ebenso wie jenen dreien in der
ersten Hälfte der Zwölfe die Unterscheidungs-
zeichen fehlen.
Ebenso wie der
hl. Johannes und
diehl. Maria sind
auch die zwölf
Apostel zur Um-
gebung des Tri-
umphators zu
rechnen.
Die Wirkung
des Werkes wird
nicht unwesent-
lich erhöht durch
ein überaus
kunstreich ge-
schmiedetes
Gitter, das ein
mit Stricken um-
wundenes Stab-
werk darstellt.2)
Einen gewis-
sen Anhalt für
die Zeitbestim-
mung dieses
Werkes gibt nun
die Bronze-
Fünte des Hans
Apengeter „uth
Sassenlant" in
St. Marien zu Lübeck vom Jahre 1337. Beide
Werke haben genau dieselbe Szenenfolge in
zwei Figurenstreifen und sind in ihrer Aus-
stattung wie in ihrem Aufbau so verwandt,
dafs sie zeitlich nicht weit voneinander ent-
fernt sein können, Ja, es ist die Möglichkeit
nicht von der Hand zu weisen, dafs sich der
eine der beiden Giefser nach dem andeen
gerichtet habe. Die Frage ist nur die, ob
Hans Apengeter oder der unbekannt ge-
2) In späterer Zeit ist, wie häufig bei solchen
kunstreichen Werken, die Sage von der Verfertigung
des Gitters durch den Teufel aufgekommen.
w
w*
. "LfcJUHffi^S
.'■'■';■
JHyBJH. -r] £ *
■
P-
■ T
1898.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.
88
einer oberen und einer unteren, umzogen ist,
die durch ein vertieftes breites Band vonein-
ander getrennt werden. Nach Analogie einer
Reihe anderer Fünten ist dies Band dazu be-
stimmt gewesen, eine Inschrift aufzunehmen.
Man scheint aber aus irgend einem Grunde
nicht dazu gelangt zu sein, sie so anzubringen,
wie es üblich war; höchstens könnte sie einst-
mals mit Farben aufgetragen gewesen sein. In-
dessen ist keine Spur davon zu erkennen. Es
fehlt überhaupt
an jedem Schrift-
zeichen, ebenso
an einem Mei-
sterzeichen, so-
dafs über den
Urheber nichts
Sicheres zu er-
mitteln ist. Der
obere und un-
tere Bilder-
schmuck des
Kessels ist so
angeordnet und
eingetheilt, dafs
seine Einzelfigu-
ren und Grup-
pen in Bogen-
nischen oder un-
ter Giebeln er-
scheinen, die mit
gothischen Fia-
len, Kreuzblu-
men und Krab-
ben geschmückt
sind. Die Dar-
stellungen heben
mit der Taufe
im Jordan an
und enden mit dem Heiland als Triumphator
und Weltherrscher auf dem Thron. Die An-
ordnung innerhalb dieser Anfangs- und Schlufs-
darstellung ist die nachstehende. Es folgen
unten (auf die Taufe Christi im Jordan) die
Versuchung auf dem Oelberg, die Geifselung,
die Darstellung der fünf thörichten Jungfrauen,
der hl. Johannes, Christus als „Schmerzens-
mann" mit der Dornenkrone, die hl. Maria,
endlich die Darstellung der fünf klugen Jung-
frauen. Im oberen Streifen schliefsen sich an:
Christus am Kreuz, neben ihm der hl. Jo-
hannes auf der einen und die hl. Maria auf der
Die Bronze-Fünte von St. Marien in Wi:
anderen Seite, die Höllenfahrt, Auferstehung,
sechs Apostel, unter denen Jakobus, Bartholo-
mäus und Paulus kenntlich gemacht sind;
Christus als Weltherrscher auf dem Thron, mit
ausgebreiteten Armen und offenen Händen,
neben ihm knieend und anbetend der hl. Jo-
hannes Baptista und die hl. Maria; zuletzt
Petrus, Andreas und Johannes und drei weitere
Apostel, denen ebenso wie jenen dreien in der
ersten Hälfte der Zwölfe die Unterscheidungs-
zeichen fehlen.
Ebenso wie der
hl. Johannes und
diehl. Maria sind
auch die zwölf
Apostel zur Um-
gebung des Tri-
umphators zu
rechnen.
Die Wirkung
des Werkes wird
nicht unwesent-
lich erhöht durch
ein überaus
kunstreich ge-
schmiedetes
Gitter, das ein
mit Stricken um-
wundenes Stab-
werk darstellt.2)
Einen gewis-
sen Anhalt für
die Zeitbestim-
mung dieses
Werkes gibt nun
die Bronze-
Fünte des Hans
Apengeter „uth
Sassenlant" in
St. Marien zu Lübeck vom Jahre 1337. Beide
Werke haben genau dieselbe Szenenfolge in
zwei Figurenstreifen und sind in ihrer Aus-
stattung wie in ihrem Aufbau so verwandt,
dafs sie zeitlich nicht weit voneinander ent-
fernt sein können, Ja, es ist die Möglichkeit
nicht von der Hand zu weisen, dafs sich der
eine der beiden Giefser nach dem andeen
gerichtet habe. Die Frage ist nur die, ob
Hans Apengeter oder der unbekannt ge-
2) In späterer Zeit ist, wie häufig bei solchen
kunstreichen Werken, die Sage von der Verfertigung
des Gitters durch den Teufel aufgekommen.
w
w*
. "LfcJUHffi^S
.'■'■';■
JHyBJH. -r] £ *
■
P-
■ T