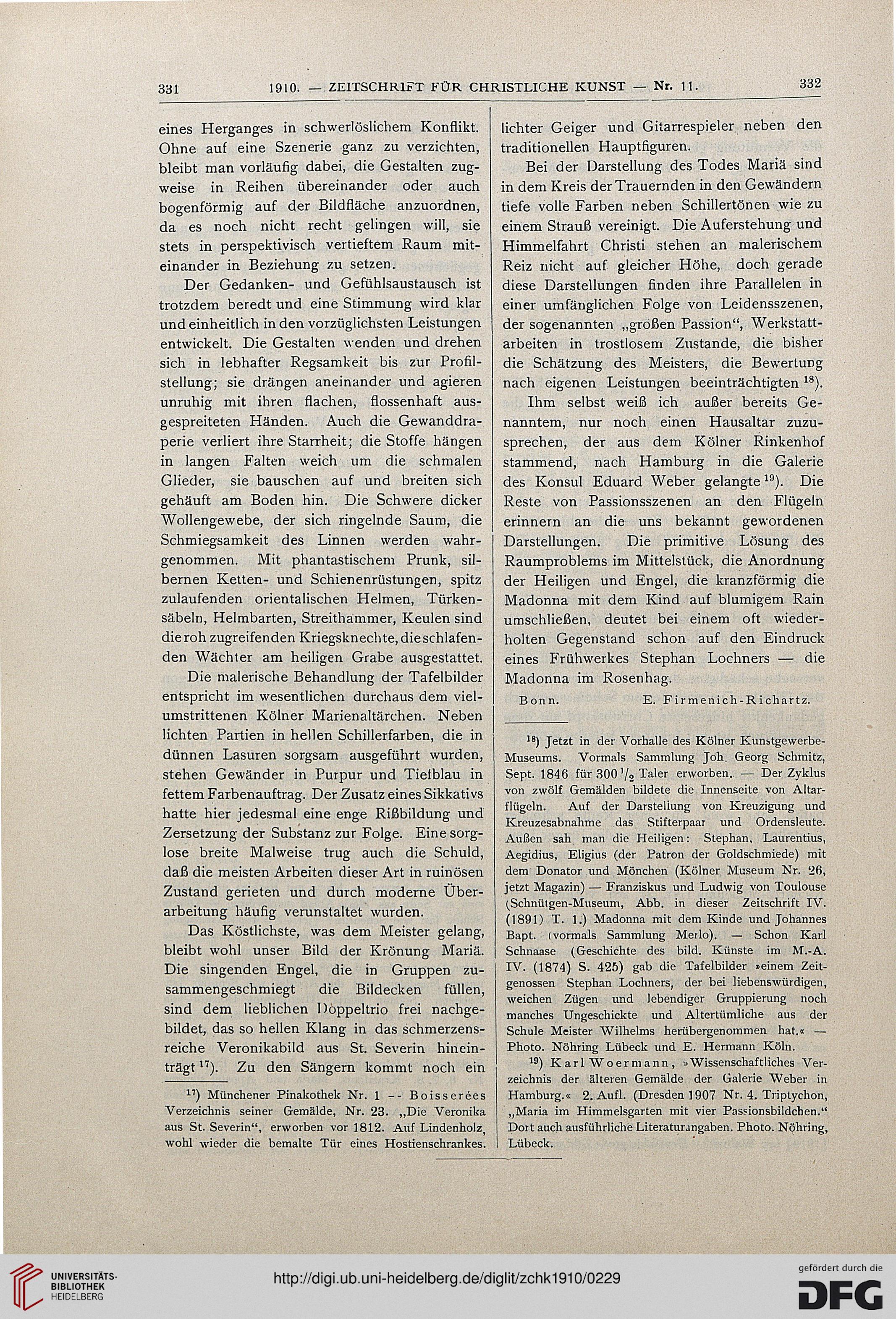331
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
332
eines Herganges in schwerlöslichem Konflikt.
Ohne auf eine Szenerie ganz zu verzichten,
bleibt man vorläufig dabei, die Gestalten zug-
weise in Reihen übereinander oder auch
bogenförmig auf der Bildfläche anzuordnen,
da es noch nicht recht gelingen will, sie
stets in perspektivisch vertieftem Raum mit-
einander in Beziehung zu setzen.
Der Gedanken- und Gefühlsaustausch ist
trotzdem beredt und eine Stimmung wird klar
und einheitlich in den vorzüglichsten Leistungen
entwickelt. Die Gestalten wenden und drehen
sich in lebhafter Regsamkeit bis zur Profil-
stellung; sie drängen aneinander und agieren
unruhig mit ihren flachen, flossenhaft aus-
gespreiteten Händen. Auch die Gewanddra-
perie verliert ihre Starrheit; die Stoffe hängen
in langen Falten weich um die schmalen
Glieder, sie bauschen auf und breiten sich
gehäuft am Boden hin. Die Schwere dicker
Wollengewebe, der sich ringelnde Saum, die
Schmiegsamkeit des Linnen werden wahr-
genommen. Mit phantastischem Prunk, sil-
bernen Ketten- und Schienenrüstungen, spitz
zulaufenden orientalischen Helmen, Türken-
säbeln, Helmbarten, Streithämmer, Keulen sind
dieroh zugreifenden Kriegsknechte, die schlafen-
den Wächter am heiligen Grabe ausgestattet.
Die malerische Behandlung der Tafelbilder
entspricht im wesentlichen durchaus dem viel-
umstrittenen Kölner Marienaltärchen. Neben
lichten Partien in hellen Schillerfarben, die in
dünnen Lasuren sorgsam ausgeführt wurden,
stehen Gewänder in Purpur und Tiefblau in
fettem Farbenauftrag. Der Zusatz eines Sikkativs
hatte hier jedesmal eine enge Rißbildung und
Zersetzung der Substanz zur Folge. Eine sorg-
lose breite Malweise trug auch die Schuld,
daß die meisten Arbeiten dieser Art in ruinösen
Zustand gerieten und durch moderne Über-
arbeitung häufig verunstaltet wurden.
Das Köstlichste, was dem Meister gelang,
bleibt wohl unser Bild der Krönung Maria.
Die singenden Engel, die in Gruppen zu-
sammengeschmiegt die Bildecken füllen,
sind dem lieblichen Döppeltrio frei nachge-
bildet, das so hellen Klang in das schmerzens-
reiche Veronikabild aus St. Severin hinein-
trägt l7). Zu den Sängern kommt noch ein
17) Münchener Pinakothek Nr. 1 -- Boisserees
Verzeichnis seiner Gemälde, Nr. 23. „Die Veronika
aus St. Severin", erworben vor 1812. Auf Lindenholz,
wohl wieder die bemalte Tür eines Hostienschrankes.
lichter Geiger und Gitarrespieler neben den
traditionellen Hauptfiguren.
Bei der Darstellung des Todes Maria sind
in dem Kreis der Trauernden in den Gewändern
tiefe volle Farben neben Schillertönen ,wie zu
einem Strauß vereinigt. Die Auferstehung und
Himmelfahrt Christi stehen an malerischem
Reiz nicht auf gleicher Höhe, doch gerade
diese Darstellungen finden ihre Parallelen in
einer umfänglichen Folge von Leidensszenen,
der sogenannten „großen Passion", Werkstatt-
arbeiten in trostlosem Zustande, die bisher
die Schätzung des Meisters, die Bewertung
nach eigenen Leistungen beeinträchtigten 18).
Ihm selbst weiß ich außer bereits Ge-
nanntem, nur noch einen Hausaltar zuzu-
sprechen, der aus dem Kölner Rinkenhof
stammend, nach Hamburg in die Galerie
des Konsul Eduard Weber gelangte10). Die
Reste von Passionsszenen an den Flügeln
erinnern an die uns bekannt gewordenen
Darstellungen. Die primitive Lösung des
Raumproblems im Mittelstück, die Anordnung
der Heiligen und Engel, die kranzförmig die
Madonna mit dem Kind auf blumigem Rain
umschließen, deutet bei einem oft wieder-
holten Gegenstand schon auf den Eindruck
eines Frühwerkes Stephan Lochners — die
Madonna im Rosenhag.
Bonn.
E. Firmenich-Richartz.
18) Jetzt in der Vorhalle des Kölner Kunstgewerbe-
Museums. Vormals Sammlung Joh. Georg Schmitz,
Sept. 1846 für 300 V» Taler erworben.. — Der Zyklus
von zwölf Gemälden bildete die Innenseite von Altar-
flügeln. Auf der Darstellung von Kreuzigung und
Kreuzesabnahme das Stifterpaar und Ordensleute.
Außen sah man die Heiligen: Stephan, Laurentius,
Aegidius, Eligius (der Patron der Goldschmiede) mit
dem Donator und Mönchen (Kölner Museum Nr. 26,
jetzt Magazin) — Franziskus und Ludwig von Toulouse
(Schnülgen-Museum, Abb. in dieser Zeitschrift IV.
(1891) T. 1.) Madonna mit dem Kinde und Johannes
Bapt. (vormals Sammlung Metlo). — Schon Karl
Schnaase (Geschichte des bild. Künste im M.-A.
IV. (1874) S. 425) gab die Tafelbilder »einem Zeit-
genossen Stephan Lochners, der bei liebenswürdigen,
weichen Zügen und lebendiger Gruppierung noch
manches Ungeschickte und Altertümliche aus der
Schule Meister Wilhelms herübergenommen hat.« —
Photo. Nöhring Lübeck und E. Hermann Köln.
19) Karl Woermann , »Wissenschaftliches Ver-
zeichnis der älteren Gemälde der Galerie Weber in
Hamburg.« 2. Aufl. (Dresden 1907 Nr. 4. Triptychon,
„Maria im Himmelsgarten mit vier Passionsbildchen."
Dort auch ausführliche Literaturangaben. Photo. Nöhring,
Lübeck.
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
332
eines Herganges in schwerlöslichem Konflikt.
Ohne auf eine Szenerie ganz zu verzichten,
bleibt man vorläufig dabei, die Gestalten zug-
weise in Reihen übereinander oder auch
bogenförmig auf der Bildfläche anzuordnen,
da es noch nicht recht gelingen will, sie
stets in perspektivisch vertieftem Raum mit-
einander in Beziehung zu setzen.
Der Gedanken- und Gefühlsaustausch ist
trotzdem beredt und eine Stimmung wird klar
und einheitlich in den vorzüglichsten Leistungen
entwickelt. Die Gestalten wenden und drehen
sich in lebhafter Regsamkeit bis zur Profil-
stellung; sie drängen aneinander und agieren
unruhig mit ihren flachen, flossenhaft aus-
gespreiteten Händen. Auch die Gewanddra-
perie verliert ihre Starrheit; die Stoffe hängen
in langen Falten weich um die schmalen
Glieder, sie bauschen auf und breiten sich
gehäuft am Boden hin. Die Schwere dicker
Wollengewebe, der sich ringelnde Saum, die
Schmiegsamkeit des Linnen werden wahr-
genommen. Mit phantastischem Prunk, sil-
bernen Ketten- und Schienenrüstungen, spitz
zulaufenden orientalischen Helmen, Türken-
säbeln, Helmbarten, Streithämmer, Keulen sind
dieroh zugreifenden Kriegsknechte, die schlafen-
den Wächter am heiligen Grabe ausgestattet.
Die malerische Behandlung der Tafelbilder
entspricht im wesentlichen durchaus dem viel-
umstrittenen Kölner Marienaltärchen. Neben
lichten Partien in hellen Schillerfarben, die in
dünnen Lasuren sorgsam ausgeführt wurden,
stehen Gewänder in Purpur und Tiefblau in
fettem Farbenauftrag. Der Zusatz eines Sikkativs
hatte hier jedesmal eine enge Rißbildung und
Zersetzung der Substanz zur Folge. Eine sorg-
lose breite Malweise trug auch die Schuld,
daß die meisten Arbeiten dieser Art in ruinösen
Zustand gerieten und durch moderne Über-
arbeitung häufig verunstaltet wurden.
Das Köstlichste, was dem Meister gelang,
bleibt wohl unser Bild der Krönung Maria.
Die singenden Engel, die in Gruppen zu-
sammengeschmiegt die Bildecken füllen,
sind dem lieblichen Döppeltrio frei nachge-
bildet, das so hellen Klang in das schmerzens-
reiche Veronikabild aus St. Severin hinein-
trägt l7). Zu den Sängern kommt noch ein
17) Münchener Pinakothek Nr. 1 -- Boisserees
Verzeichnis seiner Gemälde, Nr. 23. „Die Veronika
aus St. Severin", erworben vor 1812. Auf Lindenholz,
wohl wieder die bemalte Tür eines Hostienschrankes.
lichter Geiger und Gitarrespieler neben den
traditionellen Hauptfiguren.
Bei der Darstellung des Todes Maria sind
in dem Kreis der Trauernden in den Gewändern
tiefe volle Farben neben Schillertönen ,wie zu
einem Strauß vereinigt. Die Auferstehung und
Himmelfahrt Christi stehen an malerischem
Reiz nicht auf gleicher Höhe, doch gerade
diese Darstellungen finden ihre Parallelen in
einer umfänglichen Folge von Leidensszenen,
der sogenannten „großen Passion", Werkstatt-
arbeiten in trostlosem Zustande, die bisher
die Schätzung des Meisters, die Bewertung
nach eigenen Leistungen beeinträchtigten 18).
Ihm selbst weiß ich außer bereits Ge-
nanntem, nur noch einen Hausaltar zuzu-
sprechen, der aus dem Kölner Rinkenhof
stammend, nach Hamburg in die Galerie
des Konsul Eduard Weber gelangte10). Die
Reste von Passionsszenen an den Flügeln
erinnern an die uns bekannt gewordenen
Darstellungen. Die primitive Lösung des
Raumproblems im Mittelstück, die Anordnung
der Heiligen und Engel, die kranzförmig die
Madonna mit dem Kind auf blumigem Rain
umschließen, deutet bei einem oft wieder-
holten Gegenstand schon auf den Eindruck
eines Frühwerkes Stephan Lochners — die
Madonna im Rosenhag.
Bonn.
E. Firmenich-Richartz.
18) Jetzt in der Vorhalle des Kölner Kunstgewerbe-
Museums. Vormals Sammlung Joh. Georg Schmitz,
Sept. 1846 für 300 V» Taler erworben.. — Der Zyklus
von zwölf Gemälden bildete die Innenseite von Altar-
flügeln. Auf der Darstellung von Kreuzigung und
Kreuzesabnahme das Stifterpaar und Ordensleute.
Außen sah man die Heiligen: Stephan, Laurentius,
Aegidius, Eligius (der Patron der Goldschmiede) mit
dem Donator und Mönchen (Kölner Museum Nr. 26,
jetzt Magazin) — Franziskus und Ludwig von Toulouse
(Schnülgen-Museum, Abb. in dieser Zeitschrift IV.
(1891) T. 1.) Madonna mit dem Kinde und Johannes
Bapt. (vormals Sammlung Metlo). — Schon Karl
Schnaase (Geschichte des bild. Künste im M.-A.
IV. (1874) S. 425) gab die Tafelbilder »einem Zeit-
genossen Stephan Lochners, der bei liebenswürdigen,
weichen Zügen und lebendiger Gruppierung noch
manches Ungeschickte und Altertümliche aus der
Schule Meister Wilhelms herübergenommen hat.« —
Photo. Nöhring Lübeck und E. Hermann Köln.
19) Karl Woermann , »Wissenschaftliches Ver-
zeichnis der älteren Gemälde der Galerie Weber in
Hamburg.« 2. Aufl. (Dresden 1907 Nr. 4. Triptychon,
„Maria im Himmelsgarten mit vier Passionsbildchen."
Dort auch ausführliche Literaturangaben. Photo. Nöhring,
Lübeck.