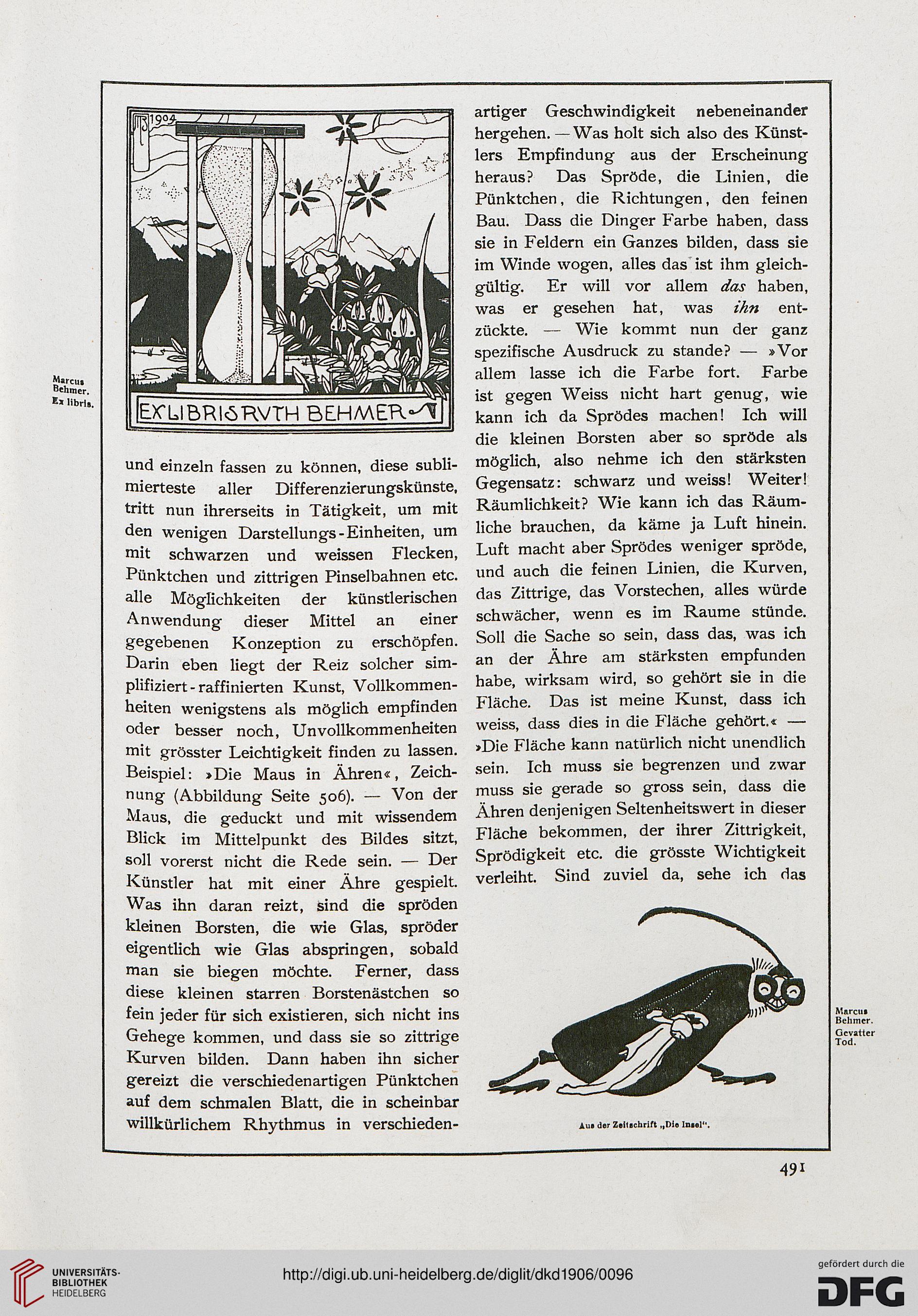und einzeln fassen zu können, diese subli-
mierteste aller Differenzierungskünste,
tritt nun ihrerseits in Tätigkeit, um mit
den wenigen Darstellungs-Einheiten, um
mit schwarzen und weissen Flecken,
Pünktchen und zittrigen Pinselbahnen etc.
alle Möglichkeiten der künstlerischen
Anwendung dieser Mittel an einer
gegebenen Konzeption zu erschöpfen.
Darin eben liegt der Reiz solcher sim-
plifiziert - raffinierten Kunst, Vollkommen-
heiten wenigstens als möglich empfinden
oder besser noch, UnVollkommenheiten
mit grösster Leichtigkeit finden zu lassen.
Beispiel: >Die Maus in Ähren«, Zeich-
nung (Abbildung Seite 506). — Von der
Maus, die geduckt und mit wissendem
Blick im Mittelpunkt des Bildes sitzt,
soll vorerst nicht die Rede sein. — Der
Künstler hat mit einer Ähre gespielt.
Was ihn daran reizt, sind die spröden
kleinen Borsten, die wie Glas, spröder
eigentlich wie Glas abspringen, sobald
man sie biegen möchte. Ferner, dass
diese kleinen starren Borstenästchen so
fein jeder für sich existieren, sich nicht ins
Gehege kommen, und dass sie so zittrige
Kurven bilden. Dann haben ihn sicher
gereizt die verschiedenartigen Pünktchen
auf dem schmalen Blatt, die in scheinbar
willkürlichem Rhythmus in verschieden-
artiger Geschwindigkeit nebeneinander
hergehen. — Was holt sich also des Künst-
lers Empfindung aus der Erscheinung
heraus? Das Spröde, die Linien, die
Pünktchen, die Richtungen, den feinen
Bau. Dass die Dinger Farbe haben, dass
sie in Feldern ein Ganzes bilden, dass sie
im Winde wogen, alles das ist ihm gleich-
gültig. Er will vor allem das haben,
was er gesehen hat, was ihn ent-
zückte. — Wie kommt nun der ganz
spezifische Ausdruck zu stände? — »Vor
allem lasse ich die Farbe fort. Farbe
ist gegen Weiss nicht hart genug, wie
kann ich da Sprödes machen! Ich will
die kleinen Borsten aber so spröde als
möglich, also nehme ich den stärksten
Gegensatz: schwarz und weiss! Weiter!
Räumlichkeit? Wie kann ich das Räum-
liche brauchen, da käme ja Luft hinein.
Luft macht aber Sprödes weniger spröde,
und auch die feinen Linien, die Kurven,
das Zittrige, das Vorstechen, alles würde
schwächer, wenn es im Räume stünde.
Soll die Sache so sein, dass das, was ich
an der Ähre am stärksten empfunden
habe, wirksam wird, so gehört sie in die
Fläche. Das ist meine Kunst, dass ich
weiss, dass dies in die Fläche gehört.* —
»Die Fläche kann natürlich nicht unendlich
sein. Ich muss sie begrenzen und zwar
muss sie gerade so gross sein, dass die
Ähren denjenigen Seltenheitswert in dieser
Fläche bekommen, der ihrer Zittrigkeit,
Sprödigkeit etc. die grösste Wichtigkeit
verleiht. Sind zuviel da, sehe ich das
Au* der Zeitschrift „Die Ituel"
491
mierteste aller Differenzierungskünste,
tritt nun ihrerseits in Tätigkeit, um mit
den wenigen Darstellungs-Einheiten, um
mit schwarzen und weissen Flecken,
Pünktchen und zittrigen Pinselbahnen etc.
alle Möglichkeiten der künstlerischen
Anwendung dieser Mittel an einer
gegebenen Konzeption zu erschöpfen.
Darin eben liegt der Reiz solcher sim-
plifiziert - raffinierten Kunst, Vollkommen-
heiten wenigstens als möglich empfinden
oder besser noch, UnVollkommenheiten
mit grösster Leichtigkeit finden zu lassen.
Beispiel: >Die Maus in Ähren«, Zeich-
nung (Abbildung Seite 506). — Von der
Maus, die geduckt und mit wissendem
Blick im Mittelpunkt des Bildes sitzt,
soll vorerst nicht die Rede sein. — Der
Künstler hat mit einer Ähre gespielt.
Was ihn daran reizt, sind die spröden
kleinen Borsten, die wie Glas, spröder
eigentlich wie Glas abspringen, sobald
man sie biegen möchte. Ferner, dass
diese kleinen starren Borstenästchen so
fein jeder für sich existieren, sich nicht ins
Gehege kommen, und dass sie so zittrige
Kurven bilden. Dann haben ihn sicher
gereizt die verschiedenartigen Pünktchen
auf dem schmalen Blatt, die in scheinbar
willkürlichem Rhythmus in verschieden-
artiger Geschwindigkeit nebeneinander
hergehen. — Was holt sich also des Künst-
lers Empfindung aus der Erscheinung
heraus? Das Spröde, die Linien, die
Pünktchen, die Richtungen, den feinen
Bau. Dass die Dinger Farbe haben, dass
sie in Feldern ein Ganzes bilden, dass sie
im Winde wogen, alles das ist ihm gleich-
gültig. Er will vor allem das haben,
was er gesehen hat, was ihn ent-
zückte. — Wie kommt nun der ganz
spezifische Ausdruck zu stände? — »Vor
allem lasse ich die Farbe fort. Farbe
ist gegen Weiss nicht hart genug, wie
kann ich da Sprödes machen! Ich will
die kleinen Borsten aber so spröde als
möglich, also nehme ich den stärksten
Gegensatz: schwarz und weiss! Weiter!
Räumlichkeit? Wie kann ich das Räum-
liche brauchen, da käme ja Luft hinein.
Luft macht aber Sprödes weniger spröde,
und auch die feinen Linien, die Kurven,
das Zittrige, das Vorstechen, alles würde
schwächer, wenn es im Räume stünde.
Soll die Sache so sein, dass das, was ich
an der Ähre am stärksten empfunden
habe, wirksam wird, so gehört sie in die
Fläche. Das ist meine Kunst, dass ich
weiss, dass dies in die Fläche gehört.* —
»Die Fläche kann natürlich nicht unendlich
sein. Ich muss sie begrenzen und zwar
muss sie gerade so gross sein, dass die
Ähren denjenigen Seltenheitswert in dieser
Fläche bekommen, der ihrer Zittrigkeit,
Sprödigkeit etc. die grösste Wichtigkeit
verleiht. Sind zuviel da, sehe ich das
Au* der Zeitschrift „Die Ituel"
491