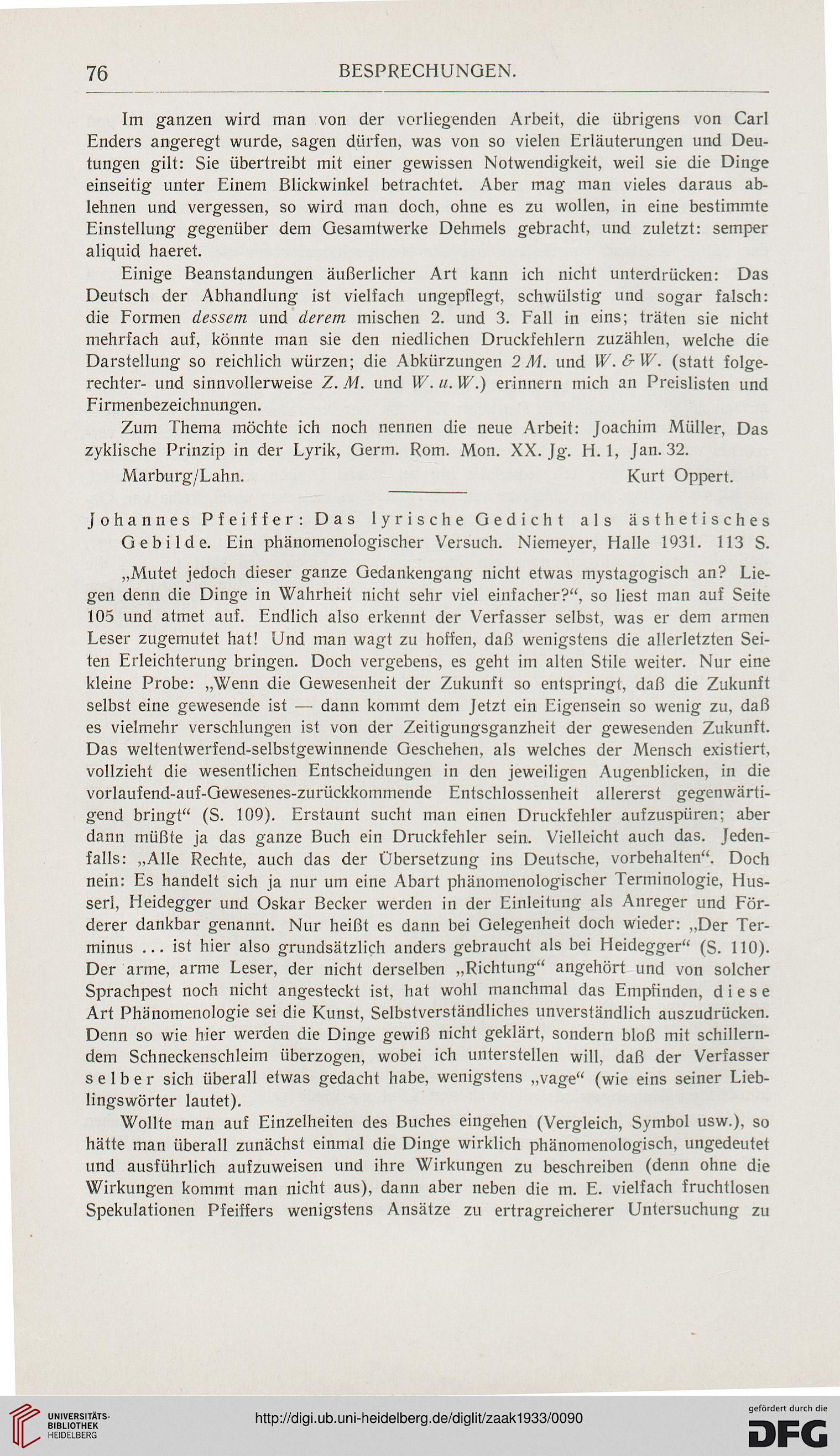76
BESPRECHUNGEN.
Im ganzen wird man von der vorliegenden Arbeit, die übrigens von Carl
Enders angeregt wurde, sagen dürfen, was von so vielen Erläuterungen und Deu-
tungen gilt: Sie übertreibt mit einer gewissen Notwendigkeit, weil sie die Dinge
einseitig unter Einem Blickwinkel betrachtet. Aber mag man vieles daraus ab-
lehnen und vergessen, so wird man doch, ohne es zu wollen, in eine bestimmte
Einstellung gegenüber dem Gesamtwerke Dehmels gebracht, und zuletzt: Semper
aliquid haeret.
Einige Beanstandungen äußerlicher Art kann ich nicht unterdrücken: Das
Deutsch der Abhandlung ist vielfach ungepflegt, schwülstig und sogar falsch:
die Formen dessem und derem mischen 2. und 3. Fall in eins; träten sie nicht
mehrfach auf, könnte man sie den niedlichen Druckfehlern zuzählen, welche die
Darstellung so reichlich würzen; die Abkürzungen 2 M. und W.&W. (statt folge-
rechter- und sinnvollerweise Z. M. und W. u. W.) erinnern mich an Preislisten und
Firmenbezeichnungen.
Zum Thema möchte ich noch nennen die neue Arbeit: Joachim Müller, Das
zyklische Prinzip in der Lyrik, Germ. Rom. Mon. XX. Jg. H. 1, Jan. 32.
Marburg/Lahn. Kurt Oppert.
Johannes Pfeiffer: Das lyrische Gedicht als ästhetisches
Gebilde. Ein phänomenologischer Versuch. Niemeyer, Halle 1931. 113 S.
„Mutet jedoch dieser ganze Gedankengang nicht etwas mystagogisch an? Lie-
gen denn die Dinge in Wahrheit nicht sehr viel einfacher?", so liest man auf Seite
105 und atmet auf. Endlich also erkennt der Verfasser selbst, was er dem armen
Leser zugemutet hat! Und man wagt zu hoffen, daß wenigstens die allerletzten Sei-
ten Erleichterung bringen. Doch vergebens, es geht im alten Stile weiter. Nur eine
kleine Probe: „Wenn die Gewesenheit der Zukunft so entspringt, daß die Zukunft
selbst eine gewesende ist — dann kommt dem Jetzt ein Eigensein so wenig zu, daß
es vielmehr verschlungen ist von der Zeitigungsganzheit der gewesenden Zukunft.
Das weltentwerfend-selbstgewinnende Geschehen, als welches der Mensch existiert,
vollzieht die wesentlichen Entscheidungen in den jeweiligen Augenblicken, in die
vorlaufend-auf-Gewesenes-zurückkommende Entschlossenheit allererst gegenwärti-
gend bringt" (S. 109). Erstaunt sucht man einen Druckfehler aufzuspüren; aber
dann müßte ja das ganze Buch ein Druckfehler sein. Vielleicht auch das. Jeden-
falls: „Alle Rechte, auch das der Übersetzung ins Deutsche, vorbehalten". Doch
nein: Es handelt sich ja nur um eine Abart phänomenologischer Terminologie, Hus-
serl, Heidegger und Oskar Becker werden in der Einleitung als Anreger und För-
derer dankbar genannt. Nur heißt es dann bei Gelegenheit doch wieder: „Der Ter-
minus ... ist hier also grundsätzlich anders gebraucht als bei Heidegger" (S. 110).
Der arme, arme Leser, der nicht derselben „Richtung" angehört und von solcher
Sprachpest noch nicht angesteckt ist, hat wohl manchmal das Empfinden, diese
Art Phänomenologie sei die Kunst, Selbstverständliches unverständlich auszudrücken.
Denn so wie hier werden die Dinge gewiß nicht geklärt, sondern bloß mit schillern-
dem Schneckenschleim überzogen, wobei ich unterstellen will, daß der Verfasser
selber sich überall etwas gedacht habe, wenigstens „vage" (wie eins seiner Lieb-
lingswörter lautet).
Wollte man auf Einzelheiten des Buches eingehen (Vergleich, Symbol usw.), so
hätte man überall zunächst einmal die Dinge wirklich phänomenologisch, ungedeutet
und ausführlich aufzuweisen und ihre Wirkungen zu beschreiben (denn ohne die
Wirkungen kommt man nicht aus), dann aber neben die m. E. vielfach fruchtlosen
Spekulationen Pfeiffers wenigstens Ansätze zu ertragreicherer Untersuchung zu
BESPRECHUNGEN.
Im ganzen wird man von der vorliegenden Arbeit, die übrigens von Carl
Enders angeregt wurde, sagen dürfen, was von so vielen Erläuterungen und Deu-
tungen gilt: Sie übertreibt mit einer gewissen Notwendigkeit, weil sie die Dinge
einseitig unter Einem Blickwinkel betrachtet. Aber mag man vieles daraus ab-
lehnen und vergessen, so wird man doch, ohne es zu wollen, in eine bestimmte
Einstellung gegenüber dem Gesamtwerke Dehmels gebracht, und zuletzt: Semper
aliquid haeret.
Einige Beanstandungen äußerlicher Art kann ich nicht unterdrücken: Das
Deutsch der Abhandlung ist vielfach ungepflegt, schwülstig und sogar falsch:
die Formen dessem und derem mischen 2. und 3. Fall in eins; träten sie nicht
mehrfach auf, könnte man sie den niedlichen Druckfehlern zuzählen, welche die
Darstellung so reichlich würzen; die Abkürzungen 2 M. und W.&W. (statt folge-
rechter- und sinnvollerweise Z. M. und W. u. W.) erinnern mich an Preislisten und
Firmenbezeichnungen.
Zum Thema möchte ich noch nennen die neue Arbeit: Joachim Müller, Das
zyklische Prinzip in der Lyrik, Germ. Rom. Mon. XX. Jg. H. 1, Jan. 32.
Marburg/Lahn. Kurt Oppert.
Johannes Pfeiffer: Das lyrische Gedicht als ästhetisches
Gebilde. Ein phänomenologischer Versuch. Niemeyer, Halle 1931. 113 S.
„Mutet jedoch dieser ganze Gedankengang nicht etwas mystagogisch an? Lie-
gen denn die Dinge in Wahrheit nicht sehr viel einfacher?", so liest man auf Seite
105 und atmet auf. Endlich also erkennt der Verfasser selbst, was er dem armen
Leser zugemutet hat! Und man wagt zu hoffen, daß wenigstens die allerletzten Sei-
ten Erleichterung bringen. Doch vergebens, es geht im alten Stile weiter. Nur eine
kleine Probe: „Wenn die Gewesenheit der Zukunft so entspringt, daß die Zukunft
selbst eine gewesende ist — dann kommt dem Jetzt ein Eigensein so wenig zu, daß
es vielmehr verschlungen ist von der Zeitigungsganzheit der gewesenden Zukunft.
Das weltentwerfend-selbstgewinnende Geschehen, als welches der Mensch existiert,
vollzieht die wesentlichen Entscheidungen in den jeweiligen Augenblicken, in die
vorlaufend-auf-Gewesenes-zurückkommende Entschlossenheit allererst gegenwärti-
gend bringt" (S. 109). Erstaunt sucht man einen Druckfehler aufzuspüren; aber
dann müßte ja das ganze Buch ein Druckfehler sein. Vielleicht auch das. Jeden-
falls: „Alle Rechte, auch das der Übersetzung ins Deutsche, vorbehalten". Doch
nein: Es handelt sich ja nur um eine Abart phänomenologischer Terminologie, Hus-
serl, Heidegger und Oskar Becker werden in der Einleitung als Anreger und För-
derer dankbar genannt. Nur heißt es dann bei Gelegenheit doch wieder: „Der Ter-
minus ... ist hier also grundsätzlich anders gebraucht als bei Heidegger" (S. 110).
Der arme, arme Leser, der nicht derselben „Richtung" angehört und von solcher
Sprachpest noch nicht angesteckt ist, hat wohl manchmal das Empfinden, diese
Art Phänomenologie sei die Kunst, Selbstverständliches unverständlich auszudrücken.
Denn so wie hier werden die Dinge gewiß nicht geklärt, sondern bloß mit schillern-
dem Schneckenschleim überzogen, wobei ich unterstellen will, daß der Verfasser
selber sich überall etwas gedacht habe, wenigstens „vage" (wie eins seiner Lieb-
lingswörter lautet).
Wollte man auf Einzelheiten des Buches eingehen (Vergleich, Symbol usw.), so
hätte man überall zunächst einmal die Dinge wirklich phänomenologisch, ungedeutet
und ausführlich aufzuweisen und ihre Wirkungen zu beschreiben (denn ohne die
Wirkungen kommt man nicht aus), dann aber neben die m. E. vielfach fruchtlosen
Spekulationen Pfeiffers wenigstens Ansätze zu ertragreicherer Untersuchung zu