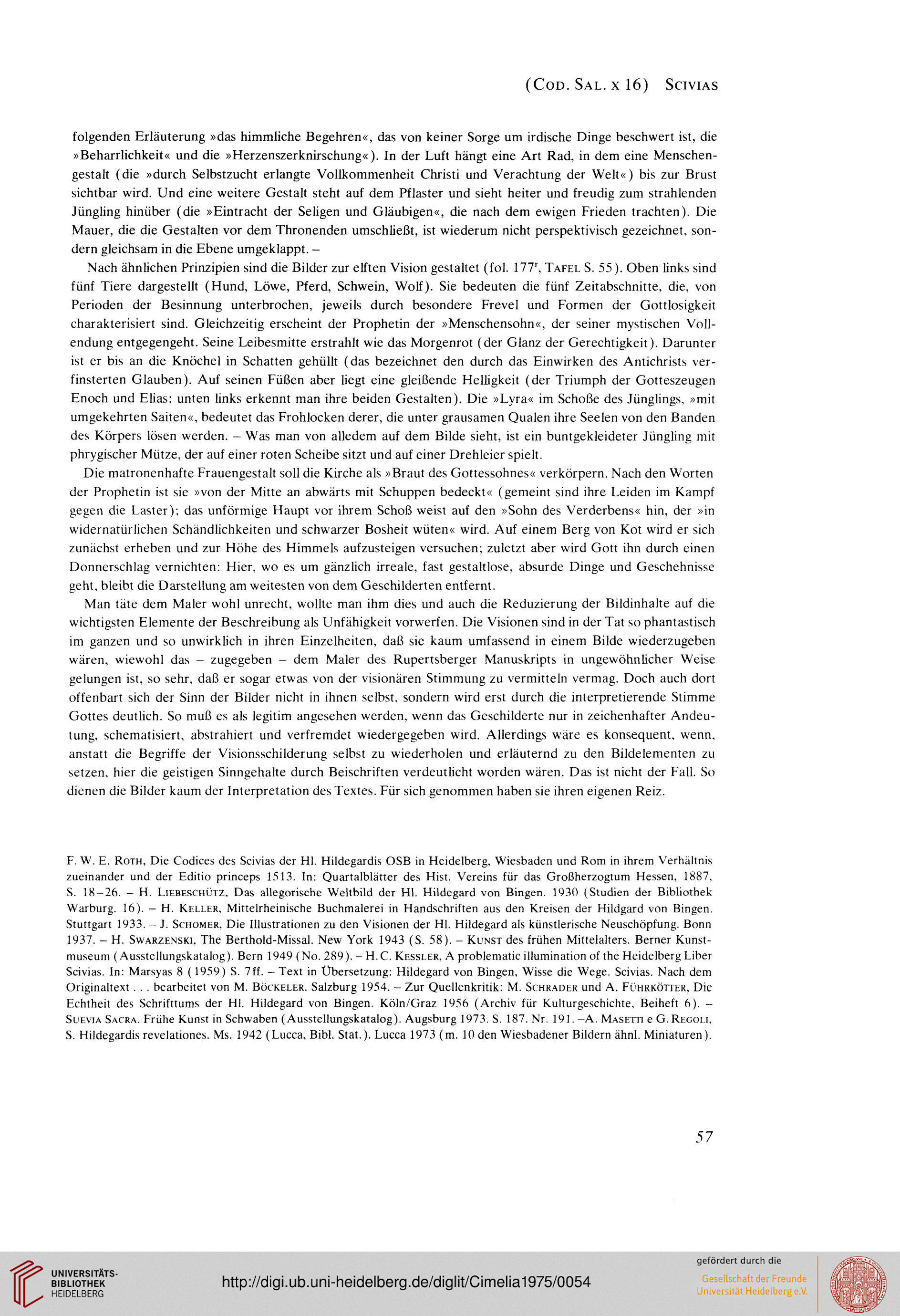(Cod. Sal. x 16) Scivias
folgenden Erläuterung »das himmliche Begehren«, das von keiner Sorge um irdische Dinge beschwert ist, die
»Beharrlichkeit« und die »Herzenszerknirschung«). In der Luft hängt eine Art Rad, in dem eine Menschen-
gestalt (die »durch Selbstzucht erlangte Vollkommenheit Christi und Verachtung der Welt«) bis zur Brust
sichtbar wird. Und eine weitere Gestalt steht auf dem Pflaster und sieht heiter und freudig zum strahlenden
Jüngling hinüber (die »Eintracht der Seligen und Gläubigen«, die nach dem ewigen Frieden trachten). Die
Mauer, die die Gestalten vor dem Thronenden umschließt, ist wiederum nicht perspektivisch gezeichnet, son-
dern gleichsam in die Ebene umgeklappt. -
Nach ähnlichen Prinzipien sind die Bilder zur elften Vision gestaltet (fol. 177r, Tafel S. 55). Oben links sind
fünf Tiere dargestellt (Hund, Löwe, Pferd, Schwein, Wolf). Sie bedeuten die fünf Zeitabschnitte, die, von
Perioden der Besinnung unterbrochen, jeweils durch besondere Frevel und Formen der Gottlosigkeit
charakterisiert sind. Gleichzeitig erscheint der Prophetin der »Menschensohn«, der seiner mystischen Voll-
endung entgegengeht. Seine Leibesmitte erstrahlt wie das Morgenrot (der Glanz der Gerechtigkeit). Darunter
ist er bis an die Knöchel in Schatten gehüllt (das bezeichnet den durch das Einwirken des Antichrists ver-
finsterten Glauben). Auf seinen Füßen aber liegt eine gleißende Helligkeit (der Triumph der Gotteszeugen
Enoch und Elias: unten links erkennt man ihre beiden Gestalten). Die »Lyra« im Schöße des Jünglings, »mit
umgekehrten Saiten«, bedeutet das Frohlocken derer, die unter grausamen Qualen ihre Seelen von den Banden
des Körpers lösen werden. - Was man von alledem auf dem Bilde sieht, ist ein buntgekleideter Jüngling mit
phrygischer Mütze, der auf einer roten Scheibe sitzt und auf einer Drehleier spielt.
Die matronenhafte Frauengestalt soll die Kirche als »Braut des Gottessohnes« verkörpern. Nach den Worten
der Prophetin ist sie »von der Mitte an abwärts mit Schuppen bedeckt« (gemeint sind ihre Leiden im Kampf
gegen die Laster); das unförmige Haupt vor ihrem Schoß weist auf den »Sohn des Verderbens« hin, der »in
widernatürlichen Schändlichkeiten und schwarzer Bosheit wüten« wird. Auf einem Berg von Kot wird er sich
zunächst erheben und zur Höhe des Himmels aufzusteigen versuchen; zuletzt aber wird Gott ihn durch einen
Donnerschlag vernichten: Hier, wo es um gänzlich irreale, fast gestaltlose, absurde Dinge und Geschehnisse
geht, bleibt die Darstellung am weitesten von dem Geschilderten entfernt.
Man täte dem Maler wohl unrecht, wollte man ihm dies und auch die Reduzierung der Bildinhalte auf die
wichtigsten Elemente der Beschreibung als Unfähigkeit vorwerfen. Die Visionen sind in der Tat so phantastisch
im ganzen und so unwirklich in ihren Einzelheiten, daß sie kaum umfassend in einem Bilde wiederzugeben
wären, wiewohl das - zugegeben - dem Maler des Rupertsberger Manuskripts in ungewöhnlicher Weise
gelungen ist, so sehr, daß er sogar etwas von der visionären Stimmung zu vermitteln vermag. Doch auch dort
offenbart sich der Sinn der Bilder nicht in ihnen selbst, sondern wird erst durch die interpretierende Stimme
Gottes deutlich. So muß es als legitim angesehen werden, wenn das Geschilderte nur in zeichenhafter Andeu-
tung, schematisiert, abstrahiert und verfremdet wiedergegeben wird. Allerdings wäre es konsequent, wenn,
anstatt die Begriffe der Visionsschilderung selbst zu wiederholen und erläuternd zu den Bildelementen zu
setzen, hier die geistigen Sinngehalte durch Beischriften verdeutlicht worden wären. Das ist nicht der Fall. So
dienen die Bilder kaum der Interpretation des Textes. Für sich genommen haben sie ihren eigenen Reiz.
F. W. E. Roth, Die Codices des Scivias der Hl. Hildegardis OSB in Heidelberg, Wiesbaden und Rom in ihrem Verhältnis
zueinander und der Editio princeps 1513. In: Quartalblätter des Hist. Vereins für das Großherzogtum Hessen, 1887,
S. 18-26. - H. Liebeschütz, Das allegorische Weltbild der Hl. Hildegard von Bingen. 1930 (Studien der Bibliothek
Warburg. 16). - H. Keller, Mittelrheinische Buchmalerei in Handschriften aus den Kreisen der Hildgard von Bingen.
Stuttgart 1933. - J. Schomer, Die Illustrationen zu den Visionen der Hl. Hildegard als künstlerische Neuschöpfung. Bonn
1937. - H. Swarzenski, The Berthold-Missal. New York 1943 (S. 58). - Kunst des frühen Mittelalters. Berner Kunst-
museum (Ausstellungskatalog). Bern 1949 (No. 289).-H.C. Kessler, A problematic illumination of the Heidelberg Liber
Scivias. In: Marsyas 8 (1959) S. 7ff. -Text in Übersetzung: Hildegard von Bingen, Wisse die Wege. Scivias. Nach dem
Originaltext . . . bearbeitet von M. Böckeler. Salzburg 1954. - Zur Quellenkritik: M. Schrader und A. Führkötter, Die
Echtheit des Schrifttums der Hl. Hildegard von Bingen. Köln/Graz 1956 (Archiv für Kulturgeschichte, Beiheft 6). -
Suevia Sacra. Frühe Kunst in Schwaben (Ausstellungskatalog). Augsburg 1973. S. 187. Nr. 191. -A. Masetti e G.Regoli,
S. Hildegardis revelationes. Ms. 1942 (Lucca, Bibl. Stat.). Lucca 1973 (m. 10 den Wiesbadener Bildern ähnl. Miniaturen).
57
folgenden Erläuterung »das himmliche Begehren«, das von keiner Sorge um irdische Dinge beschwert ist, die
»Beharrlichkeit« und die »Herzenszerknirschung«). In der Luft hängt eine Art Rad, in dem eine Menschen-
gestalt (die »durch Selbstzucht erlangte Vollkommenheit Christi und Verachtung der Welt«) bis zur Brust
sichtbar wird. Und eine weitere Gestalt steht auf dem Pflaster und sieht heiter und freudig zum strahlenden
Jüngling hinüber (die »Eintracht der Seligen und Gläubigen«, die nach dem ewigen Frieden trachten). Die
Mauer, die die Gestalten vor dem Thronenden umschließt, ist wiederum nicht perspektivisch gezeichnet, son-
dern gleichsam in die Ebene umgeklappt. -
Nach ähnlichen Prinzipien sind die Bilder zur elften Vision gestaltet (fol. 177r, Tafel S. 55). Oben links sind
fünf Tiere dargestellt (Hund, Löwe, Pferd, Schwein, Wolf). Sie bedeuten die fünf Zeitabschnitte, die, von
Perioden der Besinnung unterbrochen, jeweils durch besondere Frevel und Formen der Gottlosigkeit
charakterisiert sind. Gleichzeitig erscheint der Prophetin der »Menschensohn«, der seiner mystischen Voll-
endung entgegengeht. Seine Leibesmitte erstrahlt wie das Morgenrot (der Glanz der Gerechtigkeit). Darunter
ist er bis an die Knöchel in Schatten gehüllt (das bezeichnet den durch das Einwirken des Antichrists ver-
finsterten Glauben). Auf seinen Füßen aber liegt eine gleißende Helligkeit (der Triumph der Gotteszeugen
Enoch und Elias: unten links erkennt man ihre beiden Gestalten). Die »Lyra« im Schöße des Jünglings, »mit
umgekehrten Saiten«, bedeutet das Frohlocken derer, die unter grausamen Qualen ihre Seelen von den Banden
des Körpers lösen werden. - Was man von alledem auf dem Bilde sieht, ist ein buntgekleideter Jüngling mit
phrygischer Mütze, der auf einer roten Scheibe sitzt und auf einer Drehleier spielt.
Die matronenhafte Frauengestalt soll die Kirche als »Braut des Gottessohnes« verkörpern. Nach den Worten
der Prophetin ist sie »von der Mitte an abwärts mit Schuppen bedeckt« (gemeint sind ihre Leiden im Kampf
gegen die Laster); das unförmige Haupt vor ihrem Schoß weist auf den »Sohn des Verderbens« hin, der »in
widernatürlichen Schändlichkeiten und schwarzer Bosheit wüten« wird. Auf einem Berg von Kot wird er sich
zunächst erheben und zur Höhe des Himmels aufzusteigen versuchen; zuletzt aber wird Gott ihn durch einen
Donnerschlag vernichten: Hier, wo es um gänzlich irreale, fast gestaltlose, absurde Dinge und Geschehnisse
geht, bleibt die Darstellung am weitesten von dem Geschilderten entfernt.
Man täte dem Maler wohl unrecht, wollte man ihm dies und auch die Reduzierung der Bildinhalte auf die
wichtigsten Elemente der Beschreibung als Unfähigkeit vorwerfen. Die Visionen sind in der Tat so phantastisch
im ganzen und so unwirklich in ihren Einzelheiten, daß sie kaum umfassend in einem Bilde wiederzugeben
wären, wiewohl das - zugegeben - dem Maler des Rupertsberger Manuskripts in ungewöhnlicher Weise
gelungen ist, so sehr, daß er sogar etwas von der visionären Stimmung zu vermitteln vermag. Doch auch dort
offenbart sich der Sinn der Bilder nicht in ihnen selbst, sondern wird erst durch die interpretierende Stimme
Gottes deutlich. So muß es als legitim angesehen werden, wenn das Geschilderte nur in zeichenhafter Andeu-
tung, schematisiert, abstrahiert und verfremdet wiedergegeben wird. Allerdings wäre es konsequent, wenn,
anstatt die Begriffe der Visionsschilderung selbst zu wiederholen und erläuternd zu den Bildelementen zu
setzen, hier die geistigen Sinngehalte durch Beischriften verdeutlicht worden wären. Das ist nicht der Fall. So
dienen die Bilder kaum der Interpretation des Textes. Für sich genommen haben sie ihren eigenen Reiz.
F. W. E. Roth, Die Codices des Scivias der Hl. Hildegardis OSB in Heidelberg, Wiesbaden und Rom in ihrem Verhältnis
zueinander und der Editio princeps 1513. In: Quartalblätter des Hist. Vereins für das Großherzogtum Hessen, 1887,
S. 18-26. - H. Liebeschütz, Das allegorische Weltbild der Hl. Hildegard von Bingen. 1930 (Studien der Bibliothek
Warburg. 16). - H. Keller, Mittelrheinische Buchmalerei in Handschriften aus den Kreisen der Hildgard von Bingen.
Stuttgart 1933. - J. Schomer, Die Illustrationen zu den Visionen der Hl. Hildegard als künstlerische Neuschöpfung. Bonn
1937. - H. Swarzenski, The Berthold-Missal. New York 1943 (S. 58). - Kunst des frühen Mittelalters. Berner Kunst-
museum (Ausstellungskatalog). Bern 1949 (No. 289).-H.C. Kessler, A problematic illumination of the Heidelberg Liber
Scivias. In: Marsyas 8 (1959) S. 7ff. -Text in Übersetzung: Hildegard von Bingen, Wisse die Wege. Scivias. Nach dem
Originaltext . . . bearbeitet von M. Böckeler. Salzburg 1954. - Zur Quellenkritik: M. Schrader und A. Führkötter, Die
Echtheit des Schrifttums der Hl. Hildegard von Bingen. Köln/Graz 1956 (Archiv für Kulturgeschichte, Beiheft 6). -
Suevia Sacra. Frühe Kunst in Schwaben (Ausstellungskatalog). Augsburg 1973. S. 187. Nr. 191. -A. Masetti e G.Regoli,
S. Hildegardis revelationes. Ms. 1942 (Lucca, Bibl. Stat.). Lucca 1973 (m. 10 den Wiesbadener Bildern ähnl. Miniaturen).
57