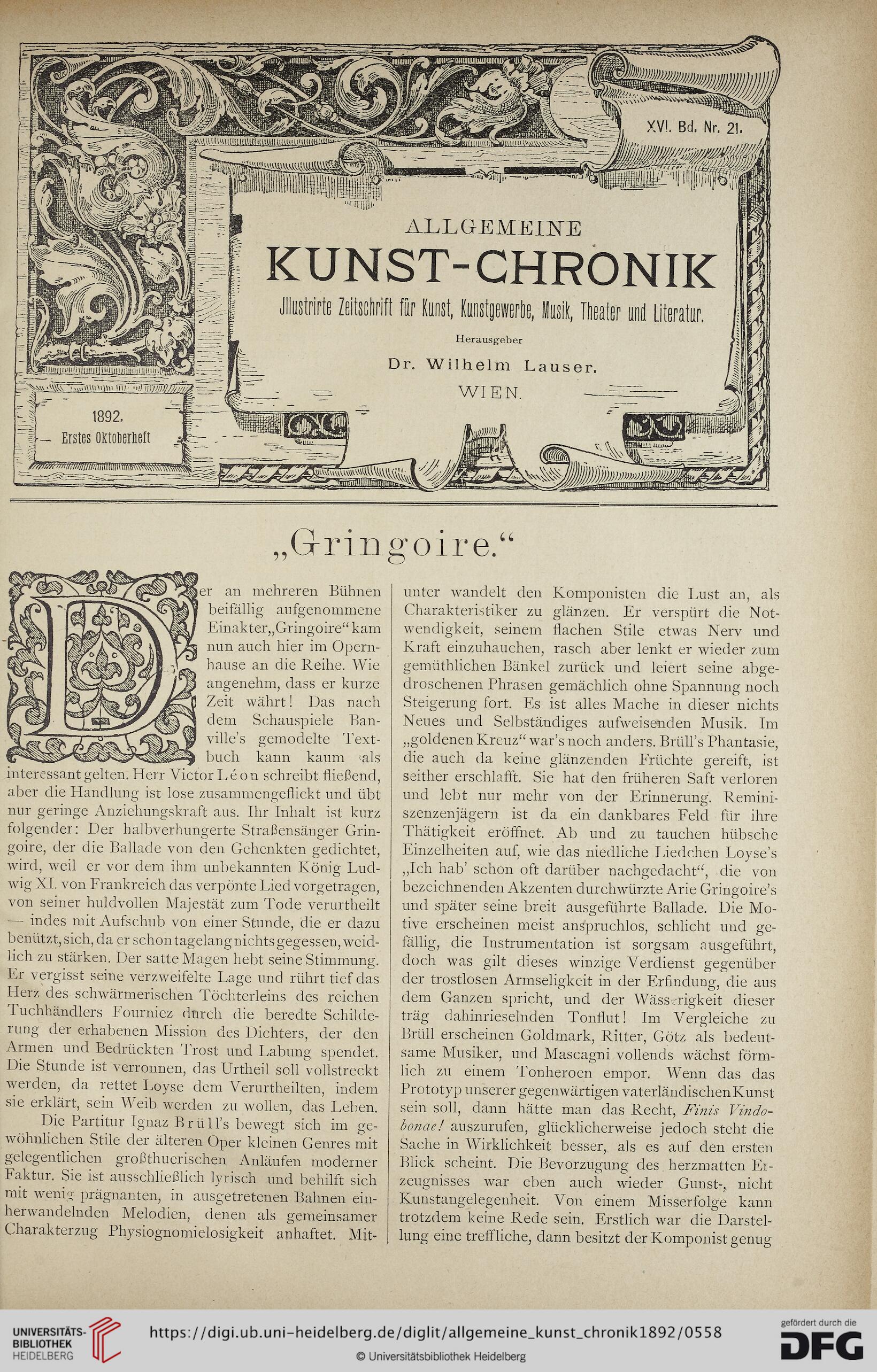„Gringoire."
er an mehreren Bühnen
beifällig aufgenommene
Einakter,, Gringoire" kam
nun auch hier im Opern-
hause an die Reihe. Wie
angenehm, dass er kurze
Zeit währt! Das nach
dem Schauspiele Ban-
ville's gemodelte Text-
buch kann kaum <als
interessant gelten. Herr Victor Leon schreibt fließend,
aber die Handlung ist lose zusammengeflickt und übt
nur geringe Anziehungskraft aus. Ihr Inhalt ist kurz
folgender: Der halbverhungerte Straßensänger Grin-
goire, der die Ballade von den Gehenkten gedichtet,
wird, weil er vor dem ihm unbekannten König Lud-
wig XI. von Frankreich das verpönte Lied vorgetragen,
von seiner huldvollen Majestät zum Tode verurtheilt
— indes mit Aufschub von einer Stunde, die er dazu
benützt, sich, da er schontagelangnichts gegessen, weid-
lich zu stärken. Der satte Magen hebt seine Stimmung.
Er vergisst seine verzweifelte Lage und rührt tief das
Herz des schwärmerischen Töchterleins des reichen
Tuchhändlers Fourniez durch die beredte Schilde-
rung der erhabenen Mission des Dichters, der den
Armen und Bedrückten Trost und Labung spendet.
Die Stunde ist verronnen, das Urtheil soll vollstreckt
werden, da rettet Loyse dem Verurtheilten, indem
sie erklärt, sein Weib werden zu wollen, das Leben.
Die Partitur Ignaz Brüll's bewegt sich im ge-
wöhnlichen Stile der älteren Oper kleinen Genres mit
gelegentlichen großthuerischen Anläufen moderner
Faktur. Sie ist ausschließlich lyrisch und behilft sich
mit wenig prägnanten, in ausgetretenen Bahnen ein-
herwandelnden Melodien, denen als gemeinsamer
Charakterzug Physiognomielosigkeit anhaftet. Mit-
unter wandelt den Komponisten die Lust an, als
Charakteristiker zu glänzen. Er verspürt die Not-
wendigkeit, seinem flachen Stile etwas Nerv und
Kraft einzuhauchen, rasch aber lenkt er wieder zum
gemüthlichen Bänkel zurück und leiert seine abge-
droschenen Phrasen gemächlich ohne Spannung noch
Steigerung fort. Es ist alles Mache in dieser nichts
Neues und Selbständiges aufweisenden Musik. Im
„goldenen Kreuz" war's noch anders. Brüll's Phantasie,
die auch da keine glänzenden Früchte gereift, ist
seither erschlafft. Sie hat den früheren Saft verloren
und lebt nur mehr von der Erinnerung. Remini-
szenzenjägern ist da ein dankbares Feld für ihre
Thätigkeit eröffnet. Ab und zu tauchen hübsche
Einzelheiten auf, wie das niedliche Liedchen Loyse's
„Ich hab' schon oft darüber nachgedacht", die von
bezeichnenden Akzenten durchwürzte Arie Gringoire's
und später seine breit ausgeführte Ballade. Die Mo-
tive erscheinen meist anspruchlos, schlicht und ge-
fällig, die Instrumentation ist sorgsam ausgeführt,
doch was gilt dieses winzige Verdienst gegenüber
der trostlosen Armseligkeit in der Erfindung, die aus
dem Ganzen spricht, und der Wässerigkeit dieser
träg dahinrieselnden Tonflut! Im Vergleiche zu
Brüll erscheinen Goldmark, Ritter, Götz als bedeut-
same Musiker, und Mascagni vollends wächst förm-
lich zu einem Tonheroen empor. Wenn das das
Prototyp unserer gegenwärtigen vaterländischen Kunst
sein soll, dann hätte man das Recht, Finis Vindo-
bonae! auszurufen, glücklicherweise jedoch steht die
Sache in Wirklichkeit besser, als es auf den ersten
Blick scheint. Die Bevorzugung des herzmatten Ei-
zeugnisses war eben auch wieder Gunst-, nicht
Kunstangelegenheit. Von einem Misserfolge kann
trotzdem keine Rede sein. Erstlich war die Darstel-
lung eine treffliche, dann besitzt der Komponist genug