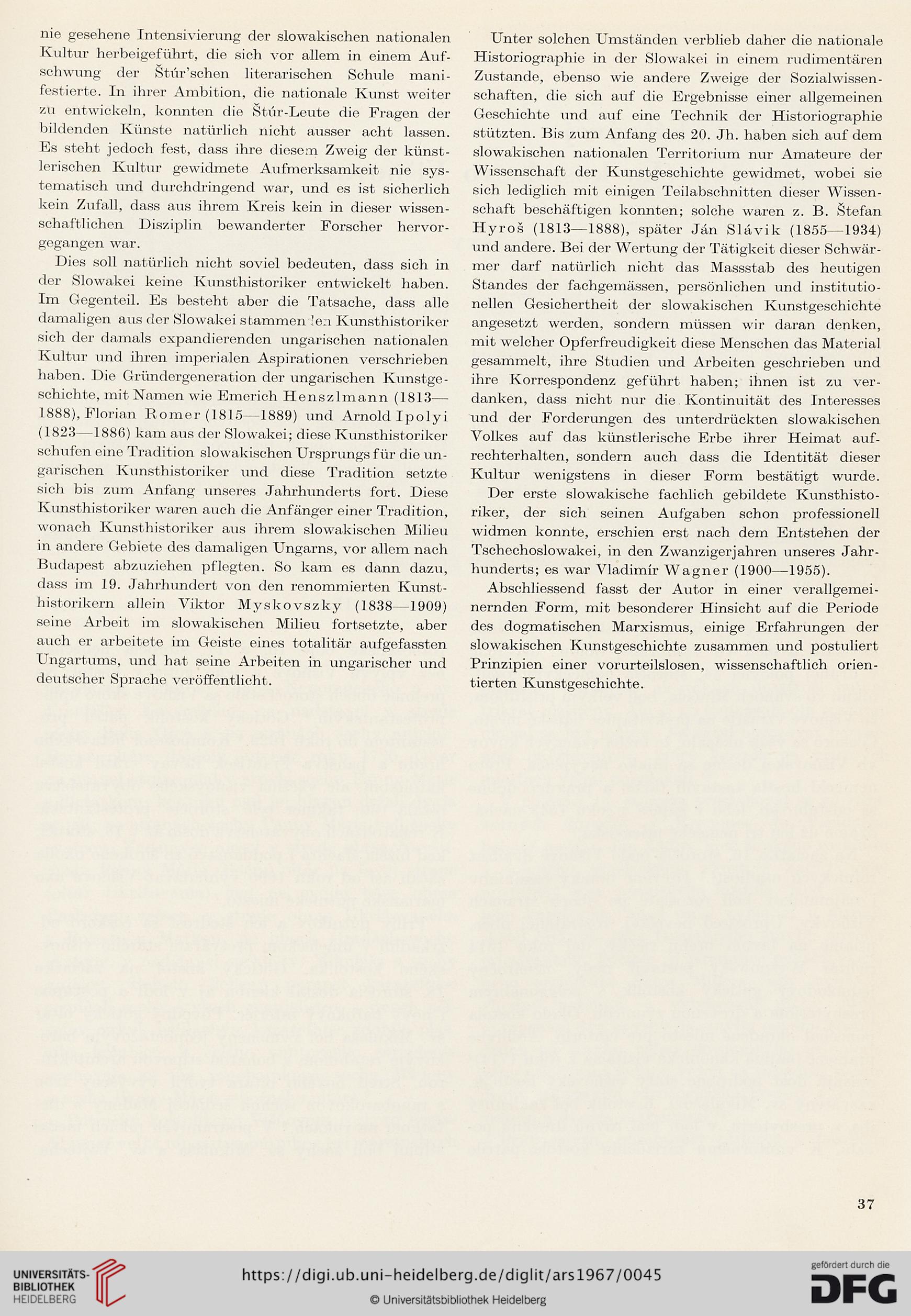nie gesehene Intensivierung der slowakischen nationalen
Kultur herbeigeführt, die sich vor allem in einem Auf-
schwung der Stür’schen literarischen Schule mani-
festierte. In ihrer Ambition, die nationale Kunst weiter
zu entwickeln, konnten die Stür-Leute die Fragen der
bildenden Künste natürlich nicht äusser acht lassen.
Es steht jedoch fest, dass ihre diesem Zweig der künst-
lerischen Kultur gewidmete Aufmerksamkeit nie sys-
tematisch und durchdringend war, und es ist sicherlich
kein Zufall, dass aus ihrem Kreis kein in dieser wissen-
schaftlichen Disziplin bewanderter Forscher hervor-
gegangen war.
Dies soll natürlich nicht soviel bedeuten, dass sich in
der Slowakei keine Kunsthistoriker entwickelt haben.
Im Gegenteil. Es besteht aber die Tatsache, dass alle
damaligen aus der Slowakei stammenden Kunsthistoriker
sich der damals expandierenden ungarischen nationalen
Kultur und ihren imperialen Aspirationen verschrieben
haben. Die Gründergeneration der ungarischen Kunstge-
schichte, mit Namen wie Emerich Henszlmann (1813—
1888), Florian Romer (1815—1889) und Arnold Ipolyi
(1823—1886) kam aus der Slowakei; diese Kunsthistoriker
schufen eine Tradition slowakischen Ursprungs für die un-
garischen Kunsthistoriker und diese Tradition setzte
sich bis zum Anfang unseres Jahrhunderts fort. Diese
Kunsthistoriker waren auch die Anfänger einer Tradition,
wonach Kunsthistoriker aus ihrem slowakischen Milieu
in andere Gebiete des damaligen Ungarns, vor allem nach
Budapest abzuziehen pflegten. So kam es dann dazu,
dass im 19. Jahrhundert von den renommierten Kunst-
historikern allein Viktor Myskovszky (1838—1909)
seine Arbeit im slowakischen Milieu fortsetzte, aber
auch er arbeitete im Geiste eines totalitär aufgefassten
Ungartums, und hat seine Arbeiten in ungarischer und
deutscher Sprache veröffentlicht.
Unter solchen Umständen verblieb daher die nationale
Historiographie in der Slowakei in einem rudimentären
Zustande, ebenso wie andere Zweige der Sozialwissen-
schaften, die sich auf die Ergebnisse einer allgemeinen
Geschichte und auf eine Technik der Historiographie
stützten. Bis zum Anfang des 20. Jh. haben sich auf dem
slowakischen nationalen Territorium nur Amateure der
Wissenschaft der Kunstgeschichte gewidmet, wobei sie
sich lediglich mit einigen Teilabschnitten dieser Wissen-
schaft beschäftigen konnten; solche waren z. B. Stefan
Hyroš (1813—1888), später Ján Slavik (1855—1934)
und andere. Bei der Wertung der Tätigkeit dieser Schwär-
mer darf natürlich nicht das Massstab des heutigen
Standes der fachgemässen, persönlichen und institutio-
nellen Gesichertheit der slowakischen Kunstgeschichte
angesetzt werden, sondern müssen wir daran denken,
mit welcher Opferfreudigkeit diese Menschen das Material
gesammelt, ihre Studien und Arbeiten geschrieben und
ihre Korrespondenz geführt haben; ihnen ist zu ver-
danken, dass nicht nur die Kontinuität des Interesses
und der Forderungen des unterdrückten slowakischen
Volkes auf das künstlerische Erbe ihrer Heimat auf-
rechterhalten, sondern auch dass die Identität dieser
Kultur wenigstens in dieser Form bestätigt wurde.
Der erste slowakische fachlich gebildete Kunsthisto-
riker, der sich seinen Aufgaben schon professionell
widmen konnte, erschien erst nach dem Entstehen der
Tschechoslowakei, in den Zwanziger jähren unseres Jahr-
hunderts; es war Vladimir Wagner (1900—1955).
Abschliessend fasst der Autor in einer verallgemei-
nernden Form, mit besonderer Hinsicht auf die Periode
des dogmatischen Marxismus, einige Erfahrungen der
slowakischen Kunstgeschichte zusammen und postuliert
Prinzipien einer vorurteilslosen, wissenschaftlich orien-
tierten Kunstgeschichte.
37
Kultur herbeigeführt, die sich vor allem in einem Auf-
schwung der Stür’schen literarischen Schule mani-
festierte. In ihrer Ambition, die nationale Kunst weiter
zu entwickeln, konnten die Stür-Leute die Fragen der
bildenden Künste natürlich nicht äusser acht lassen.
Es steht jedoch fest, dass ihre diesem Zweig der künst-
lerischen Kultur gewidmete Aufmerksamkeit nie sys-
tematisch und durchdringend war, und es ist sicherlich
kein Zufall, dass aus ihrem Kreis kein in dieser wissen-
schaftlichen Disziplin bewanderter Forscher hervor-
gegangen war.
Dies soll natürlich nicht soviel bedeuten, dass sich in
der Slowakei keine Kunsthistoriker entwickelt haben.
Im Gegenteil. Es besteht aber die Tatsache, dass alle
damaligen aus der Slowakei stammenden Kunsthistoriker
sich der damals expandierenden ungarischen nationalen
Kultur und ihren imperialen Aspirationen verschrieben
haben. Die Gründergeneration der ungarischen Kunstge-
schichte, mit Namen wie Emerich Henszlmann (1813—
1888), Florian Romer (1815—1889) und Arnold Ipolyi
(1823—1886) kam aus der Slowakei; diese Kunsthistoriker
schufen eine Tradition slowakischen Ursprungs für die un-
garischen Kunsthistoriker und diese Tradition setzte
sich bis zum Anfang unseres Jahrhunderts fort. Diese
Kunsthistoriker waren auch die Anfänger einer Tradition,
wonach Kunsthistoriker aus ihrem slowakischen Milieu
in andere Gebiete des damaligen Ungarns, vor allem nach
Budapest abzuziehen pflegten. So kam es dann dazu,
dass im 19. Jahrhundert von den renommierten Kunst-
historikern allein Viktor Myskovszky (1838—1909)
seine Arbeit im slowakischen Milieu fortsetzte, aber
auch er arbeitete im Geiste eines totalitär aufgefassten
Ungartums, und hat seine Arbeiten in ungarischer und
deutscher Sprache veröffentlicht.
Unter solchen Umständen verblieb daher die nationale
Historiographie in der Slowakei in einem rudimentären
Zustande, ebenso wie andere Zweige der Sozialwissen-
schaften, die sich auf die Ergebnisse einer allgemeinen
Geschichte und auf eine Technik der Historiographie
stützten. Bis zum Anfang des 20. Jh. haben sich auf dem
slowakischen nationalen Territorium nur Amateure der
Wissenschaft der Kunstgeschichte gewidmet, wobei sie
sich lediglich mit einigen Teilabschnitten dieser Wissen-
schaft beschäftigen konnten; solche waren z. B. Stefan
Hyroš (1813—1888), später Ján Slavik (1855—1934)
und andere. Bei der Wertung der Tätigkeit dieser Schwär-
mer darf natürlich nicht das Massstab des heutigen
Standes der fachgemässen, persönlichen und institutio-
nellen Gesichertheit der slowakischen Kunstgeschichte
angesetzt werden, sondern müssen wir daran denken,
mit welcher Opferfreudigkeit diese Menschen das Material
gesammelt, ihre Studien und Arbeiten geschrieben und
ihre Korrespondenz geführt haben; ihnen ist zu ver-
danken, dass nicht nur die Kontinuität des Interesses
und der Forderungen des unterdrückten slowakischen
Volkes auf das künstlerische Erbe ihrer Heimat auf-
rechterhalten, sondern auch dass die Identität dieser
Kultur wenigstens in dieser Form bestätigt wurde.
Der erste slowakische fachlich gebildete Kunsthisto-
riker, der sich seinen Aufgaben schon professionell
widmen konnte, erschien erst nach dem Entstehen der
Tschechoslowakei, in den Zwanziger jähren unseres Jahr-
hunderts; es war Vladimir Wagner (1900—1955).
Abschliessend fasst der Autor in einer verallgemei-
nernden Form, mit besonderer Hinsicht auf die Periode
des dogmatischen Marxismus, einige Erfahrungen der
slowakischen Kunstgeschichte zusammen und postuliert
Prinzipien einer vorurteilslosen, wissenschaftlich orien-
tierten Kunstgeschichte.
37