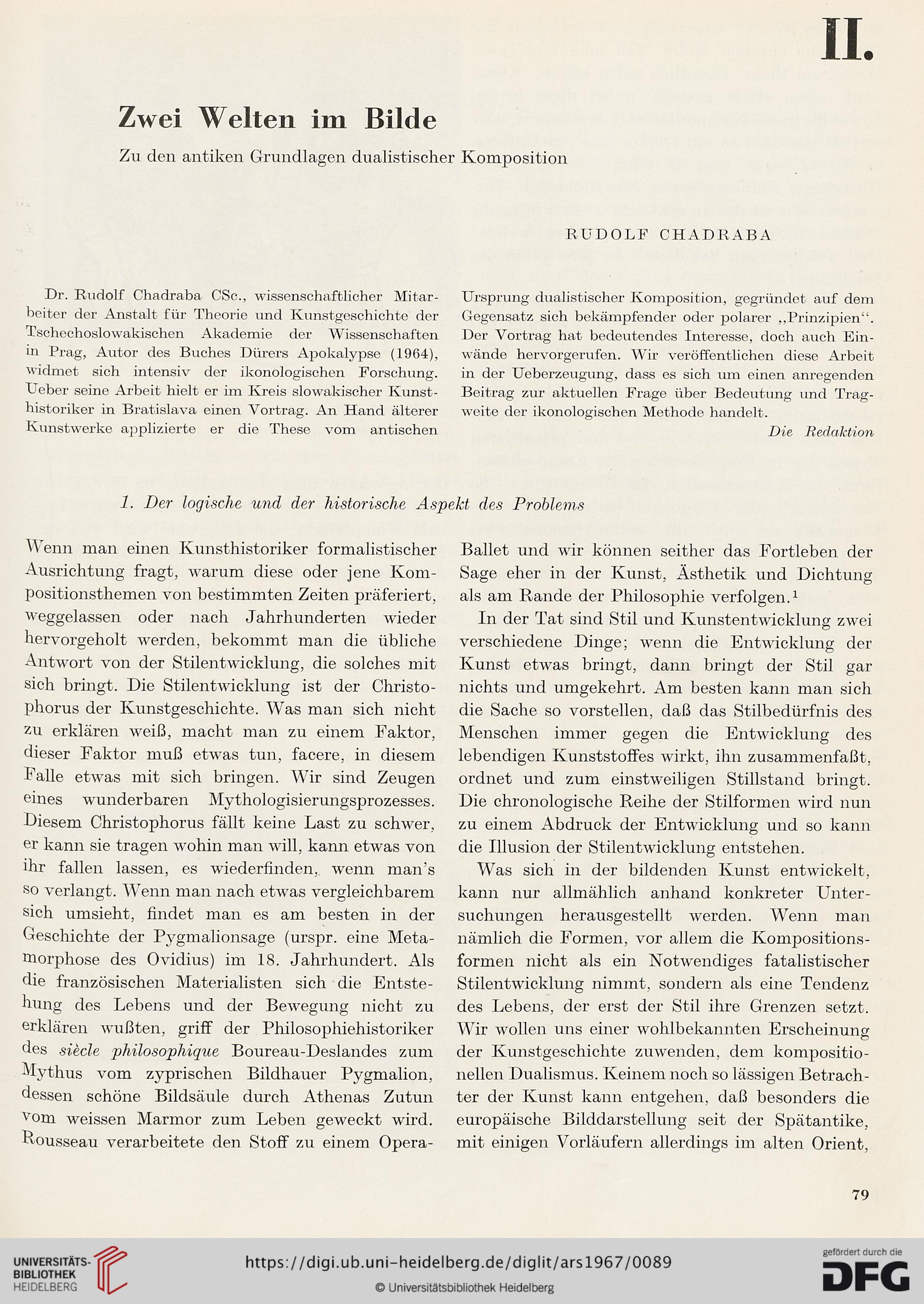Il
Zwei Welten im Bilde
Zu den antiken Grundlagen dualistischer Komposition
RUDOLF CHADRABA
Dr. Rudolf Chadraba CSc., wissenschaftlicher Mitar-
beiter der Anstalt für Theorie und Kunstgeschichte der
Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften
in Prag, Autor des Buches Dürers Apokalypse (1964),
widmet sich intensiv der ikonologischen Forschung.
Ueber seine Arbeit hielt er im Kreis slowakischer Kunst-
historiker in Bratislava einen Vortrag. An Hand älterer
Kunstwerke applizierte er die These vom antischen
Ursprung dualistischer Komposition, gegründet auf dem
Gegensatz sich bekämpfender oder polarer „Prinzipien“.
Der Vortrag hat bedeutendes Interesse, doch auch Ein-
wände hervorgerufen. Wir veröffentlichen diese Arbeit
in der Ueberzeugung, dass es sich um einen anregenden
Beitrag zur aktuellen Frage über Bedeutung und Trag-
weite der ikonologischen Methode handelt.
Die Redaktion
1. Der logische und der historische Aspekt des Problems
Wenn man einen Kunsthistoriker formalistischer
Ausrichtung fragt, warum diese oder jene Kom-
positionsthemen von bestimmten Zeiten präferiert,
weggelassen oder nach Jahrhunderten wieder
hervorgeholt werden, bekommt man die übliche
Antwort von der Stilentwicklung, die solches mit
sich bringt. Die Stilentwicklung ist der Christo-
phorus der Kunstgeschichte. Was man sich nicht
zu erklären weiß, macht man zu einem Faktor,
dieser Faktor muß etwas tun, facere, in diesem
Falle etwas mit sich bringen. Wir sind Zeugen
eines wunderbaren Mythologisierungsprozesses.
Diesem Christophorus fällt keine Last zu schwer,
er kann sie tragen wohin man will, kann etwas von
ihr fallen lassen, es wiederfinden,, wenn man’s
so verlangt. Wenn man nach etwas vergleichbarem
sich umsieht, findet man es am besten in der
Geschichte der Pygmalionsage (urspr. eine Meta-
morphose des Ovidius) im 18. Jahrhundert. Als
die französischen Materialisten sich die Entste-
hung des Lebens und der Bewegung nicht zu
erklären wußten, griff der Philosophiehistoriker
des siècle philosophique Boureau-Deslandes zum
Mythus vom zyprischen Bildhauer Pygmalion,
dessen schöne Bildsäule durch Athenas Zutun
vom weissen Marmor zum Leben geweckt wird.
Rousseau verarbeitete den Stoff zu einem Opera-
Ballet und wir können seither das Fortleben der
Sage eher in der Kunst, Ästhetik und Dichtung
als am Rande der Philosophie verfolgen.1
In der Tat sind Stil und Kunstentwicklung zwei
verschiedene Dinge; wenn die Entwicklung der
Kunst etwas bringt, dann bringt der Stil gar
nichts und umgekehrt. Am besten kann man sich
die Sache so vorstellen, daß das Stilbedürfnis des
Menschen immer gegen die Entwicklung des
lebendigen Kunststoffes wirkt, ihn zusammenfaßt,
ordnet und zum einstweiligen Stillstand bringt.
Die chronologische Reihe der Stilformen wird nun
zu einem Abdruck der Entwicklung und so kann
die Illusion der Stilentwicklung entstehen.
Was sich in der bildenden Kunst entwickelt,
kann nur allmählich anhand konkreter Unter-
suchungen herausgestellt werden. Wenn man
nämlich die Formen, vor allem die Kompositions-
formen nicht als ein Notwendiges fatalistischer
Stilentwicklung nimmt, sondern als eine Tendenz
des Lebens, der erst der Stil ihre Grenzen setzt.
Wir wollen uns einer wohlbekannten Erscheinung
der Kunstgeschichte zuwenden, dem kompositio-
nellen Dualismus. Keinem noch so lässigen Betrach-
ter der Kunst kann entgehen, daß besonders die
europäische Bilddarstellung seit der Spätantike,
mit einigen Vorläufern allerdings im alten Orient,
79
Zwei Welten im Bilde
Zu den antiken Grundlagen dualistischer Komposition
RUDOLF CHADRABA
Dr. Rudolf Chadraba CSc., wissenschaftlicher Mitar-
beiter der Anstalt für Theorie und Kunstgeschichte der
Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften
in Prag, Autor des Buches Dürers Apokalypse (1964),
widmet sich intensiv der ikonologischen Forschung.
Ueber seine Arbeit hielt er im Kreis slowakischer Kunst-
historiker in Bratislava einen Vortrag. An Hand älterer
Kunstwerke applizierte er die These vom antischen
Ursprung dualistischer Komposition, gegründet auf dem
Gegensatz sich bekämpfender oder polarer „Prinzipien“.
Der Vortrag hat bedeutendes Interesse, doch auch Ein-
wände hervorgerufen. Wir veröffentlichen diese Arbeit
in der Ueberzeugung, dass es sich um einen anregenden
Beitrag zur aktuellen Frage über Bedeutung und Trag-
weite der ikonologischen Methode handelt.
Die Redaktion
1. Der logische und der historische Aspekt des Problems
Wenn man einen Kunsthistoriker formalistischer
Ausrichtung fragt, warum diese oder jene Kom-
positionsthemen von bestimmten Zeiten präferiert,
weggelassen oder nach Jahrhunderten wieder
hervorgeholt werden, bekommt man die übliche
Antwort von der Stilentwicklung, die solches mit
sich bringt. Die Stilentwicklung ist der Christo-
phorus der Kunstgeschichte. Was man sich nicht
zu erklären weiß, macht man zu einem Faktor,
dieser Faktor muß etwas tun, facere, in diesem
Falle etwas mit sich bringen. Wir sind Zeugen
eines wunderbaren Mythologisierungsprozesses.
Diesem Christophorus fällt keine Last zu schwer,
er kann sie tragen wohin man will, kann etwas von
ihr fallen lassen, es wiederfinden,, wenn man’s
so verlangt. Wenn man nach etwas vergleichbarem
sich umsieht, findet man es am besten in der
Geschichte der Pygmalionsage (urspr. eine Meta-
morphose des Ovidius) im 18. Jahrhundert. Als
die französischen Materialisten sich die Entste-
hung des Lebens und der Bewegung nicht zu
erklären wußten, griff der Philosophiehistoriker
des siècle philosophique Boureau-Deslandes zum
Mythus vom zyprischen Bildhauer Pygmalion,
dessen schöne Bildsäule durch Athenas Zutun
vom weissen Marmor zum Leben geweckt wird.
Rousseau verarbeitete den Stoff zu einem Opera-
Ballet und wir können seither das Fortleben der
Sage eher in der Kunst, Ästhetik und Dichtung
als am Rande der Philosophie verfolgen.1
In der Tat sind Stil und Kunstentwicklung zwei
verschiedene Dinge; wenn die Entwicklung der
Kunst etwas bringt, dann bringt der Stil gar
nichts und umgekehrt. Am besten kann man sich
die Sache so vorstellen, daß das Stilbedürfnis des
Menschen immer gegen die Entwicklung des
lebendigen Kunststoffes wirkt, ihn zusammenfaßt,
ordnet und zum einstweiligen Stillstand bringt.
Die chronologische Reihe der Stilformen wird nun
zu einem Abdruck der Entwicklung und so kann
die Illusion der Stilentwicklung entstehen.
Was sich in der bildenden Kunst entwickelt,
kann nur allmählich anhand konkreter Unter-
suchungen herausgestellt werden. Wenn man
nämlich die Formen, vor allem die Kompositions-
formen nicht als ein Notwendiges fatalistischer
Stilentwicklung nimmt, sondern als eine Tendenz
des Lebens, der erst der Stil ihre Grenzen setzt.
Wir wollen uns einer wohlbekannten Erscheinung
der Kunstgeschichte zuwenden, dem kompositio-
nellen Dualismus. Keinem noch so lässigen Betrach-
ter der Kunst kann entgehen, daß besonders die
europäische Bilddarstellung seit der Spätantike,
mit einigen Vorläufern allerdings im alten Orient,
79