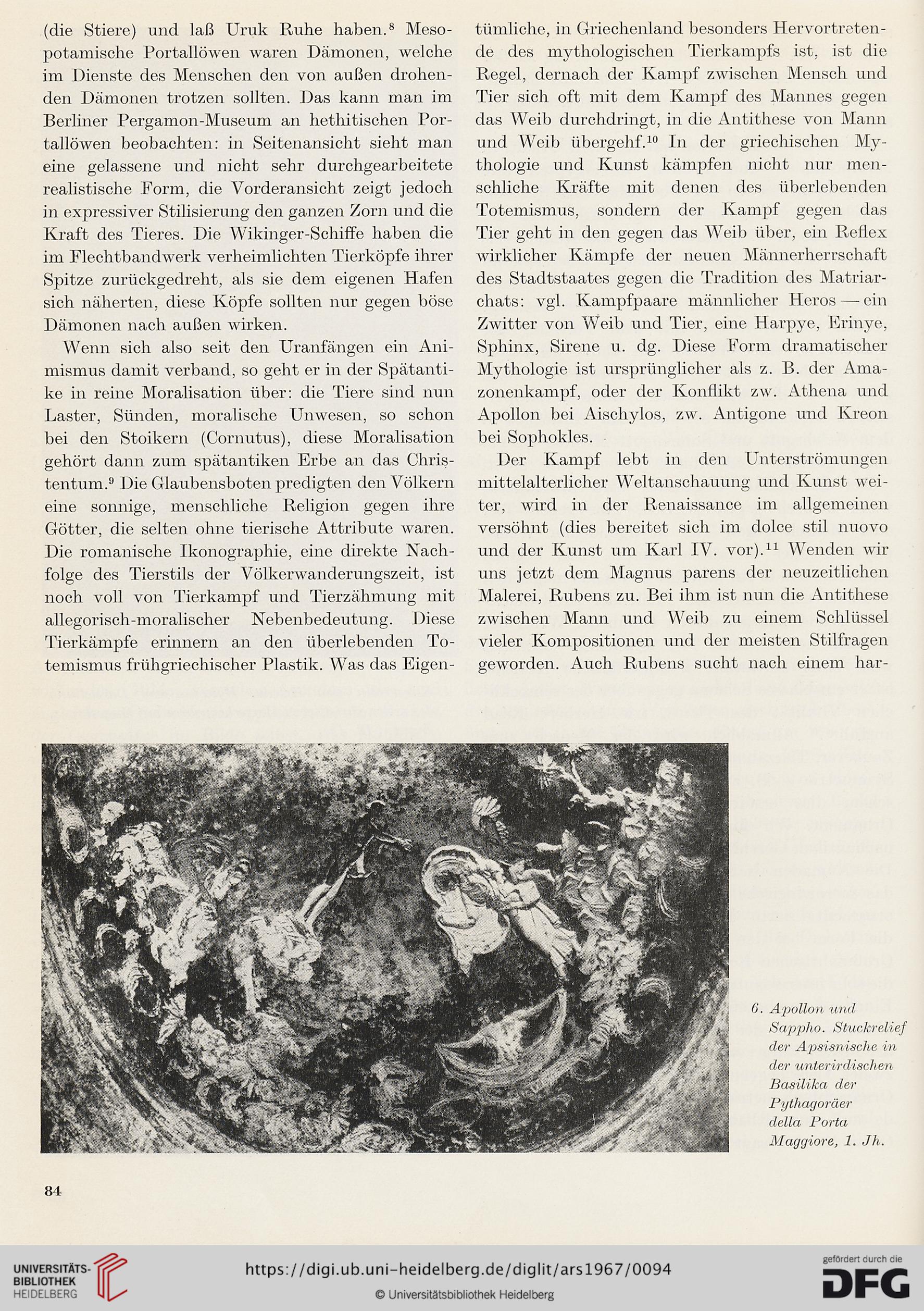(die Stiere) und laß Uruk Ruhe haben.8 Meso-
potamische Portallöwen waren Dämonen, welche
im Dienste des Menschen den von außen drohen-
den Dämonen trotzen sollten. Das kann man im
Berliner Pergamon-Museum an hethitischen Por-
tallöwen beobachten: in Seitenansicht sieht man
eine gelassene und nicht sehr durchgearbeitete
realistische Form, die Vorderansicht zeigt jedoch
in expressiver Stilisierung den ganzen Zorn und die
Kraft des Tieres. Die Wikinger-Schiffe haben die
im Flechtbandwerk verheimlichten Tierköpfe ihrer
Spitze zurückgedreht, als sie dem eigenen Hafen
sich näherten, diese Köpfe sollten nur gegen böse
Dämonen nach außen wirken.
Wenn sich also seit den Uranfängen ein Ani-
mismus damit verband, so geht er in der Spätanti-
ke in reine Moralisation über: die Tiere sind nun
Laster, Sünden, moralische Unwesen, so schon
bei den Stoikern (Cornutus), diese Moralisation
gehört dann zum spätantiken Erbe an das Chris-
tentum.9 Die Glaubensboten predigten den Völkern
eine sonnige, menschliche Religion gegen ihre
Götter, die selten ohne tierische Attribute waren.
Die romanische Ikonographie, eine direkte Nach-
folge des Tierstils der Völkerwanderungszeit, ist
noch voll von Tierkampf und Tierzähmung mit
allegorisch-moralischer Nebenbedeutung. Diese
Tierkämpfe erinnern an den überlebenden To-
temismus frühgriechischer Plastik. Was das Eigen-
tümliche, in Griechenland besonders Hervortreten-
de des mythologischen Tierkampfs ist, ist die
Regel, dernach der Kampf zwischen Mensch und
Tier sich oft mit dem Kampf des Mannes gegen
das Weib durchdringt, in die Antithese von Mann
und Weib übergehf.10 In der griechischen My-
thologie und Kunst kämpfen nicht nur men-
schliche Kräfte mit denen des überlebenden
Totemismus, sondern der Kampf gegen das
Tier geht in den gegen das Weib über, ein Reflex
wirklicher Kämpfe der neuen Männerherrschaft
des Stadtstaates gegen die Tradition des Matriar-
chats: vgl. Kampfpaare männlicher Heros — ein
Zwitter von Weib und Tier, eine Harpye, Erinye,
Sphinx, Sirene u. dg. Diese Form dramatischer
Mythologie ist ursprünglicher als z. B. der Ama-
zonenkampf, oder der Konflikt zw. Athena und
Apollon bei Aischylos, zw. Antigone und Kreon
bei Sophokles.
Der Kampf lebt in den Unterströmungen
mittelalterlicher Weltanschauung und Kunst wei-
ter, wird in der Renaissance im allgemeinen
versöhnt (dies bereitet sich im dolce stil nuovo
und der Kunst um Karl IV. vor).11 Wenden wir
uns jetzt dem Magnus parens der neuzeitlichen
Malerei, Rubens zu. Bei ihm ist nun die Antithese
zwischen Mann und Weib zu einem Schlüssel
vieler Kompositionen und der meisten Stilfragen
geworden. Auch Rubens sucht nach einem har-
6. Apollon und
Sappho. Stuckrelief
der Apsisnische in
der unterirdischen
Basilika der
Pythagoräer
della Porta
Maggiore, 1. Jh.
84
potamische Portallöwen waren Dämonen, welche
im Dienste des Menschen den von außen drohen-
den Dämonen trotzen sollten. Das kann man im
Berliner Pergamon-Museum an hethitischen Por-
tallöwen beobachten: in Seitenansicht sieht man
eine gelassene und nicht sehr durchgearbeitete
realistische Form, die Vorderansicht zeigt jedoch
in expressiver Stilisierung den ganzen Zorn und die
Kraft des Tieres. Die Wikinger-Schiffe haben die
im Flechtbandwerk verheimlichten Tierköpfe ihrer
Spitze zurückgedreht, als sie dem eigenen Hafen
sich näherten, diese Köpfe sollten nur gegen böse
Dämonen nach außen wirken.
Wenn sich also seit den Uranfängen ein Ani-
mismus damit verband, so geht er in der Spätanti-
ke in reine Moralisation über: die Tiere sind nun
Laster, Sünden, moralische Unwesen, so schon
bei den Stoikern (Cornutus), diese Moralisation
gehört dann zum spätantiken Erbe an das Chris-
tentum.9 Die Glaubensboten predigten den Völkern
eine sonnige, menschliche Religion gegen ihre
Götter, die selten ohne tierische Attribute waren.
Die romanische Ikonographie, eine direkte Nach-
folge des Tierstils der Völkerwanderungszeit, ist
noch voll von Tierkampf und Tierzähmung mit
allegorisch-moralischer Nebenbedeutung. Diese
Tierkämpfe erinnern an den überlebenden To-
temismus frühgriechischer Plastik. Was das Eigen-
tümliche, in Griechenland besonders Hervortreten-
de des mythologischen Tierkampfs ist, ist die
Regel, dernach der Kampf zwischen Mensch und
Tier sich oft mit dem Kampf des Mannes gegen
das Weib durchdringt, in die Antithese von Mann
und Weib übergehf.10 In der griechischen My-
thologie und Kunst kämpfen nicht nur men-
schliche Kräfte mit denen des überlebenden
Totemismus, sondern der Kampf gegen das
Tier geht in den gegen das Weib über, ein Reflex
wirklicher Kämpfe der neuen Männerherrschaft
des Stadtstaates gegen die Tradition des Matriar-
chats: vgl. Kampfpaare männlicher Heros — ein
Zwitter von Weib und Tier, eine Harpye, Erinye,
Sphinx, Sirene u. dg. Diese Form dramatischer
Mythologie ist ursprünglicher als z. B. der Ama-
zonenkampf, oder der Konflikt zw. Athena und
Apollon bei Aischylos, zw. Antigone und Kreon
bei Sophokles.
Der Kampf lebt in den Unterströmungen
mittelalterlicher Weltanschauung und Kunst wei-
ter, wird in der Renaissance im allgemeinen
versöhnt (dies bereitet sich im dolce stil nuovo
und der Kunst um Karl IV. vor).11 Wenden wir
uns jetzt dem Magnus parens der neuzeitlichen
Malerei, Rubens zu. Bei ihm ist nun die Antithese
zwischen Mann und Weib zu einem Schlüssel
vieler Kompositionen und der meisten Stilfragen
geworden. Auch Rubens sucht nach einem har-
6. Apollon und
Sappho. Stuckrelief
der Apsisnische in
der unterirdischen
Basilika der
Pythagoräer
della Porta
Maggiore, 1. Jh.
84