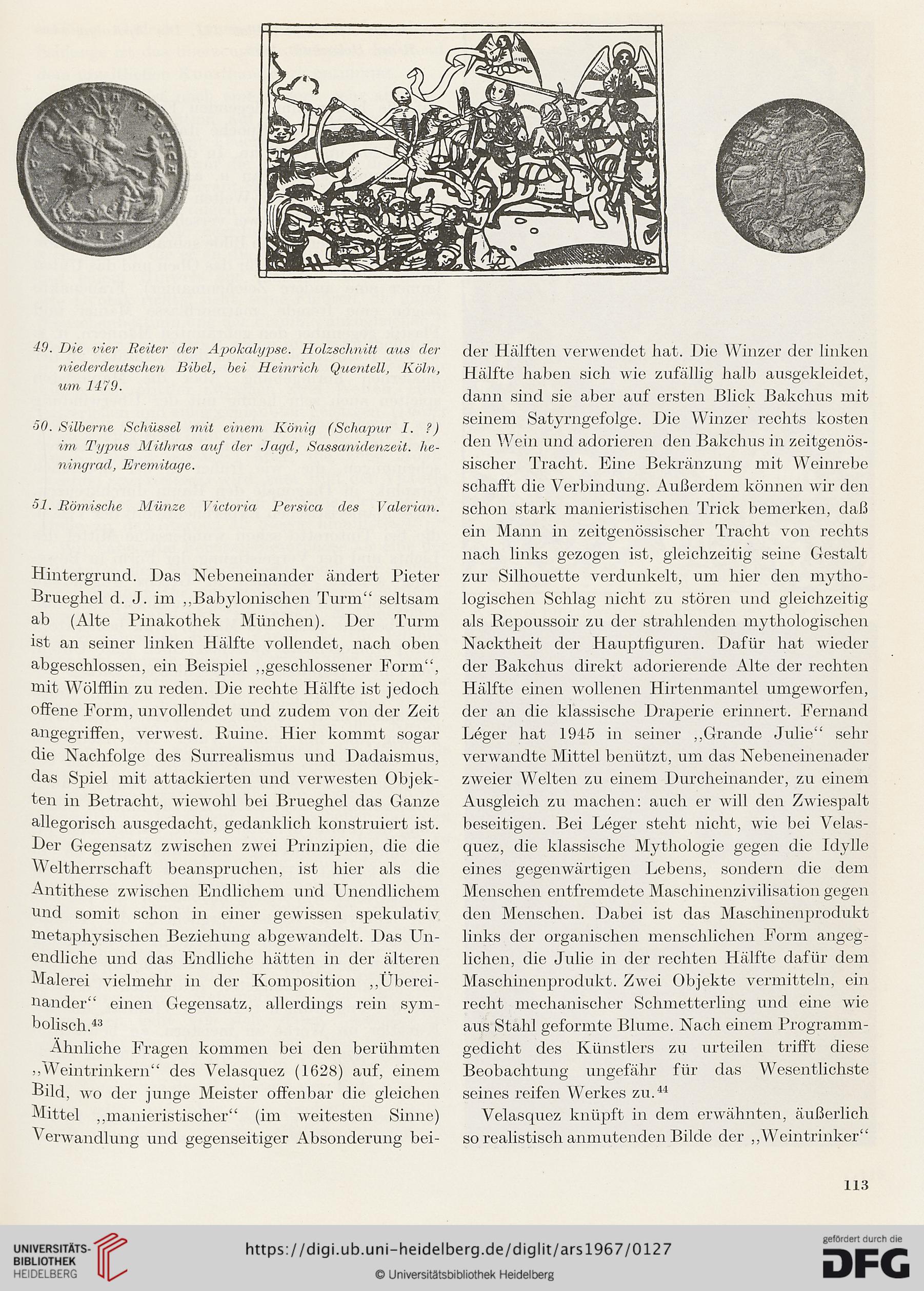49. Die vier Reiter der Apokalypse. Holzschnitt aus der
niederdeutschen Bibel, bei Heinrich Quentell, Köln,
um 1479.
50. Silberne Schüssel mit einem König (Schapur I. ?)
im Typus Mithras auf der Jagd, Sassanidenzeit. he-
ningrad, Eremitage.
51. Römische Münze Victoria Persica des Valerian.
Hintergrund. Das Nebeneinander ändert Pieter
Brueghel d. J. im „Babylonischen Turm“ seltsam
ab (Alte Pinakothek München). Der Turm
ist an seiner linken Hälfte vollendet, nach oben
abgeschlossen, ein Beispiel „geschlossener Form“,
mit Wölfflin zu reden. Die rechte Hälfte ist jedoch
offene Form, unvollendet und zudem von der Zeit
angegriffen, verwest. Ruine. Hier kommt sogar
die Nachfolge des Surrealismus und Dadaismus,
das Spiel mit attackierten und verwesten Objek-
ten in Betracht, wiewohl bei Brueghel das Ganze
allegorisch ausgedacht, gedanklich konstruiert ist.
Der Gegensatz zwischen zwei Prinzipien, die die
Weltherrschaft beanspruchen, ist hier als die
Antithese zwischen Endlichem und Unendlichem
und somit schon in einer gewissen spekulativ
metaphysischen Beziehung abgewandelt. Das Un-
endliche und das Endliche hätten in der älteren
Malerei vielmehr in der Komposition „Überei-
nander“ einen Gegensatz, allerdings rein sym-
bolisch.43
Ähnliche Fragen kommen bei den berühmten
» Weintrinkern“ des Velasquez (1628) auf, einem
Bild, wo der junge Meister offenbar die gleichen
Mittel „manieristischer“ (im weitesten Sinne)
Verwandlung und gegenseitiger Absonderung bei-
der Hälften verwendet hat. Die Winzer der linken
Hälfte haben sich wie zufällig halb ausgekleidet,
dann sind sie aber auf ersten Blick Bakchus mit
seinem Satyrngefolge. Die Winzer rechts kosten
den Wein und adorieren den Bakchus in zeitgenös-
sischer Tracht. Eine Bekränzung mit Weinrebe
schafft die Verbindung. Außerdem können wir den
schon stark manieristischen Trick bemerken, daß
ein Mann in zeitgenössischer Tracht von rechts
nach links gezogen ist, gleichzeitig seine Gestalt
zur Silhouette verdunkelt, um hier den mytho-
logischen Schlag nicht zu stören und gleichzeitig
als Repoussoir zu der strahlenden mythologischen
Nacktheit der Hauptfiguren. Dafür hat wieder
der Bakchus direkt adorierende Alte der rechten
Hälfte einen wollenen Hirtenmantel umgeworfen,
der an die klassische Draperie erinnert. Fernand
Léger hat 1945 in seiner „Grande Julie“ sehr
verwandte Mittel benützt, um das Nebeneinenader
zweier Welten zu einem Durcheinander, zu einem
Ausgleich zu machen: auch er will den Zwiespalt
beseitigen. Bei Léger steht nicht, wie bei Velas-
quez, die klassische Mythologie gegen die Idylle
eines gegenwärtigen Lebens, sondern die dem
Menschen entfremdete Maschinenzivilisation gegen
den Menschen. Dabei ist das Maschinenprodukt
links der organischen menschlichen Form angeg-
lichen, die Julie in der rechten Hälfte dafür dem
Maschinenprodukt. Zwei Objekte vermitteln, ein
recht mechanischer Schmetterling und eine wie
aus Stahl geformte Blume. Nach einem Programm-
gedicht des Künstlers zu urteilen trifft diese
Beobachtung ungefähr für das Wesentlichste
seines reifen Werkes zu.44
Velasquez knüpft in dem erwähnten, äußerlich
so realistisch anmutenden Bilde der „Weintrinker“
113