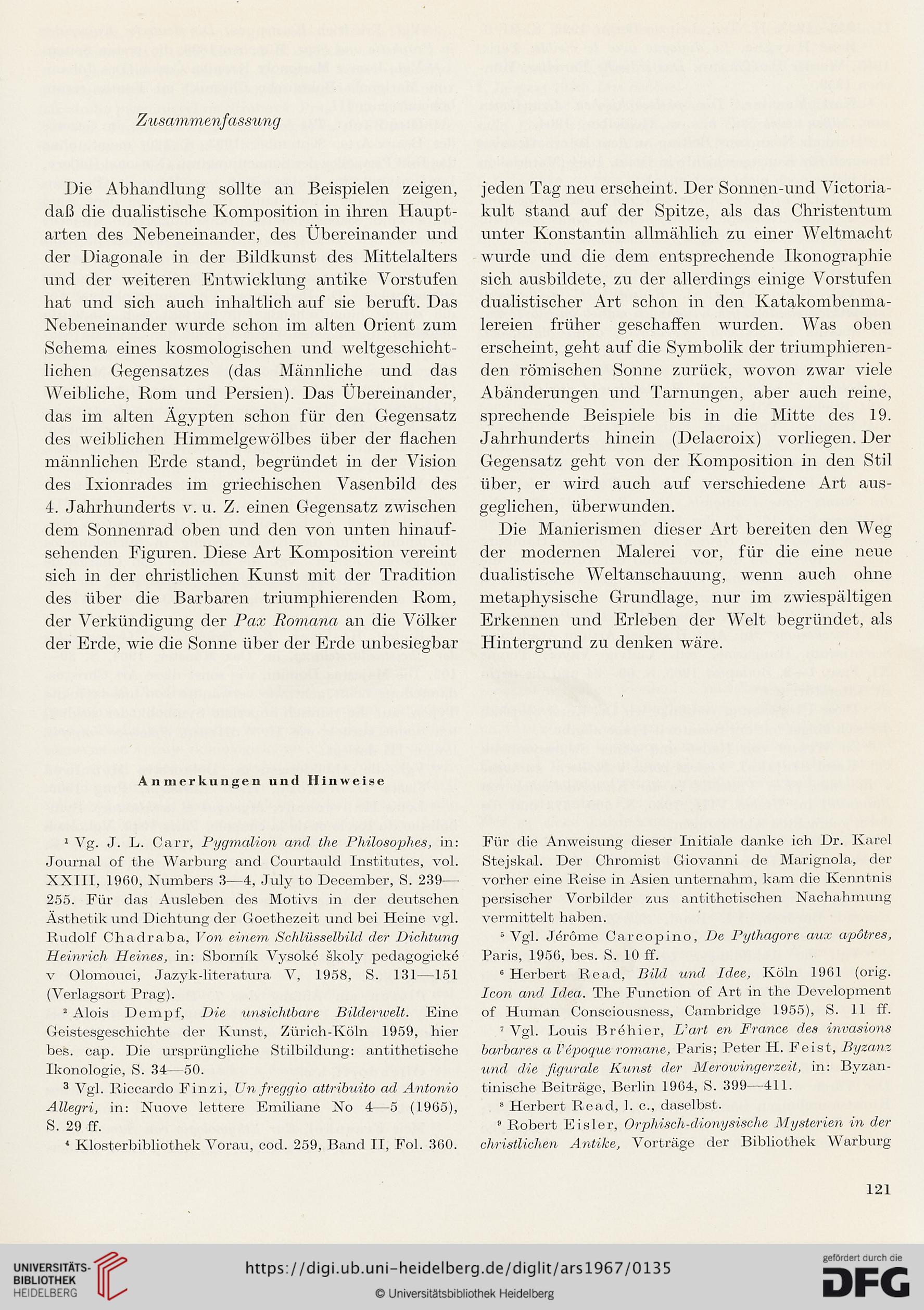Zusammenfassung
Die Abhandlung sollte an Beispielen zeigen,
daß die dualistische Komposition in ihren Haupt-
arten des Nebeneinander, des Übereinander und
der Diagonale in der Bildkunst des Mittelalters
und der weiteren Entwicklung antike Vorstufen
hat und sich auch inhaltlich auf sie beruft. Das
Nebeneinander wurde schon im alten Orient zum
Schema eines kosmologischen und weltgeschicht-
lichen Gegensatzes (das Männliche und das
Weibliche, Rom und Persien). Das Übereinander,
das im alten Ägypten schon für den Gegensatz
des weiblichen Himmelgewölbes über der flachen
männlichen Erde stand, begründet in der Vision
des Ixionrades im griechischen Vasenbild des
4. Jahrhunderts v. u. Z. einen Gegensatz zwischen
dem Sonnenrad oben und den von unten hinauf-
sehenden Figuren. Diese Art Komposition vereint
sich in der christlichen Kunst mit der Tradition
des über die Barbaren triumphierenden Rom,
der Verkündigung der Pax Romana an die Völker
der Erde, wie die Sonne über der Erde unbesiegbar
jeden Tag neu erscheint. Der Sonnen-und Victoria-
kult stand auf der Spitze, als das Christentum
unter Konstantin allmählich zu einer Weltmacht
wurde und die dem entsprechende Ikonographie
sich ausbildete, zu der allerdings einige Vorstufen
dualistischer Art schon in den Katakombenma-
lereien früher geschaffen wurden. Was oben
erscheint, geht auf die Symbolik der triumphieren-
den römischen Sonne zurück, wovon zwar viele
Abänderungen und Tarnungen, aber auch reine,
sprechende Beispiele bis in die Mitte des 19.
Jahrhunderts hinein (Delacroix) vorliegen. Der
Gegensatz geht von der Komposition in den Stil
über, er wird auch auf verschiedene Art aus-
geglichen, überwunden.
Die Manierismen dieser Art bereiten den Weg
der modernen Malerei vor, für die eine neue
dualistische Weltanschauung, wenn auch ohne
metaphysische Grundlage, nur im zwiespältigen
Erkennen und Erleben der Welt begründet, als
Hintergrund zu denken wäre.
Anmerkungen und Hinweise
1 Vg. J. L. Carr, Pygmalion and the Philosophes, in:
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, vol.
XXIII, 1960, Numbers 3—4, July to December, S. 239—
255. Für das Ausleben des Motivs in der deutschen
Ästhetik und Dichtung der Goethezeit und bei Heine vgl.
Rudolf Chadraba, Von einem Schlüsselbild der Dichtung
Heinrich Heines, in: Sborník Vysoké školy pedagogické
v Olomouci, Jazyk-literatura V, 1958, S. 131—151
(Verlagsort Prag).
2 Alois Dempf, Die unsichtbare Bilderwelt. Eine
Geistesgeschichte der Kunst, Zürich-Köln 1959, hier
bes. cap. Die ursprüngliche Stilbildung: antithetische
Ikonologie, S. 34—50.
3 Vgl. Riccardo Finzi, ün freggio attribuito ad Antonio
Allegri, in: Nuove lettere Emiliane No 4—5 (1965),
S. 29 ff.
1 Klosterbibliothek Vorau, cod. 259, Band II, Fol. 360.
Für die Anweisung dieser Initiale danke ich Dr. Karel
Stejskal. Der Chromist Giovanni de Marignola, der
vorher eine Reise in Asien unternahm, kam die Kenntnis
persischer Vorbilder zus antithetischen Nachahmung
vermittelt haben.
5 Vgl. Jérôme Carcopino, De Pythagore aux apôtres,
Paris, 1956, bes. S. 10 ff.
0 Herbert Read, Bild und Idee, Köln 1961 (orig.
Icon and Idea. The Function of Art in the Development
of Human Consciousness, Cambridge 1955), S. 11 ff.
’ Vgl. Louis Bréhier, Hart en France des invasions
barbares a l'époque romane, Paris; Peter H. Feist, Byzanz
und die figurale Kunst der Merowingerzeit, in: Byzan-
tinische Beiträge, Berlin 1964, S. 399—411.
8 Herbert Read, 1. c., daselbst.
9 Robert Eisler, Orphisch-dionysische Mysterien in der
christlichen Antike, Vorträge der Bibliothek Warburg
121
Die Abhandlung sollte an Beispielen zeigen,
daß die dualistische Komposition in ihren Haupt-
arten des Nebeneinander, des Übereinander und
der Diagonale in der Bildkunst des Mittelalters
und der weiteren Entwicklung antike Vorstufen
hat und sich auch inhaltlich auf sie beruft. Das
Nebeneinander wurde schon im alten Orient zum
Schema eines kosmologischen und weltgeschicht-
lichen Gegensatzes (das Männliche und das
Weibliche, Rom und Persien). Das Übereinander,
das im alten Ägypten schon für den Gegensatz
des weiblichen Himmelgewölbes über der flachen
männlichen Erde stand, begründet in der Vision
des Ixionrades im griechischen Vasenbild des
4. Jahrhunderts v. u. Z. einen Gegensatz zwischen
dem Sonnenrad oben und den von unten hinauf-
sehenden Figuren. Diese Art Komposition vereint
sich in der christlichen Kunst mit der Tradition
des über die Barbaren triumphierenden Rom,
der Verkündigung der Pax Romana an die Völker
der Erde, wie die Sonne über der Erde unbesiegbar
jeden Tag neu erscheint. Der Sonnen-und Victoria-
kult stand auf der Spitze, als das Christentum
unter Konstantin allmählich zu einer Weltmacht
wurde und die dem entsprechende Ikonographie
sich ausbildete, zu der allerdings einige Vorstufen
dualistischer Art schon in den Katakombenma-
lereien früher geschaffen wurden. Was oben
erscheint, geht auf die Symbolik der triumphieren-
den römischen Sonne zurück, wovon zwar viele
Abänderungen und Tarnungen, aber auch reine,
sprechende Beispiele bis in die Mitte des 19.
Jahrhunderts hinein (Delacroix) vorliegen. Der
Gegensatz geht von der Komposition in den Stil
über, er wird auch auf verschiedene Art aus-
geglichen, überwunden.
Die Manierismen dieser Art bereiten den Weg
der modernen Malerei vor, für die eine neue
dualistische Weltanschauung, wenn auch ohne
metaphysische Grundlage, nur im zwiespältigen
Erkennen und Erleben der Welt begründet, als
Hintergrund zu denken wäre.
Anmerkungen und Hinweise
1 Vg. J. L. Carr, Pygmalion and the Philosophes, in:
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, vol.
XXIII, 1960, Numbers 3—4, July to December, S. 239—
255. Für das Ausleben des Motivs in der deutschen
Ästhetik und Dichtung der Goethezeit und bei Heine vgl.
Rudolf Chadraba, Von einem Schlüsselbild der Dichtung
Heinrich Heines, in: Sborník Vysoké školy pedagogické
v Olomouci, Jazyk-literatura V, 1958, S. 131—151
(Verlagsort Prag).
2 Alois Dempf, Die unsichtbare Bilderwelt. Eine
Geistesgeschichte der Kunst, Zürich-Köln 1959, hier
bes. cap. Die ursprüngliche Stilbildung: antithetische
Ikonologie, S. 34—50.
3 Vgl. Riccardo Finzi, ün freggio attribuito ad Antonio
Allegri, in: Nuove lettere Emiliane No 4—5 (1965),
S. 29 ff.
1 Klosterbibliothek Vorau, cod. 259, Band II, Fol. 360.
Für die Anweisung dieser Initiale danke ich Dr. Karel
Stejskal. Der Chromist Giovanni de Marignola, der
vorher eine Reise in Asien unternahm, kam die Kenntnis
persischer Vorbilder zus antithetischen Nachahmung
vermittelt haben.
5 Vgl. Jérôme Carcopino, De Pythagore aux apôtres,
Paris, 1956, bes. S. 10 ff.
0 Herbert Read, Bild und Idee, Köln 1961 (orig.
Icon and Idea. The Function of Art in the Development
of Human Consciousness, Cambridge 1955), S. 11 ff.
’ Vgl. Louis Bréhier, Hart en France des invasions
barbares a l'époque romane, Paris; Peter H. Feist, Byzanz
und die figurale Kunst der Merowingerzeit, in: Byzan-
tinische Beiträge, Berlin 1964, S. 399—411.
8 Herbert Read, 1. c., daselbst.
9 Robert Eisler, Orphisch-dionysische Mysterien in der
christlichen Antike, Vorträge der Bibliothek Warburg
121