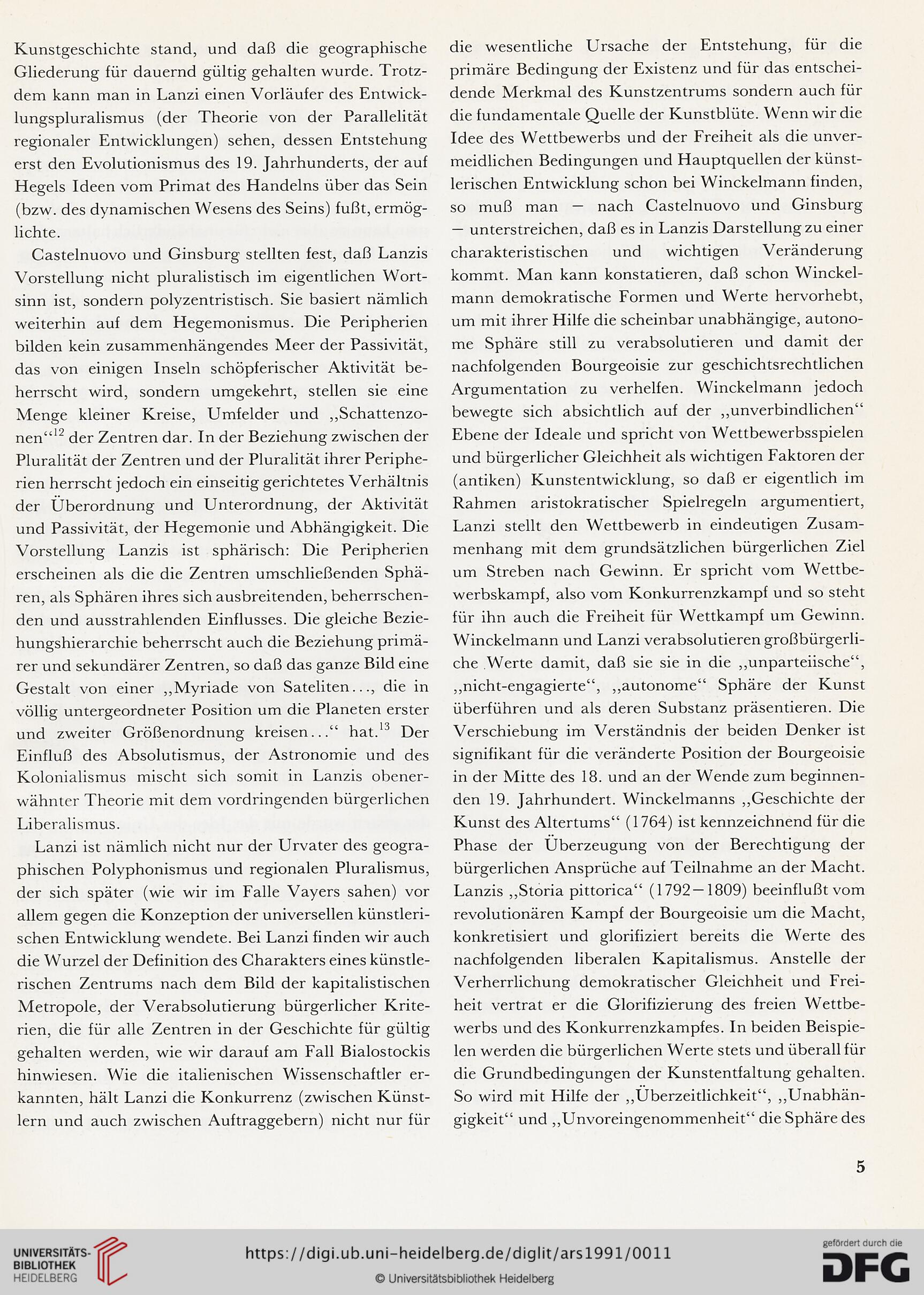Kunstgeschichte stand, und daß die geographische
Gliederung für dauernd gültig gehalten wurde. Trotz-
dem kann man in Lanzi einen Vorläufer des Entwick-
lungspluralismus (der Theorie von der Parallelität
regionaler Entwicklungen) sehen, dessen Entstehung
erst den Evolutionismus des 19. Jahrhunderts, der auf
Hegels Ideen vom Primat des Handelns über das Sein
(bzw. des dynamischen Wesens des Seins) fußt, ermög-
lichte.
Castelnuovo und Ginsburg stellten fest, daß Lanzis
Vorstellung nicht pluralistisch im eigentlichen Wort-
sinn ist, sondern polyzentristisch. Sie basiert nämlich
weiterhin auf dem Hegemonismus. Die Peripherien
bilden kein zusammenhängendes Meer der Passivität,
das von einigen Inseln schöpferischer Aktivität be-
herrscht wird, sondern umgekehrt, stellen sie eine
Menge kleiner Kreise, Umfelder und „Schattenzo-
nen“12 der Zentren dar. In der Beziehung zwischen der
Pluralität der Zentren und der Pluralität ihrer Periphe-
rien herrscht jedoch ein einseitig gerichtetes Verhältnis
der Überordnung und Unterordnung, der Aktivität
und Passivität, der Hegemonie und Abhängigkeit. Die
Vorstellung Lanzis ist sphärisch: Die Peripherien
erscheinen als die die Zentren umschließenden Sphä-
ren, als Sphären ihres sich ausbreitenden, beherrschen-
den und ausstrahlenden Einflusses. Die gleiche Bezie-
hungshierarchie beherrscht auch die Beziehung primä-
rer und sekundärer Zentren, so daß das ganze Bild eine
Gestalt von einer „Myriade von Sateliten..., die in
völlig untergeordneter Position um die Planeten erster
und zweiter Größenordnung kreisen...“ hat.13 Der
Einfluß des Absolutismus, der Astronomie und des
Kolonialismus mischt sich somit in Lanzis obener-
wähnter Theorie mit dem vordringenden bürgerlichen
Liberalismus.
Lanzi ist nämlich nicht nur der Urvater des geogra-
phischen Polyphonismus und regionalen Pluralismus,
der sich später (wie wir im Falle Vayers sahen) vor
allem gegen die Konzeption der universellen künstleri-
schen Entwicklung wendete. Bei Lanzi finden wir auch
die Wurzel der Definition des Charakters eines künstle-
rischen Zentrums nach dem Bild der kapitalistischen
Metropole, der Verabsolutierung bürgerlicher Krite-
rien, die für alle Zentren in der Geschichte für gültig
gehalten werden, wie wir darauf am Fall Bialostockis
hinwiesen. Wie die italienischen Wissenschaftler er-
kannten, hält Lanzi die Konkurrenz (zwischen Künst-
lern und auch zwischen Auftraggebern) nicht nur für
die wesentliche Ursache der Entstehung, für die
primäre Bedingung der Existenz und für das entschei-
dende Merkmal des Kunstzentrums sondern auch für
die fundamentale Quelle der Kunstblüte. Wenn wir die
Idee des Wettbewerbs und der Freiheit als die unver-
meidlichen Bedingungen und Hauptquellen der künst-
lerischen Entwicklung schon bei Winckelmann finden,
so muß man — nach Castelnuovo und Ginsburg
— unterstreichen, daß es in Lanzis Darstellung zu einer
charakteristischen und wichtigen Veränderung
kommt. Man kann konstatieren, daß schon Winckel-
mann demokratische Formen und Werte hervorhebt,
um mit ihrer Hilfe die scheinbar unabhängige, autono-
me Sphäre still zu verabsolutieren und damit der
nachfolgenden Bourgeoisie zur geschichtsrechtlichen
Argumentation zu verhelfen. Winckelmann jedoch
bewegte sich absichtlich auf der „unverbindlichen“
Ebene der Ideale und spricht von Wettbewerbsspielen
und bürgerlicher Gleichheit als wichtigen Faktoren der
(antiken) Kunstentwicklung, so daß er eigentlich im
Rahmen aristokratischer Spielregeln argumentiert,
Lanzi stellt den Wettbewerb in eindeutigen Zusam-
menhang mit dem grundsätzlichen bürgerlichen Ziel
um Streben nach Gewinn. Er spricht vom Wettbe-
werbskampf, also vom Konkurrenzkampf und so steht
für ihn auch die Freiheit für Wettkampf um Gewinn.
Winckelmann und Lanzi verabsolutieren großbürgerli-
che Werte damit, daß sie sie in die „unparteiische“,
„nicht-engagierte“, „autonome“ Sphäre der Kunst
überführen und als deren Substanz präsentieren. Die
Verschiebung im Verständnis der beiden Denker ist
signifikant für die veränderte Position der Bourgeoisie
in der Mitte des 18. und an der Wende zum beginnen-
den 19. Jahrhundert. Winckelmanns „Geschichte der
Kunst des Altertums“ (1764) ist kennzeichnend für die
Phase der Überzeugung von der Berechtigung der
bürgerlichen Ansprüche auf Teilnahme an der Macht.
Lanzis „Storia pittorica“ (1792—1809) beeinflußt vom
revolutionären Kampf der Bourgeoisie um die Macht,
konkretisiert und glorifiziert bereits die Werte des
nachfolgenden liberalen Kapitalismus. Anstelle der
Verherrlichung demokratischer Gleichheit und Frei-
heit vertrat er die Glorifizierung des freien Wettbe-
werbs und des Konkurrenzkampfes. In beiden Beispie-
len werden die bürgerlichen Werte stets und überall für
die Grundbedingungen der Kunstentfaltung gehalten.
So wird mit Hilfe der „Uberzeitlichkeit“, „Unabhän-
gigkeit“ und „Unvoreingenommenheit“ die Sphäre des
5
Gliederung für dauernd gültig gehalten wurde. Trotz-
dem kann man in Lanzi einen Vorläufer des Entwick-
lungspluralismus (der Theorie von der Parallelität
regionaler Entwicklungen) sehen, dessen Entstehung
erst den Evolutionismus des 19. Jahrhunderts, der auf
Hegels Ideen vom Primat des Handelns über das Sein
(bzw. des dynamischen Wesens des Seins) fußt, ermög-
lichte.
Castelnuovo und Ginsburg stellten fest, daß Lanzis
Vorstellung nicht pluralistisch im eigentlichen Wort-
sinn ist, sondern polyzentristisch. Sie basiert nämlich
weiterhin auf dem Hegemonismus. Die Peripherien
bilden kein zusammenhängendes Meer der Passivität,
das von einigen Inseln schöpferischer Aktivität be-
herrscht wird, sondern umgekehrt, stellen sie eine
Menge kleiner Kreise, Umfelder und „Schattenzo-
nen“12 der Zentren dar. In der Beziehung zwischen der
Pluralität der Zentren und der Pluralität ihrer Periphe-
rien herrscht jedoch ein einseitig gerichtetes Verhältnis
der Überordnung und Unterordnung, der Aktivität
und Passivität, der Hegemonie und Abhängigkeit. Die
Vorstellung Lanzis ist sphärisch: Die Peripherien
erscheinen als die die Zentren umschließenden Sphä-
ren, als Sphären ihres sich ausbreitenden, beherrschen-
den und ausstrahlenden Einflusses. Die gleiche Bezie-
hungshierarchie beherrscht auch die Beziehung primä-
rer und sekundärer Zentren, so daß das ganze Bild eine
Gestalt von einer „Myriade von Sateliten..., die in
völlig untergeordneter Position um die Planeten erster
und zweiter Größenordnung kreisen...“ hat.13 Der
Einfluß des Absolutismus, der Astronomie und des
Kolonialismus mischt sich somit in Lanzis obener-
wähnter Theorie mit dem vordringenden bürgerlichen
Liberalismus.
Lanzi ist nämlich nicht nur der Urvater des geogra-
phischen Polyphonismus und regionalen Pluralismus,
der sich später (wie wir im Falle Vayers sahen) vor
allem gegen die Konzeption der universellen künstleri-
schen Entwicklung wendete. Bei Lanzi finden wir auch
die Wurzel der Definition des Charakters eines künstle-
rischen Zentrums nach dem Bild der kapitalistischen
Metropole, der Verabsolutierung bürgerlicher Krite-
rien, die für alle Zentren in der Geschichte für gültig
gehalten werden, wie wir darauf am Fall Bialostockis
hinwiesen. Wie die italienischen Wissenschaftler er-
kannten, hält Lanzi die Konkurrenz (zwischen Künst-
lern und auch zwischen Auftraggebern) nicht nur für
die wesentliche Ursache der Entstehung, für die
primäre Bedingung der Existenz und für das entschei-
dende Merkmal des Kunstzentrums sondern auch für
die fundamentale Quelle der Kunstblüte. Wenn wir die
Idee des Wettbewerbs und der Freiheit als die unver-
meidlichen Bedingungen und Hauptquellen der künst-
lerischen Entwicklung schon bei Winckelmann finden,
so muß man — nach Castelnuovo und Ginsburg
— unterstreichen, daß es in Lanzis Darstellung zu einer
charakteristischen und wichtigen Veränderung
kommt. Man kann konstatieren, daß schon Winckel-
mann demokratische Formen und Werte hervorhebt,
um mit ihrer Hilfe die scheinbar unabhängige, autono-
me Sphäre still zu verabsolutieren und damit der
nachfolgenden Bourgeoisie zur geschichtsrechtlichen
Argumentation zu verhelfen. Winckelmann jedoch
bewegte sich absichtlich auf der „unverbindlichen“
Ebene der Ideale und spricht von Wettbewerbsspielen
und bürgerlicher Gleichheit als wichtigen Faktoren der
(antiken) Kunstentwicklung, so daß er eigentlich im
Rahmen aristokratischer Spielregeln argumentiert,
Lanzi stellt den Wettbewerb in eindeutigen Zusam-
menhang mit dem grundsätzlichen bürgerlichen Ziel
um Streben nach Gewinn. Er spricht vom Wettbe-
werbskampf, also vom Konkurrenzkampf und so steht
für ihn auch die Freiheit für Wettkampf um Gewinn.
Winckelmann und Lanzi verabsolutieren großbürgerli-
che Werte damit, daß sie sie in die „unparteiische“,
„nicht-engagierte“, „autonome“ Sphäre der Kunst
überführen und als deren Substanz präsentieren. Die
Verschiebung im Verständnis der beiden Denker ist
signifikant für die veränderte Position der Bourgeoisie
in der Mitte des 18. und an der Wende zum beginnen-
den 19. Jahrhundert. Winckelmanns „Geschichte der
Kunst des Altertums“ (1764) ist kennzeichnend für die
Phase der Überzeugung von der Berechtigung der
bürgerlichen Ansprüche auf Teilnahme an der Macht.
Lanzis „Storia pittorica“ (1792—1809) beeinflußt vom
revolutionären Kampf der Bourgeoisie um die Macht,
konkretisiert und glorifiziert bereits die Werte des
nachfolgenden liberalen Kapitalismus. Anstelle der
Verherrlichung demokratischer Gleichheit und Frei-
heit vertrat er die Glorifizierung des freien Wettbe-
werbs und des Konkurrenzkampfes. In beiden Beispie-
len werden die bürgerlichen Werte stets und überall für
die Grundbedingungen der Kunstentfaltung gehalten.
So wird mit Hilfe der „Uberzeitlichkeit“, „Unabhän-
gigkeit“ und „Unvoreingenommenheit“ die Sphäre des
5