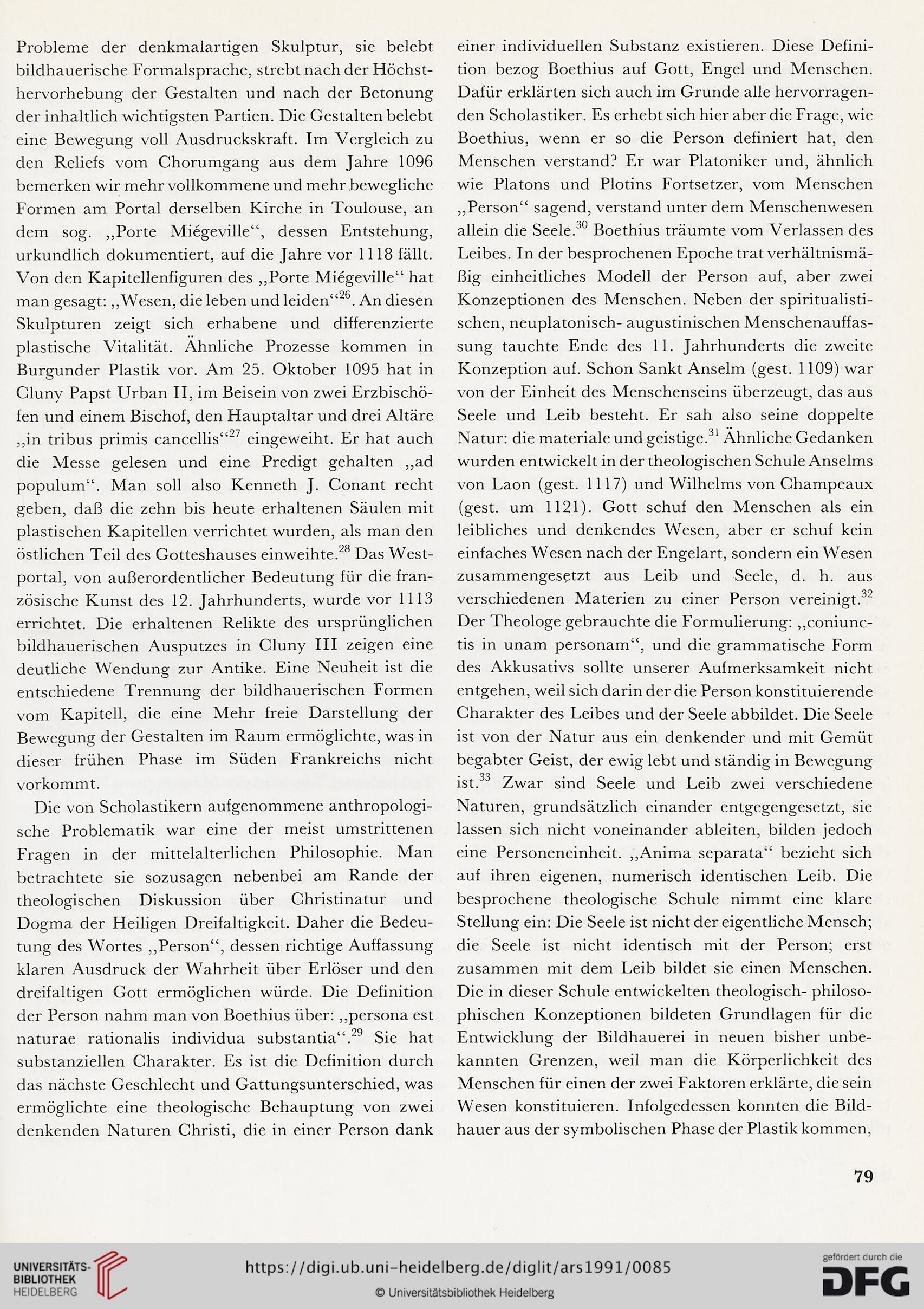Probleme der denkmalartigen Skulptur, sie belebt
bildhauerische Formalsprache, strebt nach der Höchst-
hervorhebung der Gestalten und nach der Betonung
der inhaltlich wichtigsten Partien. Die Gestalten belebt
eine Bewegung voll Ausdruckskraft. Im Vergleich zu
den Reliefs vom Chorumgang aus dem Jahre 1096
bemerken wir mehr vollkommene und mehr bewegliche
Formen am Portal derselben Kirche in Toulouse, an
dem sog. „Porte Miégeville“, dessen Entstehung,
urkundlich dokumentiert, auf die Jahre vor 1118 fällt.
Von den Kapitellenfiguren des „Porte Miégeville“ hat
man gesagt: „Wesen, die leben und leiden“26. An diesen
Skulpturen zeigt sich erhabene und differenzierte
plastische Vitalität. Ähnliche Prozesse kommen in
Burgunder Plastik vor. Am 25. Oktober 1095 hat in
Cluny Papst Urban II, im Beisein von zwei Erzbischö-
fen und einem Bischof, den Hauptaltar und drei Altäre
„in tribus přimis cancellis“27 eingeweiht. Er hat auch
die Messe gelesen und eine Predigt gehalten „ad
populum“. Man soll also Kenneth J. Conant recht
geben, daß die zehn bis heute erhaltenen Säulen mit
plastischen Kapitellen verrichtet wurden, als man den
östlichen Teil des Gotteshauses einweihte.28 Das West-
portal, von außerordentlicher Bedeutung für die fran-
zösische Kunst des 12. Jahrhunderts, wurde vor 1113
errichtet. Die erhaltenen Relikte des ursprünglichen
bildhauerischen Ausputzes in Cluny III zeigen eine
deutliche Wendung zur Antike. Eine Neuheit ist die
entschiedene Trennung der bildhauerischen Formen
vom Kapitell, die eine Mehr freie Darstellung der
Bewegung der Gestalten im Raum ermöglichte, was in
dieser frühen Phase im Süden Frankreichs nicht
vorkommt.
Die von Scholastikern aufgenommene anthropologi-
sche Problematik war eine der meist umstrittenen
Fragen in der mittelalterlichen Philosophie. Man
betrachtete sie sozusagen nebenbei am Rande der
theologischen Diskussion über Christinatur und
Dogma der Heiligen Dreifaltigkeit. Daher die Bedeu-
tung des Wortes „Person“, dessen richtige Auffassung
klaren Ausdruck der Wahrheit über Erlöser und den
dreifältigen Gott ermöglichen würde. Die Definition
der Person nahm man von Boethius über: „persona est
naturae rationalis individua substantia“.29 Sie hat
substanziellen Charakter. Es ist die Definition durch
das nächste Geschlecht und Gattungsunterschied, was
ermöglichte eine theologische Behauptung von zwei
denkenden Naturen Christi, die in einer Person dank
einer individuellen Substanz existieren. Diese Defini-
tion bezog Boethius auf Gott, Engel und Menschen.
Dafür erklärten sich auch im Grunde alle hervorragen-
den Scholastiker. Es erhebt sich hier aber die Frage, wie
Boethius, wenn er so die Person definiert hat, den
Menschen verstand? Er war Platoniker und, ähnlich
wie Platons und Plotins Fortsetzer, vom Menschen
„Person“ sagend, verstand unter dem Menschenwesen
allein die Seele.30 Boethius träumte vom Verlassen des
Leibes. In der besprochenen Epoche trat verhältnismä-
ßig einheitliches Modell der Person auf, aber zwei
Konzeptionen des Menschen. Neben der spiritualisti-
schen, neuplatonisch- augustinischen Menschenauffas-
sung tauchte Ende des 11. Jahrhunderts die zweite
Konzeption auf. Schon Sankt Anselm (gest. 1109) war
von der Einheit des Menschenseins überzeugt, das aus
Seele und Leib besteht. Er sah also seine doppelte
Natur: die materiale und geistige.31 Ähnliche Gedanken
wurden entwickelt in der theologischen Schule Anselms
von Laon (gest. 1117) und Wilhelms von Champeaux
(gest, um 1121). Gott schuf den Menschen als ein
leibliches und denkendes Wesen, aber er schuf kein
einfaches Wesen nach der Engelart, sondern ein Wesen
zusammengesetzt aus Leib und Seele, d. h. aus
verschiedenen Materien zu einer Person vereinigt.32
Der Theologe gebrauchte die Formulierung: „coniunc-
tis in unam personam“, und die grammatische Form
des Akkusativs sollte unserer Aufmerksamkeit nicht
entgehen, weil sich darin der die Person konstituierende
Charakter des Leibes und der Seele abbildet. Die Seele
ist von der Natur aus ein denkender und mit Gemüt
begabter Geist, der ewig lebt und ständig in Bewegung
ist.33 Zwar sind Seele und Leib zwei verschiedene
Naturen, grundsätzlich einander entgegengesetzt, sie
lassen sich nicht voneinander ableiten, bilden jedoch
eine Personeneinheit. „Anima separata“ bezieht sich
auf ihren eigenen, numerisch identischen Leib. Die
besprochene theologische Schule nimmt eine klare
Stellung ein: Die Seele ist nicht der eigentliche Mensch;
die Seele ist nicht identisch mit der Person; erst
zusammen mit dem Leib bildet sie einen Menschen.
Die in dieser Schule entwickelten theologisch- philoso-
phischen Konzeptionen bildeten Grundlagen für die
Entwicklung der Bildhauerei in neuen bisher unbe-
kannten Grenzen, weil man die Körperlichkeit des
Menschen für einen der zwei Faktoren erklärte, die sein
Wesen konstituieren. Infolgedessen konnten die Bild-
hauer aus der symbolischen Phase der Plastik kommen,
79
bildhauerische Formalsprache, strebt nach der Höchst-
hervorhebung der Gestalten und nach der Betonung
der inhaltlich wichtigsten Partien. Die Gestalten belebt
eine Bewegung voll Ausdruckskraft. Im Vergleich zu
den Reliefs vom Chorumgang aus dem Jahre 1096
bemerken wir mehr vollkommene und mehr bewegliche
Formen am Portal derselben Kirche in Toulouse, an
dem sog. „Porte Miégeville“, dessen Entstehung,
urkundlich dokumentiert, auf die Jahre vor 1118 fällt.
Von den Kapitellenfiguren des „Porte Miégeville“ hat
man gesagt: „Wesen, die leben und leiden“26. An diesen
Skulpturen zeigt sich erhabene und differenzierte
plastische Vitalität. Ähnliche Prozesse kommen in
Burgunder Plastik vor. Am 25. Oktober 1095 hat in
Cluny Papst Urban II, im Beisein von zwei Erzbischö-
fen und einem Bischof, den Hauptaltar und drei Altäre
„in tribus přimis cancellis“27 eingeweiht. Er hat auch
die Messe gelesen und eine Predigt gehalten „ad
populum“. Man soll also Kenneth J. Conant recht
geben, daß die zehn bis heute erhaltenen Säulen mit
plastischen Kapitellen verrichtet wurden, als man den
östlichen Teil des Gotteshauses einweihte.28 Das West-
portal, von außerordentlicher Bedeutung für die fran-
zösische Kunst des 12. Jahrhunderts, wurde vor 1113
errichtet. Die erhaltenen Relikte des ursprünglichen
bildhauerischen Ausputzes in Cluny III zeigen eine
deutliche Wendung zur Antike. Eine Neuheit ist die
entschiedene Trennung der bildhauerischen Formen
vom Kapitell, die eine Mehr freie Darstellung der
Bewegung der Gestalten im Raum ermöglichte, was in
dieser frühen Phase im Süden Frankreichs nicht
vorkommt.
Die von Scholastikern aufgenommene anthropologi-
sche Problematik war eine der meist umstrittenen
Fragen in der mittelalterlichen Philosophie. Man
betrachtete sie sozusagen nebenbei am Rande der
theologischen Diskussion über Christinatur und
Dogma der Heiligen Dreifaltigkeit. Daher die Bedeu-
tung des Wortes „Person“, dessen richtige Auffassung
klaren Ausdruck der Wahrheit über Erlöser und den
dreifältigen Gott ermöglichen würde. Die Definition
der Person nahm man von Boethius über: „persona est
naturae rationalis individua substantia“.29 Sie hat
substanziellen Charakter. Es ist die Definition durch
das nächste Geschlecht und Gattungsunterschied, was
ermöglichte eine theologische Behauptung von zwei
denkenden Naturen Christi, die in einer Person dank
einer individuellen Substanz existieren. Diese Defini-
tion bezog Boethius auf Gott, Engel und Menschen.
Dafür erklärten sich auch im Grunde alle hervorragen-
den Scholastiker. Es erhebt sich hier aber die Frage, wie
Boethius, wenn er so die Person definiert hat, den
Menschen verstand? Er war Platoniker und, ähnlich
wie Platons und Plotins Fortsetzer, vom Menschen
„Person“ sagend, verstand unter dem Menschenwesen
allein die Seele.30 Boethius träumte vom Verlassen des
Leibes. In der besprochenen Epoche trat verhältnismä-
ßig einheitliches Modell der Person auf, aber zwei
Konzeptionen des Menschen. Neben der spiritualisti-
schen, neuplatonisch- augustinischen Menschenauffas-
sung tauchte Ende des 11. Jahrhunderts die zweite
Konzeption auf. Schon Sankt Anselm (gest. 1109) war
von der Einheit des Menschenseins überzeugt, das aus
Seele und Leib besteht. Er sah also seine doppelte
Natur: die materiale und geistige.31 Ähnliche Gedanken
wurden entwickelt in der theologischen Schule Anselms
von Laon (gest. 1117) und Wilhelms von Champeaux
(gest, um 1121). Gott schuf den Menschen als ein
leibliches und denkendes Wesen, aber er schuf kein
einfaches Wesen nach der Engelart, sondern ein Wesen
zusammengesetzt aus Leib und Seele, d. h. aus
verschiedenen Materien zu einer Person vereinigt.32
Der Theologe gebrauchte die Formulierung: „coniunc-
tis in unam personam“, und die grammatische Form
des Akkusativs sollte unserer Aufmerksamkeit nicht
entgehen, weil sich darin der die Person konstituierende
Charakter des Leibes und der Seele abbildet. Die Seele
ist von der Natur aus ein denkender und mit Gemüt
begabter Geist, der ewig lebt und ständig in Bewegung
ist.33 Zwar sind Seele und Leib zwei verschiedene
Naturen, grundsätzlich einander entgegengesetzt, sie
lassen sich nicht voneinander ableiten, bilden jedoch
eine Personeneinheit. „Anima separata“ bezieht sich
auf ihren eigenen, numerisch identischen Leib. Die
besprochene theologische Schule nimmt eine klare
Stellung ein: Die Seele ist nicht der eigentliche Mensch;
die Seele ist nicht identisch mit der Person; erst
zusammen mit dem Leib bildet sie einen Menschen.
Die in dieser Schule entwickelten theologisch- philoso-
phischen Konzeptionen bildeten Grundlagen für die
Entwicklung der Bildhauerei in neuen bisher unbe-
kannten Grenzen, weil man die Körperlichkeit des
Menschen für einen der zwei Faktoren erklärte, die sein
Wesen konstituieren. Infolgedessen konnten die Bild-
hauer aus der symbolischen Phase der Plastik kommen,
79