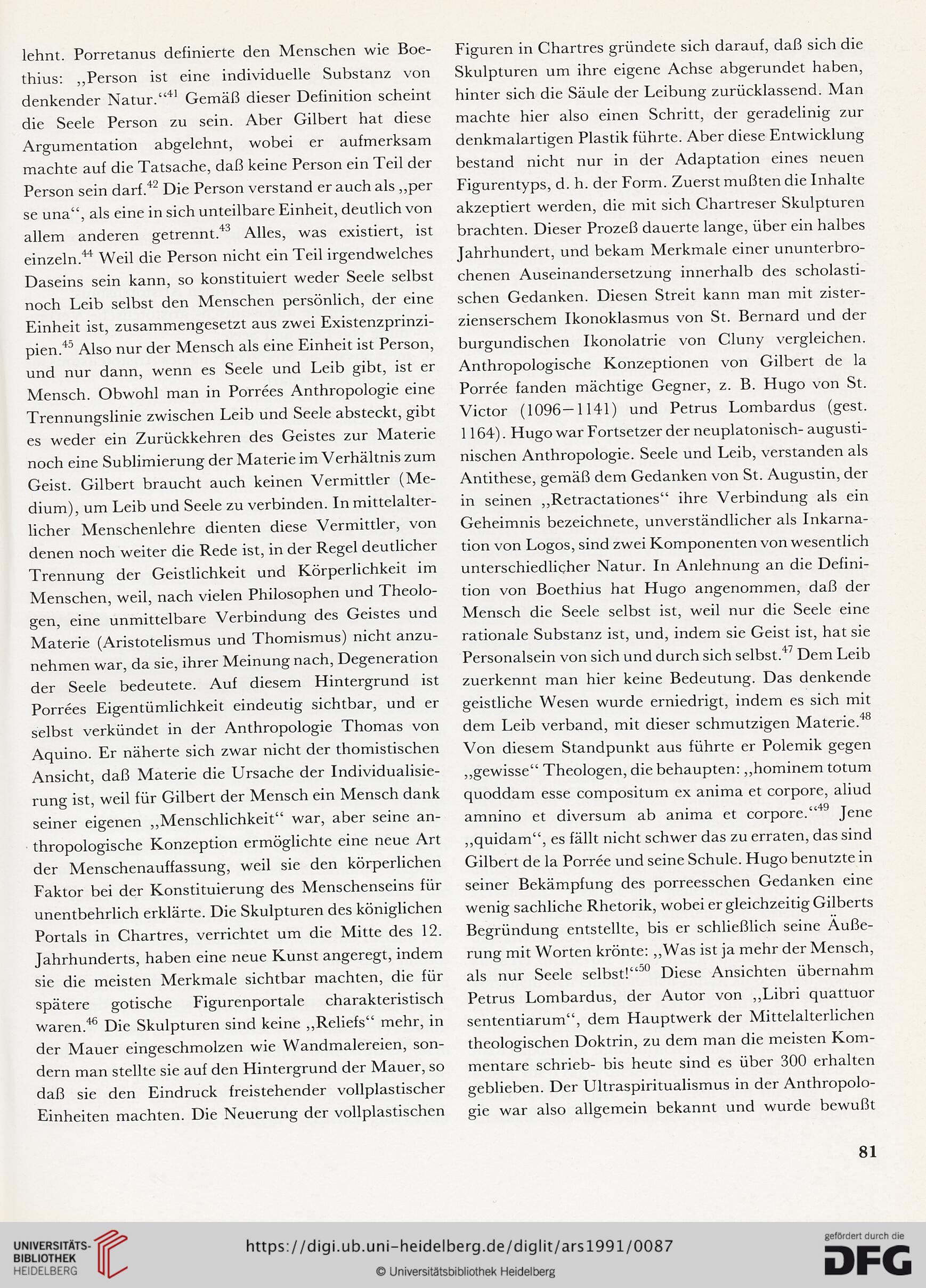lehnt. Porretanus definierte den Menschen wie Boe-
thius: „Person ist eine individuelle Substanz von
denkender Natur.“41 Gemäß dieser Definition scheint
die Seele Person zu sein. Aber Gilbert hat diese
Argumentation abgelehnt, wobei er aufmerksam
machte auf die Tatsache, daß keine Person ein Teil der
Person sein darf.42 Die Person verstand er auch als „per
se una“, als eine in sich unteilbare Einheit, deutlich von
allem anderen getrennt.43 Alles, was existiert, ist
einzeln.44 Weil die Person nicht ein Teil irgendwelches
Daseins sein kann, so konstituiert weder Seele selbst
noch Leib selbst den Menschen persönlich, der eine
Einheit ist, zusammengesetzt aus zwei Existenzprinzi-
pien.43 Also nur der Mensch als eine Einheit ist Person,
und nur dann, wenn es Seele und Leib gibt, ist er
Mensch. Obwohl man in Porrées Anthropologie eine
Trennungslinie zwischen Leib und Seele absteckt, gibt
es weder ein Zurückkehren des Geistes zur Materie
noch eine Sublimierung der Materie im Verhältnis zum
Geist. Gilbert braucht auch keinen Vermittler (Me-
dium), um Leib und Seele zu verbinden. In mittelalter-
licher Menschenlehre dienten diese Vermittler, von
denen noch weiter die Rede ist, in der Regel deutlicher
Trennung der Geistlichkeit und Körperlichkeit im
Menschen, weil, nach vielen Philosophen und Theolo-
gen, eine unmittelbare Verbindung des Geistes und
Materie (Aristotelismus und Thomismus) nicht anzu-
nehmen war, da sie, ihrer Meinung nach, Degeneration
der Seele bedeutete. Auf diesem Hintergrund ist
Porrées Eigentümlichkeit eindeutig sichtbar, und er
selbst verkündet in der Anthropologie Thomas von
Aquino. Er näherte sich zwar nicht der thomistischen
Ansicht, daß Materie die Ursache der Individualisie-
rung ist, weil für Gilbert der Mensch ein Mensch dank
seiner eigenen „Menschlichkeit“ war, aber seine an-
thropologische Konzeption ermöglichte eine neue Art
der Menschenauffassung, weil sie den körperlichen
Faktor bei der Konstituierung des Menschenseins für
unentbehrlich erklärte. Die Skulpturen des königlichen
Portals in Chartres, verrichtet um die Mitte des 12.
Jahrhunderts, haben eine neue Kunst angeregt, indem
sie die meisten Merkmale sichtbar machten, die für
spätere gotische Figurenportale charakteristisch
waren.46 Die Skulpturen sind keine „Reliefs“ mehr, in
der Mauer eingeschmolzen wie Wandmalereien, son-
dern man stellte sie auf den Hintergrund der Mauer, so
daß sie den Eindruck freistehender vollplastischer
Einheiten machten. Die Neuerung der vollplastischen
Figuren in Chartres gründete sich darauf, daß sich die
Skulpturen um ihre eigene Achse abgerundet haben,
hinter sich die Säule der Leibung zurücklassend. Man
machte hier also einen Schritt, der geradelinig zur
denkmalartigen Plastik führte. Aber diese Entwicklung
bestand nicht nur in der Adaptation eines neuen
Figurentyps, d. h. der Form. Zuerst mußten die Inhalte
akzeptiert werden, die mit sich Chartreser Skulpturen
brachten. Dieser Prozeß dauerte lange, über ein halbes
Jahrhundert, und bekam Merkmale einer ununterbro-
chenen Auseinandersetzung innerhalb des scholasti-
schen Gedanken. Diesen Streit kann man mit zister-
zienserschem Ikonoklasmus von St. Bernard und der
burgundischen Ikonolatrie von Cluny vergleichen.
Anthropologische Konzeptionen von Gilbert de la
Porrée fanden mächtige Gegner, z. B. Hugo von St.
Victor (1096—1141) und Petrus Lombardus (gest.
1164). Hugo war Fortsetzer der neuplatonisch- augusti-
nischen Anthropologie. Seele und Leib, verstanden als
Antithese, gemäß dem Gedanken von St. Augustin, der
in seinen „Retractationes“ ihre Verbindung als ein
Geheimnis bezeichnete, unverständlicher als Inkarna-
tion von Logos, sind zwei Komponenten von wesentlich
unterschiedlicher Natur. In Anlehnung an die Defini-
tion von Boethius hat Hugo angenommen, daß der
Mensch die Seele selbst ist, weil nur die Seele eine
rationale Substanz ist, und, indem sie Geist ist, hat sie
Personalsein von sich und durch sich selbst.47 Dem Leib
zuerkennt man hier keine Bedeutung. Das denkende
geistliche Wesen wurde erniedrigt, indem es sich mit
dem Leib verband, mit dieser schmutzigen Materie.48
Von diesem Standpunkt aus führte er Polemik gegen
„gewisse“ Theologen, die behaupten: „hominem totum
quoddam esse compositum ex anima et corpore, aliud
amnino et diversum ab anima et corpore.“49 Jene
„quidam“, es fällt nicht schwer das zu erraten, das sind
Gilbert de la Porrée und seine Schule. Hugo benutzte in
seiner Bekämpfung des porreesschen Gedanken eine
wenig sachliche Rhetorik, wobei er gleichzeitig Gilberts
Begründung entstellte, bis er schließlich seine Äuße-
rung mit Worten krönte: „Was ist ja mehr der Mensch,
als nur Seele selbst!“50 Diese Ansichten übernahm
Petrus Lombardus, der Autor von „Libri quattuor
sententiarum“, dem Hauptwerk der Mittelalterlichen
theologischen Doktrin, zu dem man die meisten Kom-
mentare schrieb- bis heute sind es über 300 erhalten
geblieben. Der Ultraspiritualismus in der Anthropolo-
gie war also allgemein bekannt und wurde bewußt
81
thius: „Person ist eine individuelle Substanz von
denkender Natur.“41 Gemäß dieser Definition scheint
die Seele Person zu sein. Aber Gilbert hat diese
Argumentation abgelehnt, wobei er aufmerksam
machte auf die Tatsache, daß keine Person ein Teil der
Person sein darf.42 Die Person verstand er auch als „per
se una“, als eine in sich unteilbare Einheit, deutlich von
allem anderen getrennt.43 Alles, was existiert, ist
einzeln.44 Weil die Person nicht ein Teil irgendwelches
Daseins sein kann, so konstituiert weder Seele selbst
noch Leib selbst den Menschen persönlich, der eine
Einheit ist, zusammengesetzt aus zwei Existenzprinzi-
pien.43 Also nur der Mensch als eine Einheit ist Person,
und nur dann, wenn es Seele und Leib gibt, ist er
Mensch. Obwohl man in Porrées Anthropologie eine
Trennungslinie zwischen Leib und Seele absteckt, gibt
es weder ein Zurückkehren des Geistes zur Materie
noch eine Sublimierung der Materie im Verhältnis zum
Geist. Gilbert braucht auch keinen Vermittler (Me-
dium), um Leib und Seele zu verbinden. In mittelalter-
licher Menschenlehre dienten diese Vermittler, von
denen noch weiter die Rede ist, in der Regel deutlicher
Trennung der Geistlichkeit und Körperlichkeit im
Menschen, weil, nach vielen Philosophen und Theolo-
gen, eine unmittelbare Verbindung des Geistes und
Materie (Aristotelismus und Thomismus) nicht anzu-
nehmen war, da sie, ihrer Meinung nach, Degeneration
der Seele bedeutete. Auf diesem Hintergrund ist
Porrées Eigentümlichkeit eindeutig sichtbar, und er
selbst verkündet in der Anthropologie Thomas von
Aquino. Er näherte sich zwar nicht der thomistischen
Ansicht, daß Materie die Ursache der Individualisie-
rung ist, weil für Gilbert der Mensch ein Mensch dank
seiner eigenen „Menschlichkeit“ war, aber seine an-
thropologische Konzeption ermöglichte eine neue Art
der Menschenauffassung, weil sie den körperlichen
Faktor bei der Konstituierung des Menschenseins für
unentbehrlich erklärte. Die Skulpturen des königlichen
Portals in Chartres, verrichtet um die Mitte des 12.
Jahrhunderts, haben eine neue Kunst angeregt, indem
sie die meisten Merkmale sichtbar machten, die für
spätere gotische Figurenportale charakteristisch
waren.46 Die Skulpturen sind keine „Reliefs“ mehr, in
der Mauer eingeschmolzen wie Wandmalereien, son-
dern man stellte sie auf den Hintergrund der Mauer, so
daß sie den Eindruck freistehender vollplastischer
Einheiten machten. Die Neuerung der vollplastischen
Figuren in Chartres gründete sich darauf, daß sich die
Skulpturen um ihre eigene Achse abgerundet haben,
hinter sich die Säule der Leibung zurücklassend. Man
machte hier also einen Schritt, der geradelinig zur
denkmalartigen Plastik führte. Aber diese Entwicklung
bestand nicht nur in der Adaptation eines neuen
Figurentyps, d. h. der Form. Zuerst mußten die Inhalte
akzeptiert werden, die mit sich Chartreser Skulpturen
brachten. Dieser Prozeß dauerte lange, über ein halbes
Jahrhundert, und bekam Merkmale einer ununterbro-
chenen Auseinandersetzung innerhalb des scholasti-
schen Gedanken. Diesen Streit kann man mit zister-
zienserschem Ikonoklasmus von St. Bernard und der
burgundischen Ikonolatrie von Cluny vergleichen.
Anthropologische Konzeptionen von Gilbert de la
Porrée fanden mächtige Gegner, z. B. Hugo von St.
Victor (1096—1141) und Petrus Lombardus (gest.
1164). Hugo war Fortsetzer der neuplatonisch- augusti-
nischen Anthropologie. Seele und Leib, verstanden als
Antithese, gemäß dem Gedanken von St. Augustin, der
in seinen „Retractationes“ ihre Verbindung als ein
Geheimnis bezeichnete, unverständlicher als Inkarna-
tion von Logos, sind zwei Komponenten von wesentlich
unterschiedlicher Natur. In Anlehnung an die Defini-
tion von Boethius hat Hugo angenommen, daß der
Mensch die Seele selbst ist, weil nur die Seele eine
rationale Substanz ist, und, indem sie Geist ist, hat sie
Personalsein von sich und durch sich selbst.47 Dem Leib
zuerkennt man hier keine Bedeutung. Das denkende
geistliche Wesen wurde erniedrigt, indem es sich mit
dem Leib verband, mit dieser schmutzigen Materie.48
Von diesem Standpunkt aus führte er Polemik gegen
„gewisse“ Theologen, die behaupten: „hominem totum
quoddam esse compositum ex anima et corpore, aliud
amnino et diversum ab anima et corpore.“49 Jene
„quidam“, es fällt nicht schwer das zu erraten, das sind
Gilbert de la Porrée und seine Schule. Hugo benutzte in
seiner Bekämpfung des porreesschen Gedanken eine
wenig sachliche Rhetorik, wobei er gleichzeitig Gilberts
Begründung entstellte, bis er schließlich seine Äuße-
rung mit Worten krönte: „Was ist ja mehr der Mensch,
als nur Seele selbst!“50 Diese Ansichten übernahm
Petrus Lombardus, der Autor von „Libri quattuor
sententiarum“, dem Hauptwerk der Mittelalterlichen
theologischen Doktrin, zu dem man die meisten Kom-
mentare schrieb- bis heute sind es über 300 erhalten
geblieben. Der Ultraspiritualismus in der Anthropolo-
gie war also allgemein bekannt und wurde bewußt
81