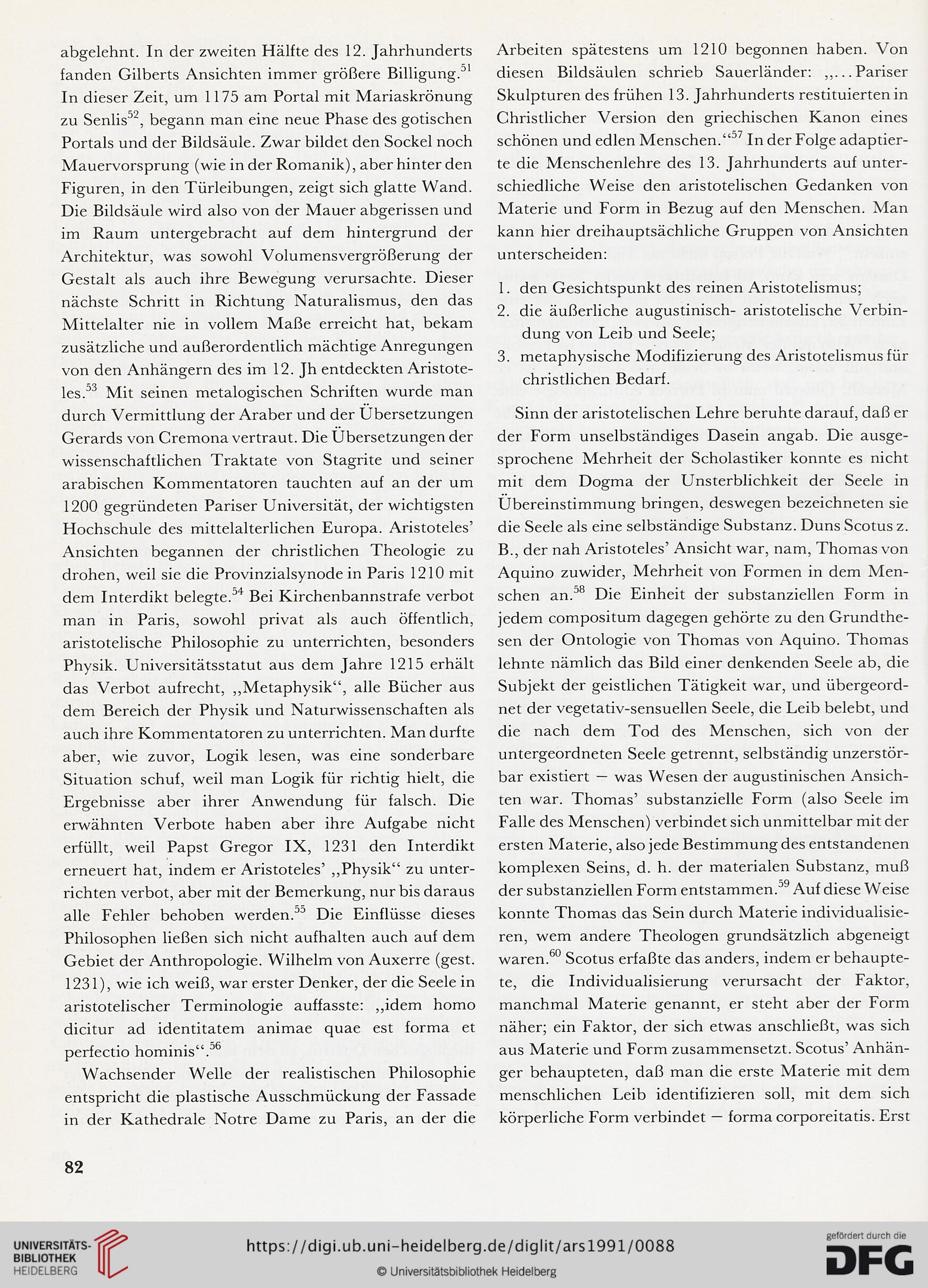abgelehnt. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts
fanden Gilberts Ansichten immer größere Billigung.31
In dieser Zeit, um 1175 am Portal mit Mariaskrönung
zu Senlis52, begann man eine neue Phase des gotischen
Portals und der Bildsäule. Zwar bildet den Sockel noch
Mauervorsprung (wie in der Romanik), aber hinter den
Figuren, in den Türleibungen, zeigt sich glatte Wand.
Die Bildsäule wird also von der Mauer abgerissen und
im Raum untergebracht auf dem hintergrund der
Architektur, was sowohl Volumensvergrößerung der
Gestalt als auch ihre Bewegung verursachte. Dieser
nächste Schritt in Richtung Naturalismus, den das
Mittelalter nie in vollem Maße erreicht hat, bekam
zusätzliche und außerordentlich mächtige Anregungen
von den Anhängern des im 12. Jh entdeckten Aristote-
les.33 Mit seinen metalogischen Schriften wurde man
durch Vermittlung der Araber und der Übersetzungen
Gerards von Cremona vertraut. Die Übersetzungen der
wissenschaftlichen Traktate von Stagrite und seiner
arabischen Kommentatoren tauchten auf an der um
1200 gegründeten Pariser Universität, der wichtigsten
Hochschule des mittelalterlichen Europa. Aristoteles’
Ansichten begannen der christlichen Theologie zu
drohen, weil sie die Provinzialsynode in Paris 1210 mit
dem Interdikt belegte.34 Bei Kirchenbannstrafe verbot
man in Paris, sowohl privat als auch öffentlich,
aristotelische Philosophie zu unterrichten, besonders
Physik. Universitätsstatut aus dem Jahre 1215 erhält
das Verbot aufrecht, „Metaphysik“, alle Bücher aus
dem Bereich der Physik und Naturwissenschaften als
auch ihre Kommentatoren zu unterrichten. Man durfte
aber, wie zuvor, Logik lesen, was eine sonderbare
Situation schuf, weil man Logik für richtig hielt, die
Ergebnisse aber ihrer Anwendung für falsch. Die
erwähnten Verbote haben aber ihre Aufgabe nicht
erfüllt, weil Papst Gregor IX, 1231 den Interdikt
erneuert hat, indem er Aristoteles’ „Physik“ zu unter-
richten verbot, aber mit der Bemerkung, nur bis daraus
alle Fehler behoben werden.33 Die Einflüsse dieses
Philosophen ließen sich nicht aufhalten auch auf dem
Gebiet der Anthropologie. Wilhelm von Auxerre (gest.
1231), wie ich weiß, war erster Denker, der die Seele in
aristotelischer Terminologie auffasste: „idem homo
dicitur ad identitatem animae quae est forma et
perfectio hominis“.36
Wachsender Welle der realistischen Philosophie
entspricht die plastische Ausschmückung der Fassade
in der Kathedrale Notre Dame zu Paris, an der die
Arbeiten spätestens um 1210 begonnen haben. Von
diesen Bildsäulen schrieb Sauerländer: „...Pariser
Skulpturen des frühen 13. Jahrhunderts restituierten in
Christlicher Version den griechischen Kanon eines
schönen und edlen Menschen. “57 In der Folge adaptier-
te die Menschenlehre des 13. Jahrhunderts auf unter-
schiedliche Weise den aristotelischen Gedanken von
Materie und Form in Bezug auf den Menschen. Man
kann hier dreihauptsächliche Gruppen von Ansichten
unterscheiden:
1. den Gesichtspunkt des reinen Aristotelismus;
2. die äußerliche augustinisch- aristotelische Verbin-
dung von Leib und Seele;
3. metaphysische Modifizierung des Aristotelismus für
christlichen Bedarf.
Sinn der aristotelischen Lehre beruhte darauf, daß er
der Form unselbständiges Dasein angab. Die ausge-
sprochene Mehrheit der Scholastiker konnte es nicht
mit dem Dogma der Unsterblichkeit der Seele in
Übereinstimmung bringen, deswegen bezeichneten sie
die Seele als eine selbständige Substanz. Duns Scotus z.
B., der nah Aristoteles’ Ansicht war, nam, Thomas von
Aquino zuwider, Mehrheit von Formen in dem Men-
schen an.38 Die Einheit der substanziellen Form in
jedem compositum dagegen gehörte zu den Grundthe-
sen der Ontologie von Thomas von Aquino. Thomas
lehnte nämlich das Bild einer denkenden Seele ab, die
Subjekt der geistlichen Tätigkeit war, und übergeord-
net der vegetativ-sensuellen Seele, die Leib belebt, und
die nach dem Tod des Menschen, sich von der
untergeordneten Seele getrennt, selbständig unzerstör-
bar existiert — was Wesen der augustinischen Ansich-
ten war. Thomas’ substanzielle Form (also Seele im
Falle des Menschen) verbindet sich unmittelbar mit der
ersten Materie, also jede Bestimmung des entstandenen
komplexen Seins, d. h. der materialen Substanz, muß
der substanziellen Form entstammen.39 Auf diese Weise
konnte Thomas das Sein durch Materie individualisie-
ren, wem andere Theologen grundsätzlich abgeneigt
waren.60 Scotus erfaßte das anders, indem er behaupte-
te, die Individualisierung verursacht der Faktor,
manchmal Materie genannt, er steht aber der Form
näher; ein Faktor, der sich etwas anschließt, was sich
aus Materie und Form zusammensetzt. Scotus’ Anhän-
ger behaupteten, daß man die erste Materie mit dem
menschlichen Leib identifizieren soll, mit dem sich
körperliche Form verbindet — forma corporeitatis. Erst
82
fanden Gilberts Ansichten immer größere Billigung.31
In dieser Zeit, um 1175 am Portal mit Mariaskrönung
zu Senlis52, begann man eine neue Phase des gotischen
Portals und der Bildsäule. Zwar bildet den Sockel noch
Mauervorsprung (wie in der Romanik), aber hinter den
Figuren, in den Türleibungen, zeigt sich glatte Wand.
Die Bildsäule wird also von der Mauer abgerissen und
im Raum untergebracht auf dem hintergrund der
Architektur, was sowohl Volumensvergrößerung der
Gestalt als auch ihre Bewegung verursachte. Dieser
nächste Schritt in Richtung Naturalismus, den das
Mittelalter nie in vollem Maße erreicht hat, bekam
zusätzliche und außerordentlich mächtige Anregungen
von den Anhängern des im 12. Jh entdeckten Aristote-
les.33 Mit seinen metalogischen Schriften wurde man
durch Vermittlung der Araber und der Übersetzungen
Gerards von Cremona vertraut. Die Übersetzungen der
wissenschaftlichen Traktate von Stagrite und seiner
arabischen Kommentatoren tauchten auf an der um
1200 gegründeten Pariser Universität, der wichtigsten
Hochschule des mittelalterlichen Europa. Aristoteles’
Ansichten begannen der christlichen Theologie zu
drohen, weil sie die Provinzialsynode in Paris 1210 mit
dem Interdikt belegte.34 Bei Kirchenbannstrafe verbot
man in Paris, sowohl privat als auch öffentlich,
aristotelische Philosophie zu unterrichten, besonders
Physik. Universitätsstatut aus dem Jahre 1215 erhält
das Verbot aufrecht, „Metaphysik“, alle Bücher aus
dem Bereich der Physik und Naturwissenschaften als
auch ihre Kommentatoren zu unterrichten. Man durfte
aber, wie zuvor, Logik lesen, was eine sonderbare
Situation schuf, weil man Logik für richtig hielt, die
Ergebnisse aber ihrer Anwendung für falsch. Die
erwähnten Verbote haben aber ihre Aufgabe nicht
erfüllt, weil Papst Gregor IX, 1231 den Interdikt
erneuert hat, indem er Aristoteles’ „Physik“ zu unter-
richten verbot, aber mit der Bemerkung, nur bis daraus
alle Fehler behoben werden.33 Die Einflüsse dieses
Philosophen ließen sich nicht aufhalten auch auf dem
Gebiet der Anthropologie. Wilhelm von Auxerre (gest.
1231), wie ich weiß, war erster Denker, der die Seele in
aristotelischer Terminologie auffasste: „idem homo
dicitur ad identitatem animae quae est forma et
perfectio hominis“.36
Wachsender Welle der realistischen Philosophie
entspricht die plastische Ausschmückung der Fassade
in der Kathedrale Notre Dame zu Paris, an der die
Arbeiten spätestens um 1210 begonnen haben. Von
diesen Bildsäulen schrieb Sauerländer: „...Pariser
Skulpturen des frühen 13. Jahrhunderts restituierten in
Christlicher Version den griechischen Kanon eines
schönen und edlen Menschen. “57 In der Folge adaptier-
te die Menschenlehre des 13. Jahrhunderts auf unter-
schiedliche Weise den aristotelischen Gedanken von
Materie und Form in Bezug auf den Menschen. Man
kann hier dreihauptsächliche Gruppen von Ansichten
unterscheiden:
1. den Gesichtspunkt des reinen Aristotelismus;
2. die äußerliche augustinisch- aristotelische Verbin-
dung von Leib und Seele;
3. metaphysische Modifizierung des Aristotelismus für
christlichen Bedarf.
Sinn der aristotelischen Lehre beruhte darauf, daß er
der Form unselbständiges Dasein angab. Die ausge-
sprochene Mehrheit der Scholastiker konnte es nicht
mit dem Dogma der Unsterblichkeit der Seele in
Übereinstimmung bringen, deswegen bezeichneten sie
die Seele als eine selbständige Substanz. Duns Scotus z.
B., der nah Aristoteles’ Ansicht war, nam, Thomas von
Aquino zuwider, Mehrheit von Formen in dem Men-
schen an.38 Die Einheit der substanziellen Form in
jedem compositum dagegen gehörte zu den Grundthe-
sen der Ontologie von Thomas von Aquino. Thomas
lehnte nämlich das Bild einer denkenden Seele ab, die
Subjekt der geistlichen Tätigkeit war, und übergeord-
net der vegetativ-sensuellen Seele, die Leib belebt, und
die nach dem Tod des Menschen, sich von der
untergeordneten Seele getrennt, selbständig unzerstör-
bar existiert — was Wesen der augustinischen Ansich-
ten war. Thomas’ substanzielle Form (also Seele im
Falle des Menschen) verbindet sich unmittelbar mit der
ersten Materie, also jede Bestimmung des entstandenen
komplexen Seins, d. h. der materialen Substanz, muß
der substanziellen Form entstammen.39 Auf diese Weise
konnte Thomas das Sein durch Materie individualisie-
ren, wem andere Theologen grundsätzlich abgeneigt
waren.60 Scotus erfaßte das anders, indem er behaupte-
te, die Individualisierung verursacht der Faktor,
manchmal Materie genannt, er steht aber der Form
näher; ein Faktor, der sich etwas anschließt, was sich
aus Materie und Form zusammensetzt. Scotus’ Anhän-
ger behaupteten, daß man die erste Materie mit dem
menschlichen Leib identifizieren soll, mit dem sich
körperliche Form verbindet — forma corporeitatis. Erst
82