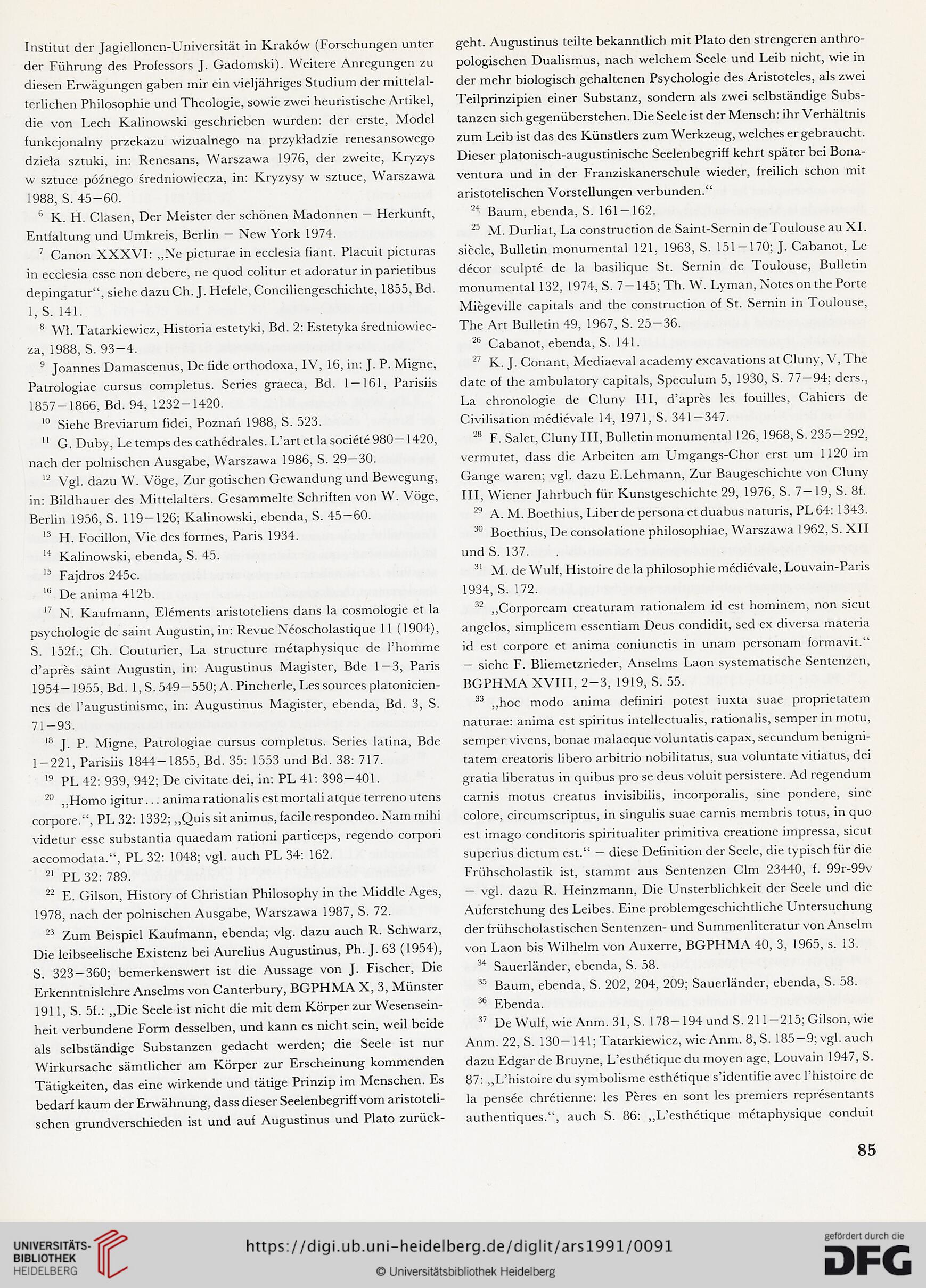Institut der Jagiellonen-Universität in Krakow (Forschungen unter
der Führung des Professors J. Gadomski). Weitere Anregungen zu
diesen Erwägungen gaben mir ein vieljähriges Studium der mittelal-
terlichen Philosophie und Theologie, sowie zwei heuristische Artikel,
die von Lech Kalinowski geschrieben wurden: der erste, Model
funkcjonalny przekazu wizualnego na przykladzie renesansowego
dziela sztuki, in: Renesans, Warszawa 1976, der zweite, Kryzys
w sztuce póžnego šredniowiecza, in: Kryzysy w sztuce, Warszawa
1988, S. 45-60.
6 K. H. Clasen, Der Meister der schönen Madonnen — Herkunft,
Entfaltung und Umkreis, Berlin — New York 1974.
7 Canon XXXVI: „Ne picturae in ecclesia fiant. Placuit picturas
in ecclesia esse non debere, ne quod colitur et adoratur in parietibus
depingatur“, siehe dazu Ch. J. Hefele, Conciliengeschichte, 1855, Bd.
1, S. 141.
8 Wl. Tatarkiewicz, Historia estetyki, Bd. 2: Estetyka šredniowiec-
za, 1988, S. 93-4.
9 Joannes Damascenus, De fide orthodoxa, IV, 16, in: J. P. Migne,
Patrologiae cursus completus. Séries graeca, Bd. 1 — 161, Parisiis
1857-1866, Bd. 94, 1232-1420.
10 Siehe Breviarum fidei, Poznaň 1988, S. 523.
11 G. Duby, Le temps des cathédrales. L’art et la société 980—1420,
nach der polnischen Ausgabe, Warszawa 1986, S. 29—30.
12 Vgl. dazu W. Vöge, Zur gotischen Gewandung und Bewegung,
in: Bildhauer des Mittelalters. Gesammelte Schriften von W. Vöge,
Berlin 1956, S. 119—126; Kalinowski, ebenda, S. 45—60.
13 H. Focillon, Vie des formes, Paris 1934.
14 Kalinowski, ebenda, S. 45.
15 Fajdros 245c.
16 De anima 412b.
17 N. Kaufmann, Eléments aristoteliens dans la cosmologie et la
psychologie de saint Augustin, in: Revue Néoscholastique 11 (1904),
S. 152f.; Ch. Couturier, La structure métaphysique de l’homme
d’après saint Augustin, in: Augustinus Magister, Bde 1—3, Paris
1954—1955, Bd. 1, S. 549—550; A. Pincherle, Les sources platonicien-
nes de l’augustinisme, in: Augustinus Magister, ebenda, Bd. 3, S.
71-93.
18 J. P. Migne, Patrologiae cursus completus. Sériés latina, Bde
1—221, Parisiis 1844—1855, Bd. 35: 1553 und Bd. 38: 717.
19 PL 42: 939, 942; De civitate dei, in: PL 41: 398-401.
20 „Homo igitur... anima rationalis est mortali atque terreno utens
corpore.“, PL 32: 1332; ,,Quis sitanimus, facile respondeo. Nam mihi
videtur esse substantia quaedam rationi particeps, regendo corpori
accomodata.“, PL 32: 1048; vgl. auch PL 34: 162.
21 PL 32: 789.
22 E. Gilson, History of Christian Philosophy in the Middle Ages,
1978, nach der polnischen Ausgabe, Warszawa 1987, S. 72.
23 Zum Beispiel Kaufmann, ebenda; vlg. dazu auch R. Schwarz,
Die leibseelische Existenz bei Aurelius Augustinus, Ph. J. 63 (1954),
S. 323—360; bemerkenswert ist die Aussage von J. Fischer, Die
Erkenntnislehre Anselms von Canterbury, BGPHMA X, 3, Münster
1911, S. 5f.: „Die Seele ist nicht die mit dem Körper zur Wesensein-
heit verbundene Form desselben, und kann es nicht sein, weil beide
als selbständige Substanzen gedacht werden; die Seele ist nur
Wirkursache sämtlicher am Körper zur Erscheinung kommenden
Tätigkeiten, das eine wirkende und tätige Prinzip im Menschen. Es
bedarf kaum der Erwähnung, dass dieser Seelenbegriff vom aristoteli-
schen grundverschieden ist und auf Augustinus und Plato zurück-
geht. Augustinus teilte bekanntlich mit Plato den strengeren anthro-
pologischen Dualismus, nach welchem Seele und Leib nicht, wie in
der mehr biologisch gehaltenen Psychologie des Aristoteles, als zwei
Teilprinzipien einer Substanz, sondern als zwei selbständige Subs-
tanzen sich gegenüberstehen. Die Seele ist der Mensch: ihr Verhältnis
zum Leib ist das des Künstlers zum Werkzeug, welches er gebraucht.
Dieser platonisch-augustinische Seelenbegriff kehrt später bei Bona-
ventura und in der Franziskanerschule wieder, freilich schon mit
aristotelischen Vorstellungen verbunden.“
24 Baum, ebenda, S. 161 — 162.
25 M. Durliat, La construction de Saint-Sernin de Toulouse au XI.
siècle, Bulletin monumental 121, 1963, S. 151 — 170; J. Cabanot, Le
décor sculpté de la basilique St. Sernin de Toulouse, Bulletin
monumental 132, 1974, S. 7—145; Th. W. Lyman, Notes on the Porte
Miègeville capitals and the construction of St. Sernin in Toulouse,
The Art Bulletin 49, 1967, S. 25-36.
26 Cabanot, ebenda, S. 141.
27 K. J. Conant, Mediaeval academy excavations at Cluny, V, The
date of the ambulatory capitals, Spéculum 5, 1930, S. 77—94; ders.,
La chronologie de Cluny III, d’après les fouilles, Cahiers de
Civilisation médiévale 14, 1971, S. 341—347.
28 F. Salet, Cluny III, Bulletin monumental 126, 1968, S. 235—292,
vermutet, dass die Arbeiten am Umgangs-Chor erst um 1120 im
Gange waren; vgl. dazu E.Lehmann, Zur Baugeschichte von Cluny
III, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 29, 1976, S. 7—19, S. 8f.
29 A. M. Boethius, Liber de persona et duabus naturis, PL 64: 1343.
30 Boethius, De consolatione philosophiae, Warszawa 1962, S. XII
und S. 137.
31 M. de Wulf, Histoire de la philosophie médiévale, Louvain-Paris
1934, S. 172.
32 „Corpoream creaturam rationalem id est hominem, non sicut
angelos, simplicem essentiam Deus condidit, sed ex diversa materia
id est corpore et anima coniunctis in unam personam formavit.“
— siehe F. Bliemetzrieder, Anselms Laon systematische Sentenzen,
BGPHMA XVIII, 2-3, 1919, S. 55.
33 „hoc modo anima definiri potest iuxta suae proprietatem
naturae: anima est spiritus intellectualis, rationalis, semper in motu,
semper vivens, bonae malaeque voluntatis capax, secundum benigni-
tatem creatoris libero arbitrio nobilitatus, sua voluntate vitiatus, dei
gratia liberatus in quibus pro se deus voluit persistere. Ad regendum
carnis motus creatus invisibilis, incorporalis, sine pondéré, sine
colore, circumscriptus, in singulis suae carnis membris totus, in quo
est imago conditoris spiritualiter primitiva creatione impressa, sicut
superius dictum est.“ — diese Definition der Seele, die typisch für die
Frühscholastik ist, stammt aus Sentenzen Clm 23440, f. 99r-99v
— vgl. dazu R. Heinzmann, Die Unsterblichkeit der Seele und die
Auferstehung des Leibes. Eine problemgeschichtliche Untersuchung
der frühscholastischen Sentenzen- und Summenliteratur von Anselm
von Laon bis Wilhelm von Auxerre, BGPHMA 40, 3, 1965, s. 13.
34 Sauerländer, ebenda, S. 58.
35 Baum, ebenda, S. 202, 204, 209; Sauerländer, ebenda, S. 58.
36 Ebenda.
37 De Wulf, wie Anm. 31, S. 178—194 und S. 211 —215; Gilson, wie
Anm. 22, S. 130—141; Tatarkiewicz, wie Anm. 8, S. 185—9; vgl. auch
dazu Edgar de Bruyne, L’esthétique du moyen âge, Louvain 1947, S.
87: „L’histoire du symbolisme esthétique s’identifie avec l’histoire de
la pensée chrétienne: les Pères en sont les premiers représentants
authentiques.“, auch S. 86: „L’esthétique métaphysique conduit
85
der Führung des Professors J. Gadomski). Weitere Anregungen zu
diesen Erwägungen gaben mir ein vieljähriges Studium der mittelal-
terlichen Philosophie und Theologie, sowie zwei heuristische Artikel,
die von Lech Kalinowski geschrieben wurden: der erste, Model
funkcjonalny przekazu wizualnego na przykladzie renesansowego
dziela sztuki, in: Renesans, Warszawa 1976, der zweite, Kryzys
w sztuce póžnego šredniowiecza, in: Kryzysy w sztuce, Warszawa
1988, S. 45-60.
6 K. H. Clasen, Der Meister der schönen Madonnen — Herkunft,
Entfaltung und Umkreis, Berlin — New York 1974.
7 Canon XXXVI: „Ne picturae in ecclesia fiant. Placuit picturas
in ecclesia esse non debere, ne quod colitur et adoratur in parietibus
depingatur“, siehe dazu Ch. J. Hefele, Conciliengeschichte, 1855, Bd.
1, S. 141.
8 Wl. Tatarkiewicz, Historia estetyki, Bd. 2: Estetyka šredniowiec-
za, 1988, S. 93-4.
9 Joannes Damascenus, De fide orthodoxa, IV, 16, in: J. P. Migne,
Patrologiae cursus completus. Séries graeca, Bd. 1 — 161, Parisiis
1857-1866, Bd. 94, 1232-1420.
10 Siehe Breviarum fidei, Poznaň 1988, S. 523.
11 G. Duby, Le temps des cathédrales. L’art et la société 980—1420,
nach der polnischen Ausgabe, Warszawa 1986, S. 29—30.
12 Vgl. dazu W. Vöge, Zur gotischen Gewandung und Bewegung,
in: Bildhauer des Mittelalters. Gesammelte Schriften von W. Vöge,
Berlin 1956, S. 119—126; Kalinowski, ebenda, S. 45—60.
13 H. Focillon, Vie des formes, Paris 1934.
14 Kalinowski, ebenda, S. 45.
15 Fajdros 245c.
16 De anima 412b.
17 N. Kaufmann, Eléments aristoteliens dans la cosmologie et la
psychologie de saint Augustin, in: Revue Néoscholastique 11 (1904),
S. 152f.; Ch. Couturier, La structure métaphysique de l’homme
d’après saint Augustin, in: Augustinus Magister, Bde 1—3, Paris
1954—1955, Bd. 1, S. 549—550; A. Pincherle, Les sources platonicien-
nes de l’augustinisme, in: Augustinus Magister, ebenda, Bd. 3, S.
71-93.
18 J. P. Migne, Patrologiae cursus completus. Sériés latina, Bde
1—221, Parisiis 1844—1855, Bd. 35: 1553 und Bd. 38: 717.
19 PL 42: 939, 942; De civitate dei, in: PL 41: 398-401.
20 „Homo igitur... anima rationalis est mortali atque terreno utens
corpore.“, PL 32: 1332; ,,Quis sitanimus, facile respondeo. Nam mihi
videtur esse substantia quaedam rationi particeps, regendo corpori
accomodata.“, PL 32: 1048; vgl. auch PL 34: 162.
21 PL 32: 789.
22 E. Gilson, History of Christian Philosophy in the Middle Ages,
1978, nach der polnischen Ausgabe, Warszawa 1987, S. 72.
23 Zum Beispiel Kaufmann, ebenda; vlg. dazu auch R. Schwarz,
Die leibseelische Existenz bei Aurelius Augustinus, Ph. J. 63 (1954),
S. 323—360; bemerkenswert ist die Aussage von J. Fischer, Die
Erkenntnislehre Anselms von Canterbury, BGPHMA X, 3, Münster
1911, S. 5f.: „Die Seele ist nicht die mit dem Körper zur Wesensein-
heit verbundene Form desselben, und kann es nicht sein, weil beide
als selbständige Substanzen gedacht werden; die Seele ist nur
Wirkursache sämtlicher am Körper zur Erscheinung kommenden
Tätigkeiten, das eine wirkende und tätige Prinzip im Menschen. Es
bedarf kaum der Erwähnung, dass dieser Seelenbegriff vom aristoteli-
schen grundverschieden ist und auf Augustinus und Plato zurück-
geht. Augustinus teilte bekanntlich mit Plato den strengeren anthro-
pologischen Dualismus, nach welchem Seele und Leib nicht, wie in
der mehr biologisch gehaltenen Psychologie des Aristoteles, als zwei
Teilprinzipien einer Substanz, sondern als zwei selbständige Subs-
tanzen sich gegenüberstehen. Die Seele ist der Mensch: ihr Verhältnis
zum Leib ist das des Künstlers zum Werkzeug, welches er gebraucht.
Dieser platonisch-augustinische Seelenbegriff kehrt später bei Bona-
ventura und in der Franziskanerschule wieder, freilich schon mit
aristotelischen Vorstellungen verbunden.“
24 Baum, ebenda, S. 161 — 162.
25 M. Durliat, La construction de Saint-Sernin de Toulouse au XI.
siècle, Bulletin monumental 121, 1963, S. 151 — 170; J. Cabanot, Le
décor sculpté de la basilique St. Sernin de Toulouse, Bulletin
monumental 132, 1974, S. 7—145; Th. W. Lyman, Notes on the Porte
Miègeville capitals and the construction of St. Sernin in Toulouse,
The Art Bulletin 49, 1967, S. 25-36.
26 Cabanot, ebenda, S. 141.
27 K. J. Conant, Mediaeval academy excavations at Cluny, V, The
date of the ambulatory capitals, Spéculum 5, 1930, S. 77—94; ders.,
La chronologie de Cluny III, d’après les fouilles, Cahiers de
Civilisation médiévale 14, 1971, S. 341—347.
28 F. Salet, Cluny III, Bulletin monumental 126, 1968, S. 235—292,
vermutet, dass die Arbeiten am Umgangs-Chor erst um 1120 im
Gange waren; vgl. dazu E.Lehmann, Zur Baugeschichte von Cluny
III, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 29, 1976, S. 7—19, S. 8f.
29 A. M. Boethius, Liber de persona et duabus naturis, PL 64: 1343.
30 Boethius, De consolatione philosophiae, Warszawa 1962, S. XII
und S. 137.
31 M. de Wulf, Histoire de la philosophie médiévale, Louvain-Paris
1934, S. 172.
32 „Corpoream creaturam rationalem id est hominem, non sicut
angelos, simplicem essentiam Deus condidit, sed ex diversa materia
id est corpore et anima coniunctis in unam personam formavit.“
— siehe F. Bliemetzrieder, Anselms Laon systematische Sentenzen,
BGPHMA XVIII, 2-3, 1919, S. 55.
33 „hoc modo anima definiri potest iuxta suae proprietatem
naturae: anima est spiritus intellectualis, rationalis, semper in motu,
semper vivens, bonae malaeque voluntatis capax, secundum benigni-
tatem creatoris libero arbitrio nobilitatus, sua voluntate vitiatus, dei
gratia liberatus in quibus pro se deus voluit persistere. Ad regendum
carnis motus creatus invisibilis, incorporalis, sine pondéré, sine
colore, circumscriptus, in singulis suae carnis membris totus, in quo
est imago conditoris spiritualiter primitiva creatione impressa, sicut
superius dictum est.“ — diese Definition der Seele, die typisch für die
Frühscholastik ist, stammt aus Sentenzen Clm 23440, f. 99r-99v
— vgl. dazu R. Heinzmann, Die Unsterblichkeit der Seele und die
Auferstehung des Leibes. Eine problemgeschichtliche Untersuchung
der frühscholastischen Sentenzen- und Summenliteratur von Anselm
von Laon bis Wilhelm von Auxerre, BGPHMA 40, 3, 1965, s. 13.
34 Sauerländer, ebenda, S. 58.
35 Baum, ebenda, S. 202, 204, 209; Sauerländer, ebenda, S. 58.
36 Ebenda.
37 De Wulf, wie Anm. 31, S. 178—194 und S. 211 —215; Gilson, wie
Anm. 22, S. 130—141; Tatarkiewicz, wie Anm. 8, S. 185—9; vgl. auch
dazu Edgar de Bruyne, L’esthétique du moyen âge, Louvain 1947, S.
87: „L’histoire du symbolisme esthétique s’identifie avec l’histoire de
la pensée chrétienne: les Pères en sont les premiers représentants
authentiques.“, auch S. 86: „L’esthétique métaphysique conduit
85