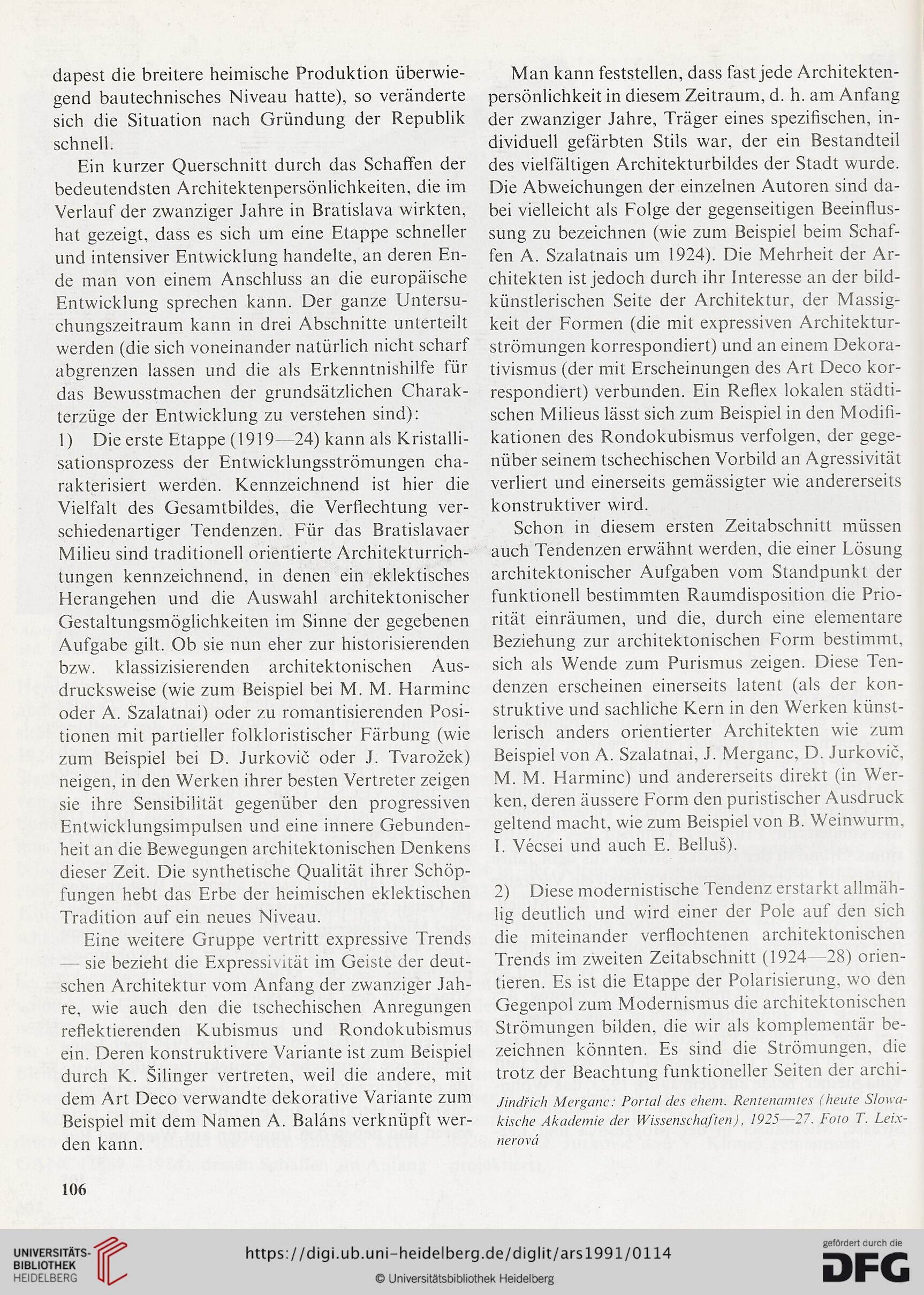dapest die breitere heimische Produktion überwie-
gend bautechnisches Niveau hatte), so veränderte
sich die Situation nach Gründung der Republik
schnell.
Ein kurzer Querschnitt durch das Schaffen der
bedeutendsten Architektenpersönlichkeiten, die im
Verlauf der zwanziger Jahre in Bratislava wirkten,
hat gezeigt, dass es sich um eine Etappe schneller
und intensiver Entwicklung handelte, an deren En-
de man von einem Anschluss an die europäische
Entwicklung sprechen kann. Der ganze Untersu-
chungszeitraum kann in drei Abschnitte unterteilt
werden (die sich voneinander natürlich nicht scharf
abgrenzen lassen und die als Erkenntnishilfe für
das Bewusstmachen der grundsätzlichen Charak-
terzüge der Entwicklung zu verstehen sind):
1) Die erste Etappe (1919 24) kann als Kristalli-
sationsprozess der Entwicklungsströmungen cha-
rakterisiert werden. Kennzeichnend ist hier die
Vielfalt des Gesamtbildes, die Verflechtung ver-
schiedenartiger Tendenzen. Für das Bratislavaer
Milieu sind traditionell orientierte Architekturrich-
tungen kennzeichnend, in denen ein eklektisches
Herangehen und die Auswahl architektonischer
Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne der gegebenen
Aufgabe gilt. Ob sie nun eher zur historisierenden
bzw. klassizisierenden architektonischen Aus-
drucksweise (wie zum Beispiel bei M. M. Harminc
oder A. Szalatnai) oder zu romantisierenden Posi-
tionen mit partieller folkloristischer Färbung (wie
zum Beispiel bei D. Jurkovič oder J. Tvarožek)
neigen, in den Werken ihrer besten Vertreter zeigen
sie ihre Sensibilität gegenüber den progressiven
Entwicklungsimpulsen und eine innere Gebunden-
heit an die Bewegungen architektonischen Denkens
dieser Zeit. Die synthetische Qualität ihrer Schöp-
fungen hebt das Erbe der heimischen eklektischen
Tradition auf ein neues Niveau.
Eine weitere Gruppe vertritt expressive Trends
— sie bezieht die Expressivität im Geiste der deut-
schen Architektur vom Anfang der zwanziger Jah-
re, wie auch den die tschechischen Anregungen
reflektierenden Kubismus und Rondokubismus
ein. Deren konstruktivere Variante ist zum Beispiel
durch K. Šilinger vertreten, weil die andere, mit
dem Art Deco verwandte dekorative Variante zum
Beispiel mit dem Namen A. Baláns verknüpft wer-
den kann.
Man kann feststellen, dass fast jede Architekten-
persönlichkeit in diesem Zeitraum, d. h. am Anfang
der zwanziger Jahre, Träger eines spezifischen, in-
dividuell gefärbten Stils war, der ein Bestandteil
des vielfältigen Architekturbildes der Stadt wurde.
Die Abweichungen der einzelnen Autoren sind da-
bei vielleicht als Folge der gegenseitigen Beeinflus-
sung zu bezeichnen (wie zum Beispiel beim Schaf-
fen A. Szalatnais um 1924). Die Mehrheit der Ar-
chitekten ist jedoch durch ihr Interesse an der bild-
künstlerischen Seite der Architektur, der Massig-
keit der Formen (die mit expressiven Architektur-
strömungen korrespondiert) und an einem Dekora-
tivismus (der mit Erscheinungen des Art Deco kor-
respondiert) verbunden. Ein Reflex lokalen städti-
schen Milieus lässt sich zum Beispiel in den Modifi-
kationen des Rondokubismus verfolgen, der gege-
nüber seinem tschechischen Vorbild an Agressivität
verliert und einerseits gemässigter wie andererseits
konstruktiver wird.
Schon in diesem ersten Zeitabschnitt müssen
auch Tendenzen erwähnt werden, die einer Lösung
architektonischer Aufgaben vom Standpunkt der
funktionell bestimmten Raumdisposition die Prio-
rität einräumen, und die, durch eine elementare
Beziehung zur architektonischen Form bestimmt,
sich als Wende zum Purismus zeigen. Diese Ten-
denzen erscheinen einerseits latent (als der kon-
struktive und sachliche Kern in den Werken künst-
lerisch anders orientierter Architekten wie zum
Beispiel von A. Szalatnai, J. Merganc, D. Jurkovič,
M. M. Harminc) und andererseits direkt (in Wer-
ken, deren äussere Form den puristischer Ausdruck
geltend macht, wie zum Beispiel von B. Weinwurm,
I. Vécsei und auch E. Belluš).
2) Diese modernistische Tendenz erstarkt allmäh-
lig deutlich und wird einer der Pole auf den sich
die miteinander verflochtenen architektonischen
Trends im zweiten Zeitabschnitt (1924—28) orien-
tieren. Es ist die Etappe der Polarisierung, wo den
Gegenpol zum Modernismus die architektonischen
Strömungen bilden, die wir als komplementär be-
zeichnen könnten. Es sind die Strömungen, die
trotz der Beachtung funktioneller Seiten der archi-
Jindřich Merganc: Portal des ehern. Rentenamtes (heute Slowa-
kische Akademie der Wissenschaften), 1925—27. Foto T. Leix-
nerová
106
gend bautechnisches Niveau hatte), so veränderte
sich die Situation nach Gründung der Republik
schnell.
Ein kurzer Querschnitt durch das Schaffen der
bedeutendsten Architektenpersönlichkeiten, die im
Verlauf der zwanziger Jahre in Bratislava wirkten,
hat gezeigt, dass es sich um eine Etappe schneller
und intensiver Entwicklung handelte, an deren En-
de man von einem Anschluss an die europäische
Entwicklung sprechen kann. Der ganze Untersu-
chungszeitraum kann in drei Abschnitte unterteilt
werden (die sich voneinander natürlich nicht scharf
abgrenzen lassen und die als Erkenntnishilfe für
das Bewusstmachen der grundsätzlichen Charak-
terzüge der Entwicklung zu verstehen sind):
1) Die erste Etappe (1919 24) kann als Kristalli-
sationsprozess der Entwicklungsströmungen cha-
rakterisiert werden. Kennzeichnend ist hier die
Vielfalt des Gesamtbildes, die Verflechtung ver-
schiedenartiger Tendenzen. Für das Bratislavaer
Milieu sind traditionell orientierte Architekturrich-
tungen kennzeichnend, in denen ein eklektisches
Herangehen und die Auswahl architektonischer
Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne der gegebenen
Aufgabe gilt. Ob sie nun eher zur historisierenden
bzw. klassizisierenden architektonischen Aus-
drucksweise (wie zum Beispiel bei M. M. Harminc
oder A. Szalatnai) oder zu romantisierenden Posi-
tionen mit partieller folkloristischer Färbung (wie
zum Beispiel bei D. Jurkovič oder J. Tvarožek)
neigen, in den Werken ihrer besten Vertreter zeigen
sie ihre Sensibilität gegenüber den progressiven
Entwicklungsimpulsen und eine innere Gebunden-
heit an die Bewegungen architektonischen Denkens
dieser Zeit. Die synthetische Qualität ihrer Schöp-
fungen hebt das Erbe der heimischen eklektischen
Tradition auf ein neues Niveau.
Eine weitere Gruppe vertritt expressive Trends
— sie bezieht die Expressivität im Geiste der deut-
schen Architektur vom Anfang der zwanziger Jah-
re, wie auch den die tschechischen Anregungen
reflektierenden Kubismus und Rondokubismus
ein. Deren konstruktivere Variante ist zum Beispiel
durch K. Šilinger vertreten, weil die andere, mit
dem Art Deco verwandte dekorative Variante zum
Beispiel mit dem Namen A. Baláns verknüpft wer-
den kann.
Man kann feststellen, dass fast jede Architekten-
persönlichkeit in diesem Zeitraum, d. h. am Anfang
der zwanziger Jahre, Träger eines spezifischen, in-
dividuell gefärbten Stils war, der ein Bestandteil
des vielfältigen Architekturbildes der Stadt wurde.
Die Abweichungen der einzelnen Autoren sind da-
bei vielleicht als Folge der gegenseitigen Beeinflus-
sung zu bezeichnen (wie zum Beispiel beim Schaf-
fen A. Szalatnais um 1924). Die Mehrheit der Ar-
chitekten ist jedoch durch ihr Interesse an der bild-
künstlerischen Seite der Architektur, der Massig-
keit der Formen (die mit expressiven Architektur-
strömungen korrespondiert) und an einem Dekora-
tivismus (der mit Erscheinungen des Art Deco kor-
respondiert) verbunden. Ein Reflex lokalen städti-
schen Milieus lässt sich zum Beispiel in den Modifi-
kationen des Rondokubismus verfolgen, der gege-
nüber seinem tschechischen Vorbild an Agressivität
verliert und einerseits gemässigter wie andererseits
konstruktiver wird.
Schon in diesem ersten Zeitabschnitt müssen
auch Tendenzen erwähnt werden, die einer Lösung
architektonischer Aufgaben vom Standpunkt der
funktionell bestimmten Raumdisposition die Prio-
rität einräumen, und die, durch eine elementare
Beziehung zur architektonischen Form bestimmt,
sich als Wende zum Purismus zeigen. Diese Ten-
denzen erscheinen einerseits latent (als der kon-
struktive und sachliche Kern in den Werken künst-
lerisch anders orientierter Architekten wie zum
Beispiel von A. Szalatnai, J. Merganc, D. Jurkovič,
M. M. Harminc) und andererseits direkt (in Wer-
ken, deren äussere Form den puristischer Ausdruck
geltend macht, wie zum Beispiel von B. Weinwurm,
I. Vécsei und auch E. Belluš).
2) Diese modernistische Tendenz erstarkt allmäh-
lig deutlich und wird einer der Pole auf den sich
die miteinander verflochtenen architektonischen
Trends im zweiten Zeitabschnitt (1924—28) orien-
tieren. Es ist die Etappe der Polarisierung, wo den
Gegenpol zum Modernismus die architektonischen
Strömungen bilden, die wir als komplementär be-
zeichnen könnten. Es sind die Strömungen, die
trotz der Beachtung funktioneller Seiten der archi-
Jindřich Merganc: Portal des ehern. Rentenamtes (heute Slowa-
kische Akademie der Wissenschaften), 1925—27. Foto T. Leix-
nerová
106