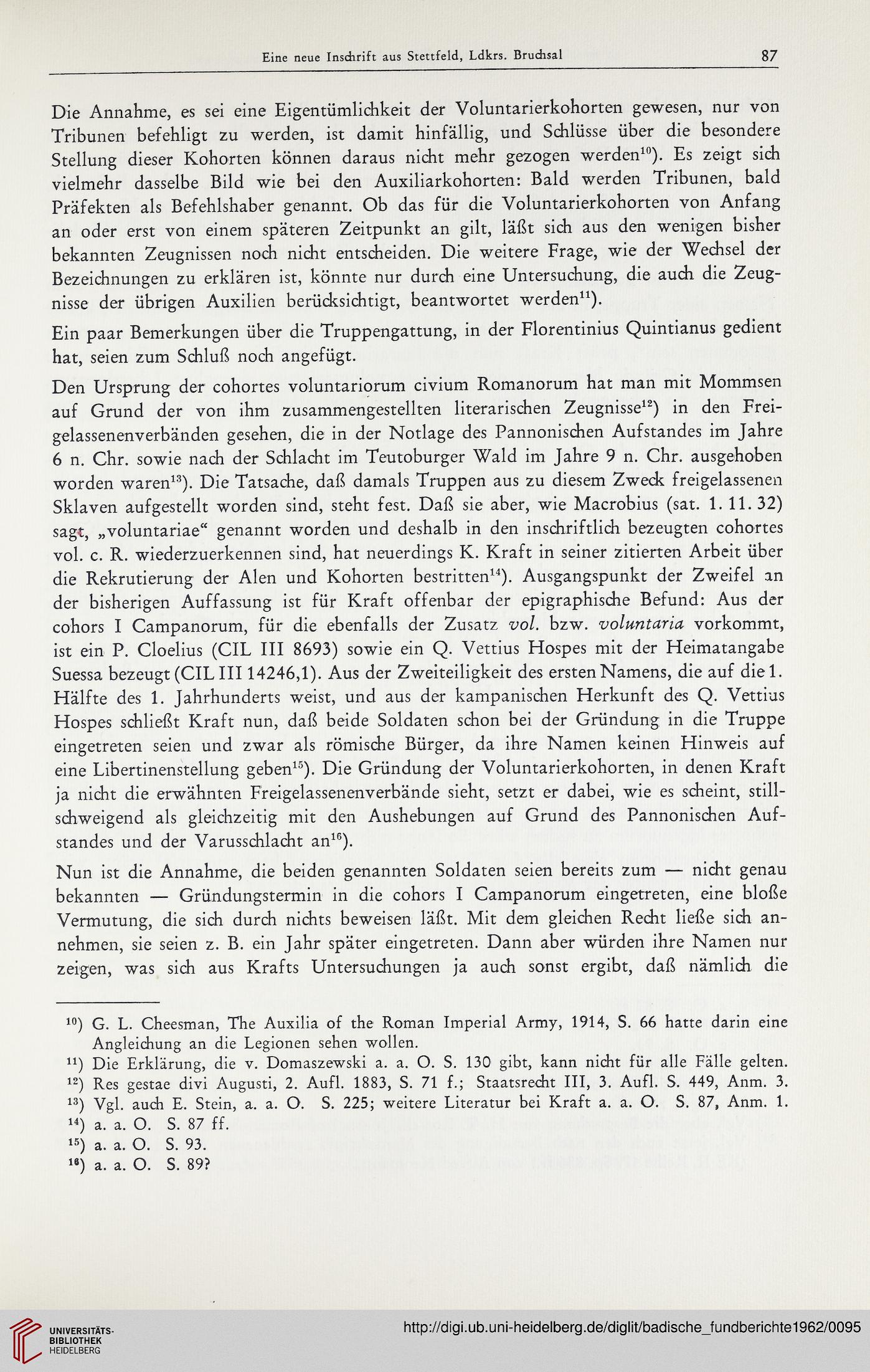Eine neue Inschrift aus Stettfeld, Ldkrs. Bruchsal
87
Die Annahme, es sei eine Eigentümlichkeit der Voluntarierkohorten gewesen, nur von
Tribunen befehligt zu werden, ist damit hinfällig, und Schlüsse über die besondere
Stellung dieser Kohorten können daraus nicht mehr gezogen werden10). Es zeigt sich
vielmehr dasselbe Bild wie bei den Auxiliarkohorten: Bald werden Tribunen, bald
Präfekten als Befehlshaber genannt. Ob das für die Voluntarierkohorten von Anfang
an oder erst von einem späteren Zeitpunkt an gilt, läßt sich aus den wenigen bisher
bekannten Zeugnissen noch nicht entscheiden. Die weitere Frage, wie der Wechsel der
Bezeichnungen zu erklären ist, könnte nur durch eine Untersuchung, die auch die Zeug-
nisse der übrigen Auxilien berücksichtigt, beantwortet werden11).
Ein paar Bemerkungen über die Truppengattung, in der Florentinius Quintianus gedient
hat, seien zum Schluß noch angefügt.
Den Ursprung der cohortes voluntariorum civium Romanorum hat man mit Mommsen
auf Grund der von ihm zusammengestellten literarischen Zeugnisse12) in den Frei-
gelassenenverbänden gesehen, die in der Notlage des Pannonischen Auf Standes im Jahre
6 n. Chr. sowie nach der Schlacht im Teutoburger Wald im Jahre 9 n. Chr. ausgehoben
worden waren13). Die Tatsache, daß damals Truppen aus zu diesem Zweck freigelassenen
Sklaven aufgestellt worden sind, steht fest. Daß sie aber, wie Macrobius (sat. 1.11. 32)
sagt, „voluntariae“ genannt worden und deshalb in den inschriftlich bezeugten cohortes
vol. c. R. wiederzuerkennen sind, hat neuerdings K. Kraft in seiner zitierten Arbeit über
die Rekrutierung der Alen und Kohorten bestritten14). Ausgangspunkt der Zweifel an
der bisherigen Auffassung ist für Kraft offenbar der epigraphische Befund: Aus der
cohors I Campanorum, für die ebenfalls der Zusatz vol. bzw. volimtaria. vorkommt,
ist ein P. Cloelius (CIL III 8693) sowie ein Q. Vettius Hospes mit der Heimatangabe
Suessa bezeugt (CIL III 14246,1). Aus der Zweiteiligkeit des ersten Namens, die auf diel.
Hälfte des 1. Jahrhunderts weist, und aus der kampanischen Herkunft des Q. Vettius
Hospes schließt Kraft nun, daß beide Soldaten schon bei der Gründung in die Truppe
eingetreten seien und zwar als römische Bürger, da ihre Namen keinen Hinweis auf
eine Libertinenstellung geben15). Die Gründung der Voluntarierkohorten, in denen Kraft
ja nicht die erwähnten Freigelassenenverbände sieht, setzt er dabei, wie es scheint, still-
schweigend als gleichzeitig mit den Aushebungen auf Grund des Pannonischen Auf-
standes und der Varusschlacht an16).
Nun ist die Annahme, die beiden genannten Soldaten seien bereits zum — nicht genau
bekannten — Gründungstermin in die cohors I Campanorum eingetreten, eine bloße
Vermutung, die sich durch nichts beweisen läßt. Mit dem gleichen Recht ließe sich an-
nehmen, sie seien z. B. ein Jahr später eingetreten. Dann aber würden ihre Namen nur
zeigen, was sich aus Krafts Untersuchungen ja auch sonst ergibt, daß nämlich die
10) G. L. Cheesman, The Auxilia of the Roman Imperial Army, 1914, S. 66 hatte darin eine
Angleichung an die Legionen sehen wollen.
u) Die Erklärung, die v. Domaszewski a. a. O. S. 130 gibt, kann nicht für alle Fälle gelten.
12) Res gestae divi Augusti, 2. Aufl. 1883, S. 71 f.; Staatsrecht III, 3. Aufl. S. 449, Anm. 3.
13) Vgl. auch E. Stein, a. a. O. S. 225; weitere Literatur bei Kraft a. a. O. S. 87, Anm. 1.
14) a. a. O. S. 87 ff.
15) a. a. O. S. 93.
18) a. a. O. S. 89?
87
Die Annahme, es sei eine Eigentümlichkeit der Voluntarierkohorten gewesen, nur von
Tribunen befehligt zu werden, ist damit hinfällig, und Schlüsse über die besondere
Stellung dieser Kohorten können daraus nicht mehr gezogen werden10). Es zeigt sich
vielmehr dasselbe Bild wie bei den Auxiliarkohorten: Bald werden Tribunen, bald
Präfekten als Befehlshaber genannt. Ob das für die Voluntarierkohorten von Anfang
an oder erst von einem späteren Zeitpunkt an gilt, läßt sich aus den wenigen bisher
bekannten Zeugnissen noch nicht entscheiden. Die weitere Frage, wie der Wechsel der
Bezeichnungen zu erklären ist, könnte nur durch eine Untersuchung, die auch die Zeug-
nisse der übrigen Auxilien berücksichtigt, beantwortet werden11).
Ein paar Bemerkungen über die Truppengattung, in der Florentinius Quintianus gedient
hat, seien zum Schluß noch angefügt.
Den Ursprung der cohortes voluntariorum civium Romanorum hat man mit Mommsen
auf Grund der von ihm zusammengestellten literarischen Zeugnisse12) in den Frei-
gelassenenverbänden gesehen, die in der Notlage des Pannonischen Auf Standes im Jahre
6 n. Chr. sowie nach der Schlacht im Teutoburger Wald im Jahre 9 n. Chr. ausgehoben
worden waren13). Die Tatsache, daß damals Truppen aus zu diesem Zweck freigelassenen
Sklaven aufgestellt worden sind, steht fest. Daß sie aber, wie Macrobius (sat. 1.11. 32)
sagt, „voluntariae“ genannt worden und deshalb in den inschriftlich bezeugten cohortes
vol. c. R. wiederzuerkennen sind, hat neuerdings K. Kraft in seiner zitierten Arbeit über
die Rekrutierung der Alen und Kohorten bestritten14). Ausgangspunkt der Zweifel an
der bisherigen Auffassung ist für Kraft offenbar der epigraphische Befund: Aus der
cohors I Campanorum, für die ebenfalls der Zusatz vol. bzw. volimtaria. vorkommt,
ist ein P. Cloelius (CIL III 8693) sowie ein Q. Vettius Hospes mit der Heimatangabe
Suessa bezeugt (CIL III 14246,1). Aus der Zweiteiligkeit des ersten Namens, die auf diel.
Hälfte des 1. Jahrhunderts weist, und aus der kampanischen Herkunft des Q. Vettius
Hospes schließt Kraft nun, daß beide Soldaten schon bei der Gründung in die Truppe
eingetreten seien und zwar als römische Bürger, da ihre Namen keinen Hinweis auf
eine Libertinenstellung geben15). Die Gründung der Voluntarierkohorten, in denen Kraft
ja nicht die erwähnten Freigelassenenverbände sieht, setzt er dabei, wie es scheint, still-
schweigend als gleichzeitig mit den Aushebungen auf Grund des Pannonischen Auf-
standes und der Varusschlacht an16).
Nun ist die Annahme, die beiden genannten Soldaten seien bereits zum — nicht genau
bekannten — Gründungstermin in die cohors I Campanorum eingetreten, eine bloße
Vermutung, die sich durch nichts beweisen läßt. Mit dem gleichen Recht ließe sich an-
nehmen, sie seien z. B. ein Jahr später eingetreten. Dann aber würden ihre Namen nur
zeigen, was sich aus Krafts Untersuchungen ja auch sonst ergibt, daß nämlich die
10) G. L. Cheesman, The Auxilia of the Roman Imperial Army, 1914, S. 66 hatte darin eine
Angleichung an die Legionen sehen wollen.
u) Die Erklärung, die v. Domaszewski a. a. O. S. 130 gibt, kann nicht für alle Fälle gelten.
12) Res gestae divi Augusti, 2. Aufl. 1883, S. 71 f.; Staatsrecht III, 3. Aufl. S. 449, Anm. 3.
13) Vgl. auch E. Stein, a. a. O. S. 225; weitere Literatur bei Kraft a. a. O. S. 87, Anm. 1.
14) a. a. O. S. 87 ff.
15) a. a. O. S. 93.
18) a. a. O. S. 89?