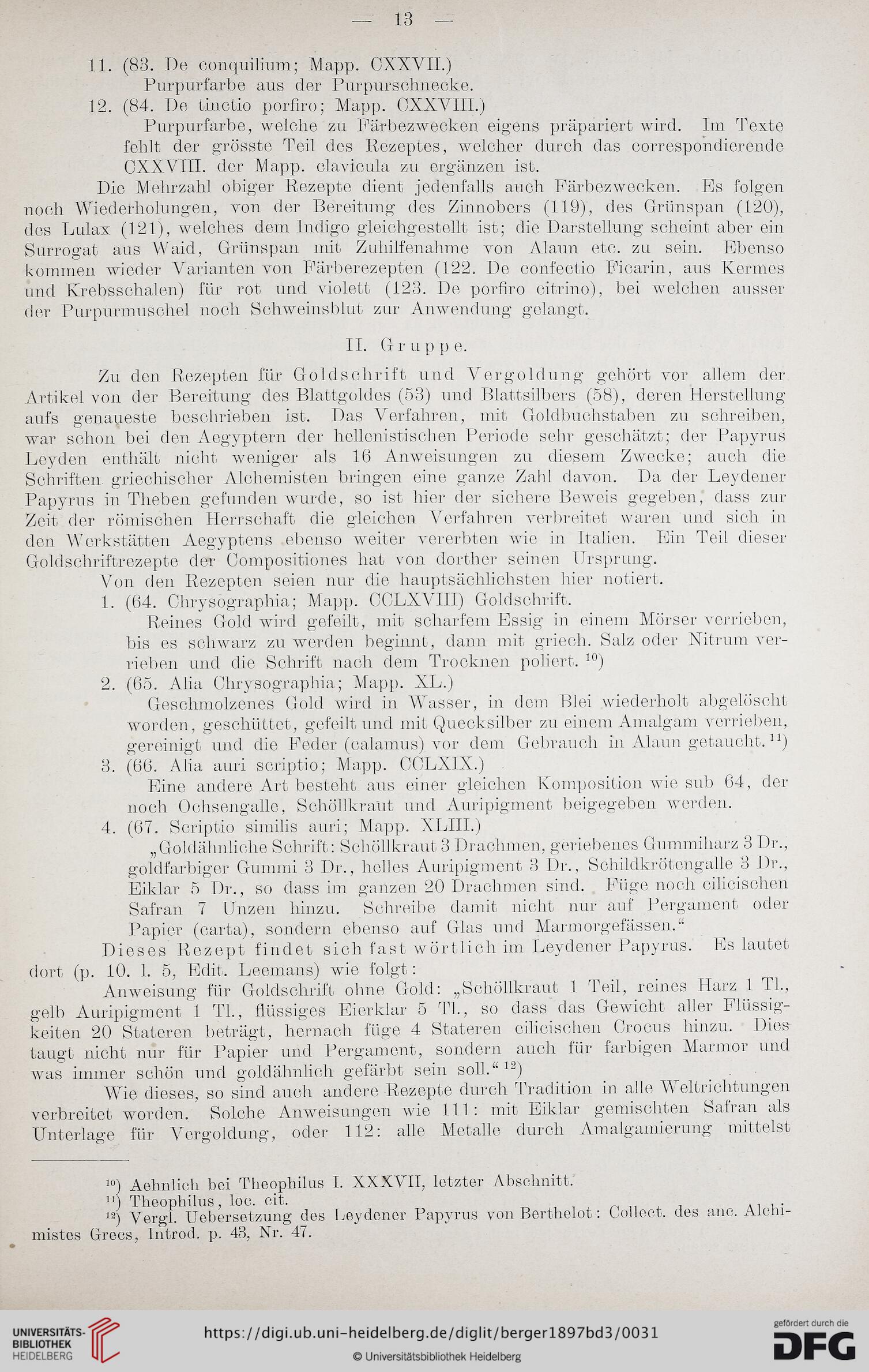13
11. (83. De conquilium; Mapp. OXXVII.)
Purpurfarbe aus der Purpurschnecke.
12. (84. De tinctio porfiro; Mapp. CXXVIII.)
Purpurfarbe, welche zu Färbezwecken eigens präpariert wird. Im Texte
fehlt der grösste Teil des Rezeptes, welcher durch das correspondierende
CXXVIII. der Mapp, clavicula zu ergänzen ist.
Die Mehrzahl obiger Rezepte dient jedenfalls auch Färbezwecken. Es folgen
noch Wiederholungen, von der Bereitung des Zinnobers (119), des Grünspan (120),
des Lulax (121), welches dem Indigo gleichgestellt ist; die Darstellung scheint aber ein
Surrogat aus Waid, Grünspan mit Zuhilfenahme von Alaun etc. zu sein. Ebenso
kommen wieder Varianten von Färberezepten (122. De confectio Ficarin, aus Kermes
und Krebsschalen) für rot und violett (123. De porfiro citrino), bei welchen äusser
der Purpurmuschel noch Schweinsblut zur Anwendung gelangt.
II. Gruppe.
Zu den Rezepten für Goldschrift und Vergoldung gehört vor allem der
Artikel von der Bereitung des Blattgoldes (53) und Blattsilbers (58), deren Herstellung
aufs genaueste beschrieben ist. Das Verfahren, mit Goldbuchstaben zu schreiben,
war schon bei den Aegyptern der hellenistischen Periode sehr geschätzt; der Papyrus
Leyden enthält nicht weniger als 16 Anweisungen zu diesem Zwecke; auch die
Schriften griechischer Alchemisten bringen eine ganze Zahl davon. Da der Leydener
Papyrus in Theben gefunden wurde, so ist hier der sichere Beweis gegeben, dass zur
Zeit der römischen Herrschaft die gleichen Verfahren verbreitet waren und sich in
den Werkstätten Aegyptens ebenso weiter vererbten wie in Italien. Ein Teil dieser
Goldschriftrezepte der Compositiones hat von dorther seinen Ursprung.
Von den Rezepten seien nur die hauptsächlichsten hier notiert.
1. (64. Chrysographia; Mapp. CCLXVIII) Goldschrift.
Reines Gold wird gefeilt, mit scharfem Essig in einem Mörser verrieben,
bis es schwarz zu werden beginnt, dann mit griech. Salz oder Nitrum ver-
rieben und die Schrift nach dem Trocknen poliert. 10 *)
2. (65. Alia Chrysographia; Mapp. XL.)
Geschmolzenes Gold wird in Wasser, in dem Blei wiederholt abgelöscht
worden, geschüttet, gefeilt und mit Quecksilber zu einem Amalgam verrieben,
gereinigt und die Feder (calamus) vor dem Gebrauch in Alaim getaucht.n)
3. (66. Alia auri scriptio; Mapp. CCLXIX.)
Eine andere Art besteht aus einer gleichen Komposition wie sub 64, der
noch Ochsengalle, Schöllkraut und Auripigment beigegeben werden.
4. (67. Scriptio similis auri; Mapp. XLIII.)
„Goldähnliche Schrift: Schöllkraut 3 Drachmen, geriebenes Gummiharz 3 Dr.,
goldfarbiger Gummi 3 Dr., helles Auripigment 3 Dr., Schildkrötengalle 3 Dr.,
Eiklar 5 Dr., so dass im ganzen 20 Drachmen sind. Füge nocli cilicischen
Safran 7 Unzen hinzu. Schreibe damit nicht nur auf Pergament oder
Papier (carta), sondern ebenso auf Glas und Marmorgefässen.“
Dieses Rezept findet sich fast wörtlich im Leydener Papyrus. Es lautet
dort (p. 10. 1. 5, Edit. Leemans) wie folgt:
Anweisung für Goldschrift ohne Gold: „Schöllkraut 1 Teil, reines Harz 1 TL,
gelb Auripigment 1 TL, flüssiges Eierklar 5 TL, so dass das Gewicht aller Flüssig-
keiten 20 Stateren beträgt, hernach füge 4 Stateren cilicischen Crocus hinzu. Dies-
taugt nicht nur für Papier und Pergament, sondern auch für farbigen Marmor und
was immer schön und goldähnlich gefärbt sein soll.“12)
Wie dieses, so sind auch andere Rezepte durch Tradition in alle Weltrichtungen
verbreitet worden. Solche Anweisungen wie 111: mit Eiklar gemischten Safran als
Unterlage für Vergoldung, oder 112: alle Metalle durch Amalgamierung mittelst
10) Aehnlich bei Theophilus I. XXXVII, letzter Abschnitt.
n) Theophilus, loc. cit.
12) Vergl. Uebersetzung des Leydener Papyrus von Berthelot: Collect. des anc. Alchi-
mistes Grecs, Introd. p. 43, Nr. 47.
11. (83. De conquilium; Mapp. OXXVII.)
Purpurfarbe aus der Purpurschnecke.
12. (84. De tinctio porfiro; Mapp. CXXVIII.)
Purpurfarbe, welche zu Färbezwecken eigens präpariert wird. Im Texte
fehlt der grösste Teil des Rezeptes, welcher durch das correspondierende
CXXVIII. der Mapp, clavicula zu ergänzen ist.
Die Mehrzahl obiger Rezepte dient jedenfalls auch Färbezwecken. Es folgen
noch Wiederholungen, von der Bereitung des Zinnobers (119), des Grünspan (120),
des Lulax (121), welches dem Indigo gleichgestellt ist; die Darstellung scheint aber ein
Surrogat aus Waid, Grünspan mit Zuhilfenahme von Alaun etc. zu sein. Ebenso
kommen wieder Varianten von Färberezepten (122. De confectio Ficarin, aus Kermes
und Krebsschalen) für rot und violett (123. De porfiro citrino), bei welchen äusser
der Purpurmuschel noch Schweinsblut zur Anwendung gelangt.
II. Gruppe.
Zu den Rezepten für Goldschrift und Vergoldung gehört vor allem der
Artikel von der Bereitung des Blattgoldes (53) und Blattsilbers (58), deren Herstellung
aufs genaueste beschrieben ist. Das Verfahren, mit Goldbuchstaben zu schreiben,
war schon bei den Aegyptern der hellenistischen Periode sehr geschätzt; der Papyrus
Leyden enthält nicht weniger als 16 Anweisungen zu diesem Zwecke; auch die
Schriften griechischer Alchemisten bringen eine ganze Zahl davon. Da der Leydener
Papyrus in Theben gefunden wurde, so ist hier der sichere Beweis gegeben, dass zur
Zeit der römischen Herrschaft die gleichen Verfahren verbreitet waren und sich in
den Werkstätten Aegyptens ebenso weiter vererbten wie in Italien. Ein Teil dieser
Goldschriftrezepte der Compositiones hat von dorther seinen Ursprung.
Von den Rezepten seien nur die hauptsächlichsten hier notiert.
1. (64. Chrysographia; Mapp. CCLXVIII) Goldschrift.
Reines Gold wird gefeilt, mit scharfem Essig in einem Mörser verrieben,
bis es schwarz zu werden beginnt, dann mit griech. Salz oder Nitrum ver-
rieben und die Schrift nach dem Trocknen poliert. 10 *)
2. (65. Alia Chrysographia; Mapp. XL.)
Geschmolzenes Gold wird in Wasser, in dem Blei wiederholt abgelöscht
worden, geschüttet, gefeilt und mit Quecksilber zu einem Amalgam verrieben,
gereinigt und die Feder (calamus) vor dem Gebrauch in Alaim getaucht.n)
3. (66. Alia auri scriptio; Mapp. CCLXIX.)
Eine andere Art besteht aus einer gleichen Komposition wie sub 64, der
noch Ochsengalle, Schöllkraut und Auripigment beigegeben werden.
4. (67. Scriptio similis auri; Mapp. XLIII.)
„Goldähnliche Schrift: Schöllkraut 3 Drachmen, geriebenes Gummiharz 3 Dr.,
goldfarbiger Gummi 3 Dr., helles Auripigment 3 Dr., Schildkrötengalle 3 Dr.,
Eiklar 5 Dr., so dass im ganzen 20 Drachmen sind. Füge nocli cilicischen
Safran 7 Unzen hinzu. Schreibe damit nicht nur auf Pergament oder
Papier (carta), sondern ebenso auf Glas und Marmorgefässen.“
Dieses Rezept findet sich fast wörtlich im Leydener Papyrus. Es lautet
dort (p. 10. 1. 5, Edit. Leemans) wie folgt:
Anweisung für Goldschrift ohne Gold: „Schöllkraut 1 Teil, reines Harz 1 TL,
gelb Auripigment 1 TL, flüssiges Eierklar 5 TL, so dass das Gewicht aller Flüssig-
keiten 20 Stateren beträgt, hernach füge 4 Stateren cilicischen Crocus hinzu. Dies-
taugt nicht nur für Papier und Pergament, sondern auch für farbigen Marmor und
was immer schön und goldähnlich gefärbt sein soll.“12)
Wie dieses, so sind auch andere Rezepte durch Tradition in alle Weltrichtungen
verbreitet worden. Solche Anweisungen wie 111: mit Eiklar gemischten Safran als
Unterlage für Vergoldung, oder 112: alle Metalle durch Amalgamierung mittelst
10) Aehnlich bei Theophilus I. XXXVII, letzter Abschnitt.
n) Theophilus, loc. cit.
12) Vergl. Uebersetzung des Leydener Papyrus von Berthelot: Collect. des anc. Alchi-
mistes Grecs, Introd. p. 43, Nr. 47.