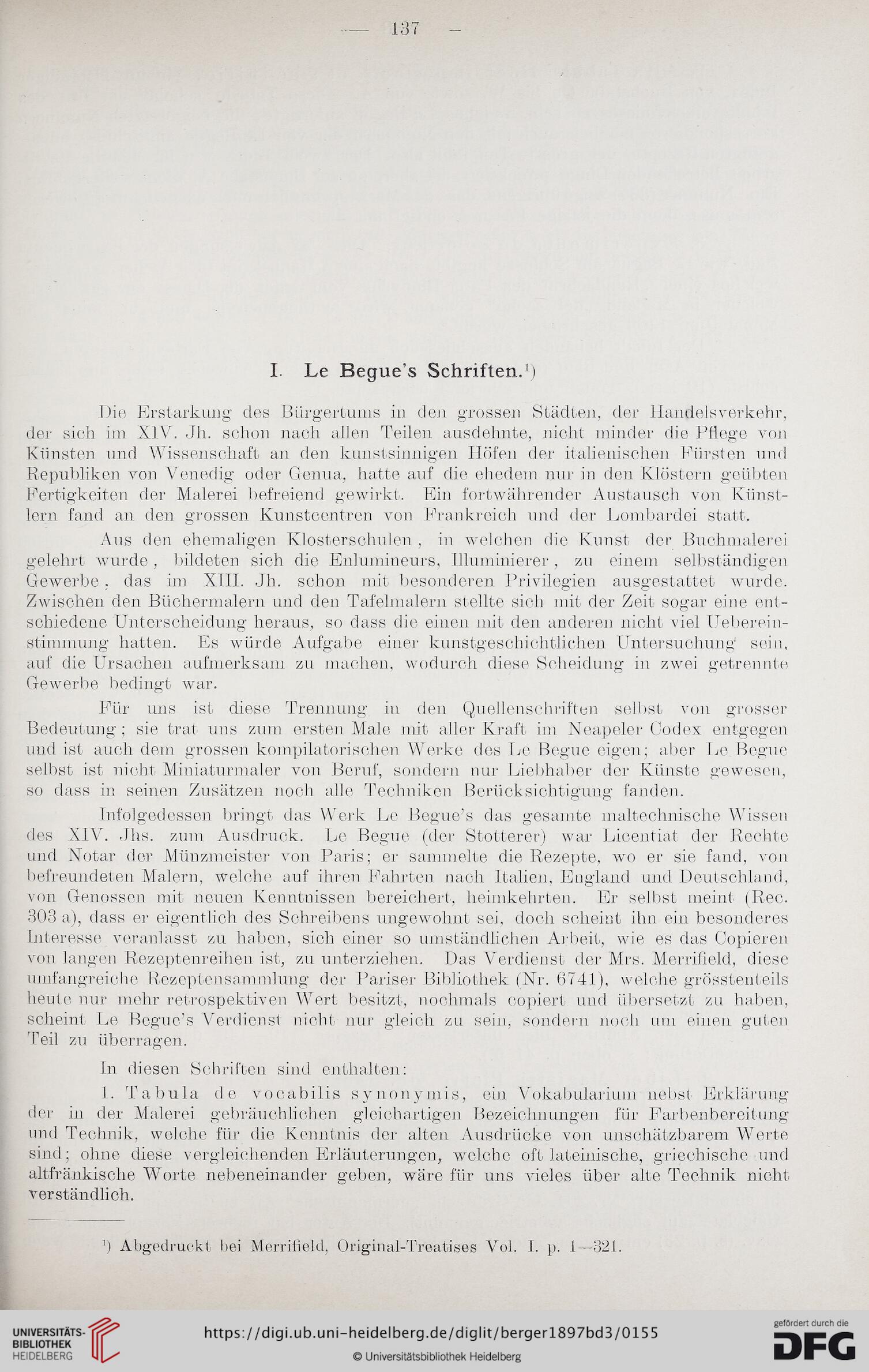137
I. Le Begue’s Schriften.1)
Die Erstarkung des Bürgertums in den grossen Städten, der Handelsverkehr,
der sich im XIV. Jh. schon nach allen Teilen ausdehnte, nicht minder die Pflege von
Künsten und Wissenschaft an den kunstsinnigen Höfen der italienischen Fürsten und
Republiken von Venedig oder Genua, hatte auf die ehedem nur in den Klöstern geübten
Fertigkeiten der Malerei befreiend gewirkt. Ein fortwährender Austausch von Künst-
lern fand an den grossen Kunstcentren von Frankreich und der Lombardei statt.
Aus den ehemaligen Klosterschulen , in welchen die Kunst der Buchmalerei
gelehrt wurde, bildeten sich die Enlumineurs, Illuminierer, zu einem selbständigen
Gewerbe , das im XIII. Jh. schon mit besonderen Privilegien ausgestattet wurde.
Zwischen den Büchermalern und den Tafelmalern stellte sich mit der Zeit sogar eine ent-
schiedene Unterscheidung heraus, so dass die einen mit den anderen nicht viel Ueberein-
stimmung hatten. Es würde Aufgabe einer kunstgeschichtlichen Untersuchung sein,
auf die Ursachen aufmerksam zu machen, wodurch diese Scheidung in zwei getrennte
Gewerbe bedingt war.
Für uns ist diese Trennung in den Quellenschriften selbst von grosser
Bedeutung ; sie trat uns zum ersten Male mit aller Kraft im Neapeler Codex entgegen
und ist auch dem grossen kompilatorischen Werke des Le Begue eigen ; aber Le Begue
selbst ist nicht Miniaturmaler von Beruf, sondern nur Liebhaber der Künste gewesen,
so dass in seinen Zusätzen noch alle Techniken Berücksichtigung fanden.
Infolgedessen bringt das Werk Le Begue’s das gesamte maltechnische Wissen
des XIV. Jhs. zum Ausdruck. Le Begue (der Stotterer) war Licentiat der Rechte
und Notar der Münzmeister von Paris; er sammelte die Rezepte, wo er sie fand, von
befreundeten Malern, welche auf ihren Fahrten nach Italien, England und Deutschland,
von Genossen mit neuen Kenntnissen bereichert, heimkehrten. Er selbst meint (Rec.
303 a), dass er eigentlich des Schreibens ungewohnt sei, doch scheint ihn ein besonderes
Interesse veranlasst zu haben, sich einer so umständlichen Arbeit, wie es das Copieren
von langen Rezeptenreihen ist, zu unterziehen. Das Verdienst der Mrs. Merrifield, diese
umfangreiche Rezeptensammlung der Pariser Bibliothek (Nr. 6741), welche grösstenteils
heute nur mehr retrospektiven Wert besitzt, nochmals copiert und übersetzt zu haben,
scheint Le Begue’s Verdienst nicht nur gleich zu sein, sondern noch um einen guten
Teil zu überragen.
In diesen Schriften sind enthalten:
1. Tabula de vocabilis synonymis, ein Vokabularium nebst Erklärung
der in der Malerei gebräuchlichen gleichartigen Bezeichnungen für Farbenbereitung
und Technik, welche für die Kenntnis der alten Ausdrücke von unschätzbarem Werte
sind; ohne diese vergleichenden Erläuterungen, welche oft lateinische, griechische und
altfränkische Worte nebeneinander geben, wäre für uns vieles über alte Technik nicht
verständlich.
’) Abgedruckt bei Merrifield, Original-Treatises Vol. I. p. 1—321.
I. Le Begue’s Schriften.1)
Die Erstarkung des Bürgertums in den grossen Städten, der Handelsverkehr,
der sich im XIV. Jh. schon nach allen Teilen ausdehnte, nicht minder die Pflege von
Künsten und Wissenschaft an den kunstsinnigen Höfen der italienischen Fürsten und
Republiken von Venedig oder Genua, hatte auf die ehedem nur in den Klöstern geübten
Fertigkeiten der Malerei befreiend gewirkt. Ein fortwährender Austausch von Künst-
lern fand an den grossen Kunstcentren von Frankreich und der Lombardei statt.
Aus den ehemaligen Klosterschulen , in welchen die Kunst der Buchmalerei
gelehrt wurde, bildeten sich die Enlumineurs, Illuminierer, zu einem selbständigen
Gewerbe , das im XIII. Jh. schon mit besonderen Privilegien ausgestattet wurde.
Zwischen den Büchermalern und den Tafelmalern stellte sich mit der Zeit sogar eine ent-
schiedene Unterscheidung heraus, so dass die einen mit den anderen nicht viel Ueberein-
stimmung hatten. Es würde Aufgabe einer kunstgeschichtlichen Untersuchung sein,
auf die Ursachen aufmerksam zu machen, wodurch diese Scheidung in zwei getrennte
Gewerbe bedingt war.
Für uns ist diese Trennung in den Quellenschriften selbst von grosser
Bedeutung ; sie trat uns zum ersten Male mit aller Kraft im Neapeler Codex entgegen
und ist auch dem grossen kompilatorischen Werke des Le Begue eigen ; aber Le Begue
selbst ist nicht Miniaturmaler von Beruf, sondern nur Liebhaber der Künste gewesen,
so dass in seinen Zusätzen noch alle Techniken Berücksichtigung fanden.
Infolgedessen bringt das Werk Le Begue’s das gesamte maltechnische Wissen
des XIV. Jhs. zum Ausdruck. Le Begue (der Stotterer) war Licentiat der Rechte
und Notar der Münzmeister von Paris; er sammelte die Rezepte, wo er sie fand, von
befreundeten Malern, welche auf ihren Fahrten nach Italien, England und Deutschland,
von Genossen mit neuen Kenntnissen bereichert, heimkehrten. Er selbst meint (Rec.
303 a), dass er eigentlich des Schreibens ungewohnt sei, doch scheint ihn ein besonderes
Interesse veranlasst zu haben, sich einer so umständlichen Arbeit, wie es das Copieren
von langen Rezeptenreihen ist, zu unterziehen. Das Verdienst der Mrs. Merrifield, diese
umfangreiche Rezeptensammlung der Pariser Bibliothek (Nr. 6741), welche grösstenteils
heute nur mehr retrospektiven Wert besitzt, nochmals copiert und übersetzt zu haben,
scheint Le Begue’s Verdienst nicht nur gleich zu sein, sondern noch um einen guten
Teil zu überragen.
In diesen Schriften sind enthalten:
1. Tabula de vocabilis synonymis, ein Vokabularium nebst Erklärung
der in der Malerei gebräuchlichen gleichartigen Bezeichnungen für Farbenbereitung
und Technik, welche für die Kenntnis der alten Ausdrücke von unschätzbarem Werte
sind; ohne diese vergleichenden Erläuterungen, welche oft lateinische, griechische und
altfränkische Worte nebeneinander geben, wäre für uns vieles über alte Technik nicht
verständlich.
’) Abgedruckt bei Merrifield, Original-Treatises Vol. I. p. 1—321.