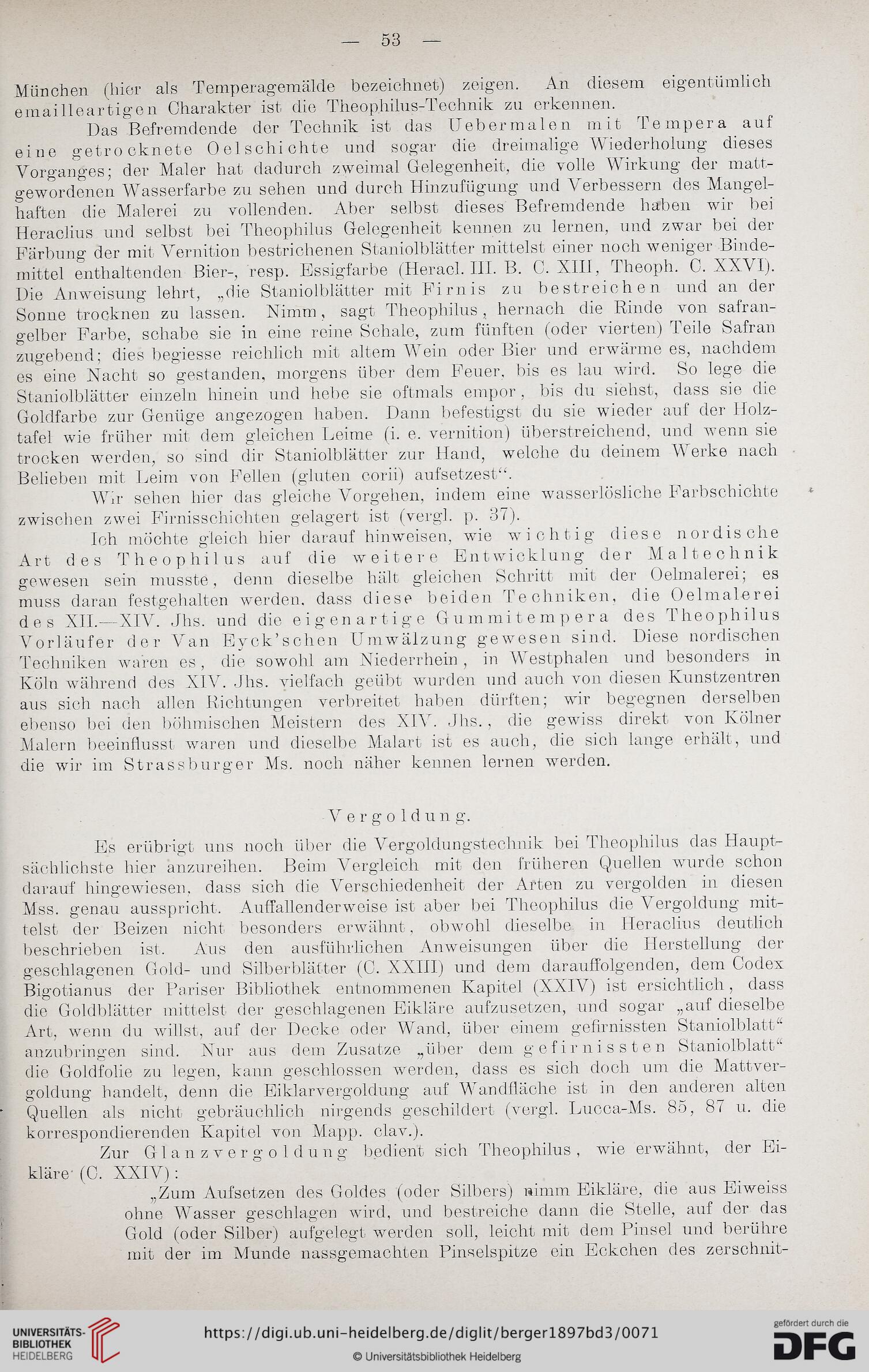53
München (hier als Temperagemälde bezeichnet) zeigen. An diesem eigentümlich
emailleartigen Charakter ist die Theophilus-Technik zu erkennen.
Das Befremdende der Technik ist das Uebermalen mit Tempera auf
eine getrocknete Oelschiehte und sogar die dreimalige Wiederholung dieses
Vorganges; der Maler hat dadurch zweimal Gelegenheit, die volle Wirkung der matt-
gewordenen Wasserfarbe zu sehen und durch Hinzufügung und Verbessern des Mangel-
haften die Malerei zu vollenden. Aber selbst dieses Befremdende haben wir bei
Heraclius und selbst bei Theophilus Gelegenheit kennen zu lernen, und zwar bei der
Färbung der mit Vernition bestrichenen Staniolblätter mittelst einer noch weniger Binde-
mittel enthaltenden Bier-, resp. Essigfarbe (Heräcl. III. B. C. XIII, Theoph. C. XXVI).
Die Anweisung lehrt, „die Staniolblätter mit Firnis zu bestreichen und an der
Sonne trocknen zu lassen. Nimm, sagt Theophilus, hernach die Rinde von safran-
gelber Farbe, schabe sie in eine reine Schale, zum fünften (oder vierten) Teile Safran
zugebend; dies begiesse reichlich mit altem Wein oder Bier und erwärme es, nachdem
es eine Nacht so gestanden, morgens über dem Feuer, bis es lau wird. So lege die
Staniolblätter einzeln hinein und hebe sie oftmals empor, bis du siehst, dass sie die
Goldfarbe zur Genüge angezogen haben. Dann befestigst du sie wieder auf der Holz-
tafel wie früher mit dem gleichen Leime (i. e. vernition) üb er streichend, und wenn sie
trocken werden, so sind dir Staniolblätter zur Hand, welche du deinem Werke nach
Belieben mit Leim von Fellen (gluten corii) aufsetzest“.
Wir sehen hier das gleiche Vorgehen, indem eine wasserlösliche Farbschichte
zwischen zwei Firnisschichten gelagert ist (vergl. p. 37).
Ich möchte gleich hier darauf hinweisen, wie wichtig diese nordische
Art des Theophilus auf die weitere Entwicklung der Maltechnik
gewesen sein musste, denn dieselbe hält gleichen Schritt mit der Oelmalerei; es
muss daran festgehalten werden, dass diese beiden Techniken, die Oelmalerei
des XII.—XIV. Jhs. und die eigenartige Gummitempera des Theophilus
Vorläufer der Van Byck’schen Umwälzung gewesen sind. Diese nordischen
Techniken waren es, die sowohl am Niederrhein , in Westphalen und besonders in
Köln während des XIV. Jhs. vielfach geübt wurden und auch von diesen Kunstzentren
aus sich nach allen Richtungen verbreitet haben dürften; wir begegnen derselben
ebenso bei den böhmischen Meistern des XIV. Jhs., die gewiss direkt von Kölner
Malern beeinflusst waren und dieselbe Malart ist es auch, die sich lange erhält, und
die wir im Strassburger Ms. noch näher kennen lernen werden.
V e r g ο 1 d u n g.
Es erübrigt uns noch über die Vergoldungstechnik bei Theophilus das Haupt-
sächlichste hier anzureihen. Beim Vergleich mit den früheren Quellen wurde schon
darauf hingewiesen, dass sich die Verschiedenheit der Arten zu vergolden in diesen
Mss. genau ausspricht. Auffallenderweise ist aber bei Theophilus die Vergoldung mit-
telst der Beizen nicht besonders erwähnt, obwohl dieselbe in Heraclius deutlich
beschrieben ist. Aus den ausführlichen Anweisungen über die Herstellung der
geschlagenen Gold- und Silberblätter (C. XXIII) und dem darauffolgenden, dem Codex
Bigotianus der Pariser Bibliothek entnommenen Kapitel (XXIV) ist ersichtlich, dass
die Goldblätter mittelst der geschlagenen Eikläre aufzusetzen, und sogar „auf dieselbe
Art, wenn du willst, auf der Decke oder Wand, über einem gefirnissten Staniolblatt“
anzubringen sind. Nur aus dem Zusatze „über dem gefirnissten Staniolblatt“
die Goldfolie zu legen, kann geschlossen werden, dass es sich doch um die Mattver-
goldung handelt, denn die Eiklarvergoldung auf Wandfläche ist in den anderen alten
Quellen als nicht gebräuchlich nirgends geschildert (vergl. Lucca-Ms. 85, 87 u. die
korrespondierenden Kapitel von Mapp. clav.).
Zur G1 a n z v e r g ο 1 d u n g bedient sich Theophilus , wie erwähnt, der Ei-
kläre· (C. XXIV):
„Zum Aufsetzen des Goldes (oder Silbers) nimm Eikläre, die aus Eiweiss
ohne Wasser geschlagen wird, und bestreiche dann die Stelle, auf der das
Gold (oder Silber) aufgelegt werden soll, leicht mit dem Pinsel und berühre
mit der im Munde nassgemachten Pinselspitze ein Eckchen des zerschnit-
München (hier als Temperagemälde bezeichnet) zeigen. An diesem eigentümlich
emailleartigen Charakter ist die Theophilus-Technik zu erkennen.
Das Befremdende der Technik ist das Uebermalen mit Tempera auf
eine getrocknete Oelschiehte und sogar die dreimalige Wiederholung dieses
Vorganges; der Maler hat dadurch zweimal Gelegenheit, die volle Wirkung der matt-
gewordenen Wasserfarbe zu sehen und durch Hinzufügung und Verbessern des Mangel-
haften die Malerei zu vollenden. Aber selbst dieses Befremdende haben wir bei
Heraclius und selbst bei Theophilus Gelegenheit kennen zu lernen, und zwar bei der
Färbung der mit Vernition bestrichenen Staniolblätter mittelst einer noch weniger Binde-
mittel enthaltenden Bier-, resp. Essigfarbe (Heräcl. III. B. C. XIII, Theoph. C. XXVI).
Die Anweisung lehrt, „die Staniolblätter mit Firnis zu bestreichen und an der
Sonne trocknen zu lassen. Nimm, sagt Theophilus, hernach die Rinde von safran-
gelber Farbe, schabe sie in eine reine Schale, zum fünften (oder vierten) Teile Safran
zugebend; dies begiesse reichlich mit altem Wein oder Bier und erwärme es, nachdem
es eine Nacht so gestanden, morgens über dem Feuer, bis es lau wird. So lege die
Staniolblätter einzeln hinein und hebe sie oftmals empor, bis du siehst, dass sie die
Goldfarbe zur Genüge angezogen haben. Dann befestigst du sie wieder auf der Holz-
tafel wie früher mit dem gleichen Leime (i. e. vernition) üb er streichend, und wenn sie
trocken werden, so sind dir Staniolblätter zur Hand, welche du deinem Werke nach
Belieben mit Leim von Fellen (gluten corii) aufsetzest“.
Wir sehen hier das gleiche Vorgehen, indem eine wasserlösliche Farbschichte
zwischen zwei Firnisschichten gelagert ist (vergl. p. 37).
Ich möchte gleich hier darauf hinweisen, wie wichtig diese nordische
Art des Theophilus auf die weitere Entwicklung der Maltechnik
gewesen sein musste, denn dieselbe hält gleichen Schritt mit der Oelmalerei; es
muss daran festgehalten werden, dass diese beiden Techniken, die Oelmalerei
des XII.—XIV. Jhs. und die eigenartige Gummitempera des Theophilus
Vorläufer der Van Byck’schen Umwälzung gewesen sind. Diese nordischen
Techniken waren es, die sowohl am Niederrhein , in Westphalen und besonders in
Köln während des XIV. Jhs. vielfach geübt wurden und auch von diesen Kunstzentren
aus sich nach allen Richtungen verbreitet haben dürften; wir begegnen derselben
ebenso bei den böhmischen Meistern des XIV. Jhs., die gewiss direkt von Kölner
Malern beeinflusst waren und dieselbe Malart ist es auch, die sich lange erhält, und
die wir im Strassburger Ms. noch näher kennen lernen werden.
V e r g ο 1 d u n g.
Es erübrigt uns noch über die Vergoldungstechnik bei Theophilus das Haupt-
sächlichste hier anzureihen. Beim Vergleich mit den früheren Quellen wurde schon
darauf hingewiesen, dass sich die Verschiedenheit der Arten zu vergolden in diesen
Mss. genau ausspricht. Auffallenderweise ist aber bei Theophilus die Vergoldung mit-
telst der Beizen nicht besonders erwähnt, obwohl dieselbe in Heraclius deutlich
beschrieben ist. Aus den ausführlichen Anweisungen über die Herstellung der
geschlagenen Gold- und Silberblätter (C. XXIII) und dem darauffolgenden, dem Codex
Bigotianus der Pariser Bibliothek entnommenen Kapitel (XXIV) ist ersichtlich, dass
die Goldblätter mittelst der geschlagenen Eikläre aufzusetzen, und sogar „auf dieselbe
Art, wenn du willst, auf der Decke oder Wand, über einem gefirnissten Staniolblatt“
anzubringen sind. Nur aus dem Zusatze „über dem gefirnissten Staniolblatt“
die Goldfolie zu legen, kann geschlossen werden, dass es sich doch um die Mattver-
goldung handelt, denn die Eiklarvergoldung auf Wandfläche ist in den anderen alten
Quellen als nicht gebräuchlich nirgends geschildert (vergl. Lucca-Ms. 85, 87 u. die
korrespondierenden Kapitel von Mapp. clav.).
Zur G1 a n z v e r g ο 1 d u n g bedient sich Theophilus , wie erwähnt, der Ei-
kläre· (C. XXIV):
„Zum Aufsetzen des Goldes (oder Silbers) nimm Eikläre, die aus Eiweiss
ohne Wasser geschlagen wird, und bestreiche dann die Stelle, auf der das
Gold (oder Silber) aufgelegt werden soll, leicht mit dem Pinsel und berühre
mit der im Munde nassgemachten Pinselspitze ein Eckchen des zerschnit-