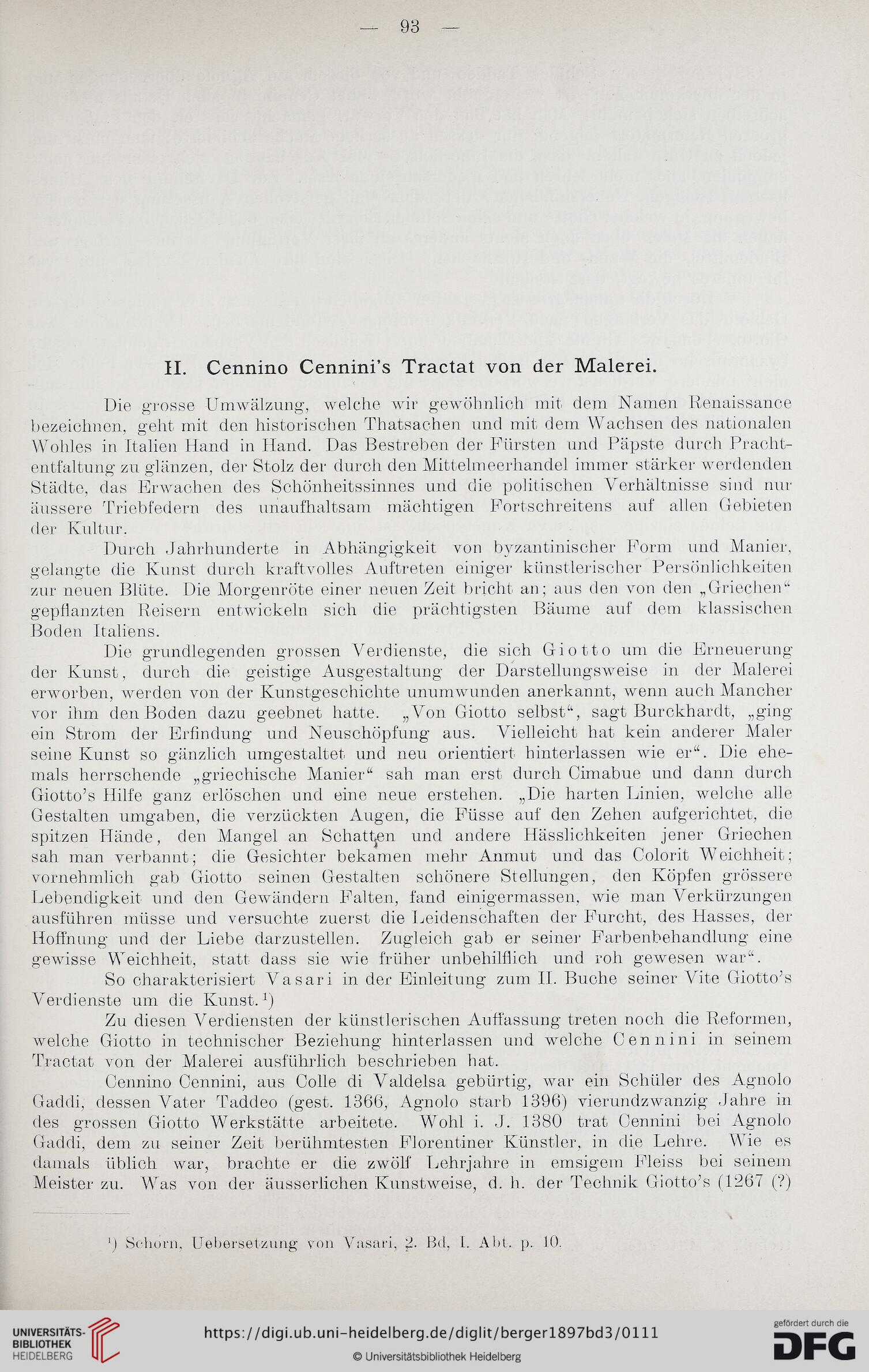93
II. Cennino Cennini’s Tractat von der Malerei.
Die grosse Umwälzung, welche wir gewöhnlich mit dem Namen Renaissance
bezeichnen, geht mit den historischen Thatsachen und mit dem Wachsen des nationalen
Wohles in Italien Hand in Hand. Das Bestreben der Fürsten und Päpste durch Pracht-
entfaltung zu glänzen, der Stolz der durch den Mittelmeerhandel immer stärker werdenden
Städte, das Erwachen des Schönheitssinnes und die politischen Verhältnisse sind mu-
äussere Triebfedern des unaufhaltsam mächtigen Fortschreitens auf allen Gebieten
der Kultur.
Durch Jahrhunderte in Abhängigkeit von byzantinischer Form und Manier,
gelangte die Kunst durch kraftvolles Auftreten einiger künstlerischer Persönlichkeiten
zur neuen Blüte. Die Morgenröte einer neuen Zeit bricht an; aus den von den „Griechen“
gepflanzten Reisern entwickeln sich die prächtigsten Bäume auf dem klassischen
Boden Italiens.
Die grundlegenden grossen Verdienste, die sich Giotto um die Erneuerung
der Kunst, durch die geistige Ausgestaltung der Darstellungsweise in der Malerei
erworben, werden von der Kunstgeschichte unumwunden anerkannt, wenn auch Mancher
vor ihm den Boden dazu geebnet hatte. „Von Giotto selbst“, sagt Burckhardt, „ging
ein Strom der Erfindung und Neuschöpfung aus. Vielleicht hat kein anderer Maler-
seine Kunst so gänzlich umgestaltet und neu orientiert hinterlassen wie er“. Die ehe-
mals herrschende „griechische Manier“ sah man erst durch Cimabue und dann durch
Giotto’s Hilfe ganz erlöschen und eine neue erstehen. „Die harten Linien, welche alle
Gestalten umgaben, die verzückten Augen, die Füsse auf den Zehen aufgerichtet, die
spitzen Hände, den Mangel an Schatten und andere Hässlichkeiten jener Griechen
sah man verbannt; die Gesichter bekamen mehr Anmut und das Colorit Weichheit;
vornehmlich gab Giotto seinen Gestalten schönere Stellungen, den Köpfen grössere
Lebendigkeit und den Gewändern Falten, fand einigermassen, wie man Verkürzungen
ausführen müsse und versuchte zuerst die Leidenschaften der Furcht, des Hasses, der
Hoffnung und der Liebe darzustellen. Zugleich gab er seine]· Farbenbehandlung eine
gewisse Weichheit, statt dass sie wie früher unbehilflich und roh gewesen war“.
So charakterisiert Vasari in der Einleitung zum II. Buche seiner Vite Giotto’s
Verdienste um die Kunst.1)
Zu diesen Verdiensten der künstlerischen Auffassung treten noch die Reformen,
welche Giotto in technischer Beziehung hinterlassen und welche Cennini in seinem
Tractat von der Malerei ausführlich beschrieben hat.
Cennino Cennini, aus Colle di Valdelsa gebürtig, war ein Schüler des Agnolo
Gaddi, dessen Vater Taddeo (gest. 1366, Agnolo starb 1396) vierundzwanzig Jahre in
des grossen Giotto Werkstätte arbeitete. Wohl i. J. 1380 trat Cennini bei Agnolo
Gaddi, dem zu seiner Zeit berühmtesten Florentiner Künstler, in die Lehre. Wie es
damals üblich war, brachte er die zwölf Lehrjahre in emsigem Fleiss bei seinem
Meister zu. Was von der äusserlichen Kunstweise, d. h. der Technik Giotto’s (1267 (?)
*) Schorn. Uebersetzung von Vasari, 2· Bd, 1. Abt. p. 10.
II. Cennino Cennini’s Tractat von der Malerei.
Die grosse Umwälzung, welche wir gewöhnlich mit dem Namen Renaissance
bezeichnen, geht mit den historischen Thatsachen und mit dem Wachsen des nationalen
Wohles in Italien Hand in Hand. Das Bestreben der Fürsten und Päpste durch Pracht-
entfaltung zu glänzen, der Stolz der durch den Mittelmeerhandel immer stärker werdenden
Städte, das Erwachen des Schönheitssinnes und die politischen Verhältnisse sind mu-
äussere Triebfedern des unaufhaltsam mächtigen Fortschreitens auf allen Gebieten
der Kultur.
Durch Jahrhunderte in Abhängigkeit von byzantinischer Form und Manier,
gelangte die Kunst durch kraftvolles Auftreten einiger künstlerischer Persönlichkeiten
zur neuen Blüte. Die Morgenröte einer neuen Zeit bricht an; aus den von den „Griechen“
gepflanzten Reisern entwickeln sich die prächtigsten Bäume auf dem klassischen
Boden Italiens.
Die grundlegenden grossen Verdienste, die sich Giotto um die Erneuerung
der Kunst, durch die geistige Ausgestaltung der Darstellungsweise in der Malerei
erworben, werden von der Kunstgeschichte unumwunden anerkannt, wenn auch Mancher
vor ihm den Boden dazu geebnet hatte. „Von Giotto selbst“, sagt Burckhardt, „ging
ein Strom der Erfindung und Neuschöpfung aus. Vielleicht hat kein anderer Maler-
seine Kunst so gänzlich umgestaltet und neu orientiert hinterlassen wie er“. Die ehe-
mals herrschende „griechische Manier“ sah man erst durch Cimabue und dann durch
Giotto’s Hilfe ganz erlöschen und eine neue erstehen. „Die harten Linien, welche alle
Gestalten umgaben, die verzückten Augen, die Füsse auf den Zehen aufgerichtet, die
spitzen Hände, den Mangel an Schatten und andere Hässlichkeiten jener Griechen
sah man verbannt; die Gesichter bekamen mehr Anmut und das Colorit Weichheit;
vornehmlich gab Giotto seinen Gestalten schönere Stellungen, den Köpfen grössere
Lebendigkeit und den Gewändern Falten, fand einigermassen, wie man Verkürzungen
ausführen müsse und versuchte zuerst die Leidenschaften der Furcht, des Hasses, der
Hoffnung und der Liebe darzustellen. Zugleich gab er seine]· Farbenbehandlung eine
gewisse Weichheit, statt dass sie wie früher unbehilflich und roh gewesen war“.
So charakterisiert Vasari in der Einleitung zum II. Buche seiner Vite Giotto’s
Verdienste um die Kunst.1)
Zu diesen Verdiensten der künstlerischen Auffassung treten noch die Reformen,
welche Giotto in technischer Beziehung hinterlassen und welche Cennini in seinem
Tractat von der Malerei ausführlich beschrieben hat.
Cennino Cennini, aus Colle di Valdelsa gebürtig, war ein Schüler des Agnolo
Gaddi, dessen Vater Taddeo (gest. 1366, Agnolo starb 1396) vierundzwanzig Jahre in
des grossen Giotto Werkstätte arbeitete. Wohl i. J. 1380 trat Cennini bei Agnolo
Gaddi, dem zu seiner Zeit berühmtesten Florentiner Künstler, in die Lehre. Wie es
damals üblich war, brachte er die zwölf Lehrjahre in emsigem Fleiss bei seinem
Meister zu. Was von der äusserlichen Kunstweise, d. h. der Technik Giotto’s (1267 (?)
*) Schorn. Uebersetzung von Vasari, 2· Bd, 1. Abt. p. 10.