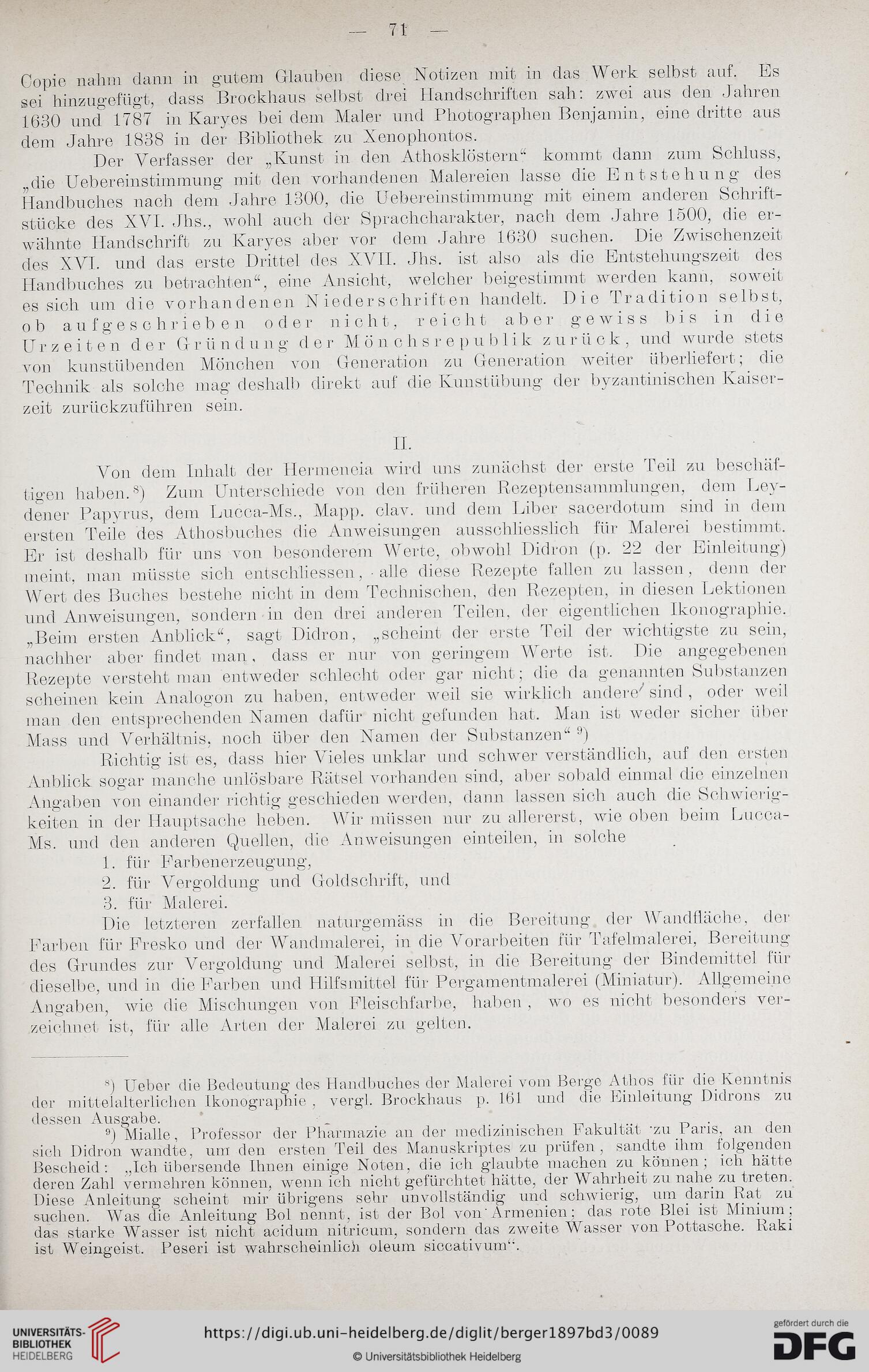71
Copie nahm dann in gutem Glauben diese Notizen mit in das Werk selbst auf. Es
sei hinzugefügt, dass Brockhaus selbst drei Handschriften sah: zwei aus den Jahren
1630 und 1787 in Karyes bei dem Maler und Photographen Benjamin, eine dritte aus
dem Jahre 1838 in der Bibliothek zu Xenophontos.
Der Verfasser der „Kunst in den Athosklöstern“ kommt dann zum Schluss,
„die Uebereinstimmung mit den vorhandenen Malereien lasse die Entstehung des
Handbuches nach dem Jahre 1300, die Uebereinstimmung mit einem anderen Schrift-
stücke des XVI. Jhs., wohl auch der Sprachcharakter, nach dem Jahre 1500, die er-
wähnte Handschrift zu Karyes aber vor dem Jahre 1630 suchen. Die Zwischenzeit
des XVI. und das erste Drittel des XVII. Jhs. ist also als die Entstehungszeit des
Handbuches zu betrachten“, eine Ansicht, welcher beigestimmt werden kann, soweit
es sich um die vorhandenen Niederschriften handelt. Die Tradition selbst,
ob a u f g e s c h r i e b e n oder nicht, reicht aber gewiss bis in die
Urzeit e n d e r G r ü n d u n g d e r M ö n c h s r e p u b 1 i k zurück, und wurde stets
von kunstübenden Mönchen von Generation zu Generation weiter überliefert; die
Technik als solche mag deshalb direkt auf die Kunstübung der byzantinischen Kaiser-
zeit zurückzuführen sein.
II.
Von dem Inhalt der Hermen eia wird uns zunächst der erste Teil zu beschäf-
tigen haben.8) Zum Unterschiede von den früheren Rezeptensammlungen, dem Ley-
dener Papyrus, dem Lucca-Ms., Mapp. clav. und dem Liber sacerdotum sind in dem
ersten Teile des Athosbuches die AnvÄisungen ausschliesslich für Malerei bestimmt.
Er ist deshalb für uns von besonderem Werte, obwohl Didron (p. 22 der Einleitung)
meint, man müsste sich entschliessen, - alle diese Rezepte fallen zu lassen, denn der
Wert des Buches bestehe nicht in dem Technischen, den Rezepten, in diesen Lektionen
und Anweisungen, sondern in den drei anderen Teilen, der eigentlichen Ikonographie.
„Beim ersten Anblick“, sagt Didron, „scheint der erste Teil der wichtigste zu sein,
nachher aber findet man. dass er nur von geringem Werte ist. Die angegebenen
Rezepte versteht man entweder schlecht oder gar nicht; die da genannten Substanzen
scheinen kein Analogon zu haben, entweder weil sie wirklich andere7 sind , oder weil
man den entsprechenden Namen dafür nicht gefunden hat. Man ist weder sicher über
Mass und Verhältnis, noch über den Namen der Substanzen“ 9)
Richtig ist es, dass hier Vieles unklar und schwer verständlich, auf den ersten
Anblick sogar manche unlösbare Rätsel vorhanden sind, aber sobald einmal die einzelnen
Angaben von einander richtig geschieden werden, dann lassen sich auch die Schwierig-
keiten in der Hauptsache heben. Wir müssen nur zu allererst, wie oben beim Lucca-
Ms. und den anderen Quellen, die Anweisungen einteilen, in solche
1. für Farbenerzeugung,
2. für Vergoldung und Goldschrift, und
3. für Malerei.
Die letzteren zerfallen naturgemäss in die Bereitung der Wandfläche, der
Farben für Fresko und der Wandmalerei, in die Vorarbeiten für Tafelmalerei, Bereitung
des Grundes zur Vergoldung und Malerei selbst, in die Bereitung der Bindemittel für
dieselbe, und in die Farben und Hilfsmittel für Pergamentmalerei (Miniatur). Allgemeine
Angaben, wie die Mischungen von Fleischfarbe, haben , wo es nicht besonders ver-
zeichnet ist, für alle Arten der Malerei zu gelten.
8) Ueber die Bedeutung des Handbuches der Malerei vom Berge Athos für die Kenntnis
der mittelalterlichen Ikonographie , vergl. Brockhaus p. 161 und die Einleitung Didrons zu
dessen Ausgabe.
9) Mialle, Professor der Pharmazie an der medizinischen Fakultät ’zu Paris, an den
sich Didron wandte, um den ersten Teil des Manuskriptes zu prüfen, sandte ihm folgenden
Bescheid: „Ich übersende Ihnen einige Noten, die ich glaubte machen zu können ; ich hätte
deren Zahl vermehren können, wenn ich nicht gefürchtet hätte, der Wahrheit zu nahe zu treten.
Diese Anleitung scheint mir übrigens sehr unvollständig und schwierig, um darin Rat zu
suchen. Was die Anleitung Boi nennt, ist der Boi von'Armenien; das rote Blei ist Minium ;
das starke Wasser ist nicht acidum nitricum, sondern das zweite Wasser von Pottasche. Raki
ist Weingeist. Peseri ist wahrscheinlich oleum siccativum“.
Copie nahm dann in gutem Glauben diese Notizen mit in das Werk selbst auf. Es
sei hinzugefügt, dass Brockhaus selbst drei Handschriften sah: zwei aus den Jahren
1630 und 1787 in Karyes bei dem Maler und Photographen Benjamin, eine dritte aus
dem Jahre 1838 in der Bibliothek zu Xenophontos.
Der Verfasser der „Kunst in den Athosklöstern“ kommt dann zum Schluss,
„die Uebereinstimmung mit den vorhandenen Malereien lasse die Entstehung des
Handbuches nach dem Jahre 1300, die Uebereinstimmung mit einem anderen Schrift-
stücke des XVI. Jhs., wohl auch der Sprachcharakter, nach dem Jahre 1500, die er-
wähnte Handschrift zu Karyes aber vor dem Jahre 1630 suchen. Die Zwischenzeit
des XVI. und das erste Drittel des XVII. Jhs. ist also als die Entstehungszeit des
Handbuches zu betrachten“, eine Ansicht, welcher beigestimmt werden kann, soweit
es sich um die vorhandenen Niederschriften handelt. Die Tradition selbst,
ob a u f g e s c h r i e b e n oder nicht, reicht aber gewiss bis in die
Urzeit e n d e r G r ü n d u n g d e r M ö n c h s r e p u b 1 i k zurück, und wurde stets
von kunstübenden Mönchen von Generation zu Generation weiter überliefert; die
Technik als solche mag deshalb direkt auf die Kunstübung der byzantinischen Kaiser-
zeit zurückzuführen sein.
II.
Von dem Inhalt der Hermen eia wird uns zunächst der erste Teil zu beschäf-
tigen haben.8) Zum Unterschiede von den früheren Rezeptensammlungen, dem Ley-
dener Papyrus, dem Lucca-Ms., Mapp. clav. und dem Liber sacerdotum sind in dem
ersten Teile des Athosbuches die AnvÄisungen ausschliesslich für Malerei bestimmt.
Er ist deshalb für uns von besonderem Werte, obwohl Didron (p. 22 der Einleitung)
meint, man müsste sich entschliessen, - alle diese Rezepte fallen zu lassen, denn der
Wert des Buches bestehe nicht in dem Technischen, den Rezepten, in diesen Lektionen
und Anweisungen, sondern in den drei anderen Teilen, der eigentlichen Ikonographie.
„Beim ersten Anblick“, sagt Didron, „scheint der erste Teil der wichtigste zu sein,
nachher aber findet man. dass er nur von geringem Werte ist. Die angegebenen
Rezepte versteht man entweder schlecht oder gar nicht; die da genannten Substanzen
scheinen kein Analogon zu haben, entweder weil sie wirklich andere7 sind , oder weil
man den entsprechenden Namen dafür nicht gefunden hat. Man ist weder sicher über
Mass und Verhältnis, noch über den Namen der Substanzen“ 9)
Richtig ist es, dass hier Vieles unklar und schwer verständlich, auf den ersten
Anblick sogar manche unlösbare Rätsel vorhanden sind, aber sobald einmal die einzelnen
Angaben von einander richtig geschieden werden, dann lassen sich auch die Schwierig-
keiten in der Hauptsache heben. Wir müssen nur zu allererst, wie oben beim Lucca-
Ms. und den anderen Quellen, die Anweisungen einteilen, in solche
1. für Farbenerzeugung,
2. für Vergoldung und Goldschrift, und
3. für Malerei.
Die letzteren zerfallen naturgemäss in die Bereitung der Wandfläche, der
Farben für Fresko und der Wandmalerei, in die Vorarbeiten für Tafelmalerei, Bereitung
des Grundes zur Vergoldung und Malerei selbst, in die Bereitung der Bindemittel für
dieselbe, und in die Farben und Hilfsmittel für Pergamentmalerei (Miniatur). Allgemeine
Angaben, wie die Mischungen von Fleischfarbe, haben , wo es nicht besonders ver-
zeichnet ist, für alle Arten der Malerei zu gelten.
8) Ueber die Bedeutung des Handbuches der Malerei vom Berge Athos für die Kenntnis
der mittelalterlichen Ikonographie , vergl. Brockhaus p. 161 und die Einleitung Didrons zu
dessen Ausgabe.
9) Mialle, Professor der Pharmazie an der medizinischen Fakultät ’zu Paris, an den
sich Didron wandte, um den ersten Teil des Manuskriptes zu prüfen, sandte ihm folgenden
Bescheid: „Ich übersende Ihnen einige Noten, die ich glaubte machen zu können ; ich hätte
deren Zahl vermehren können, wenn ich nicht gefürchtet hätte, der Wahrheit zu nahe zu treten.
Diese Anleitung scheint mir übrigens sehr unvollständig und schwierig, um darin Rat zu
suchen. Was die Anleitung Boi nennt, ist der Boi von'Armenien; das rote Blei ist Minium ;
das starke Wasser ist nicht acidum nitricum, sondern das zweite Wasser von Pottasche. Raki
ist Weingeist. Peseri ist wahrscheinlich oleum siccativum“.