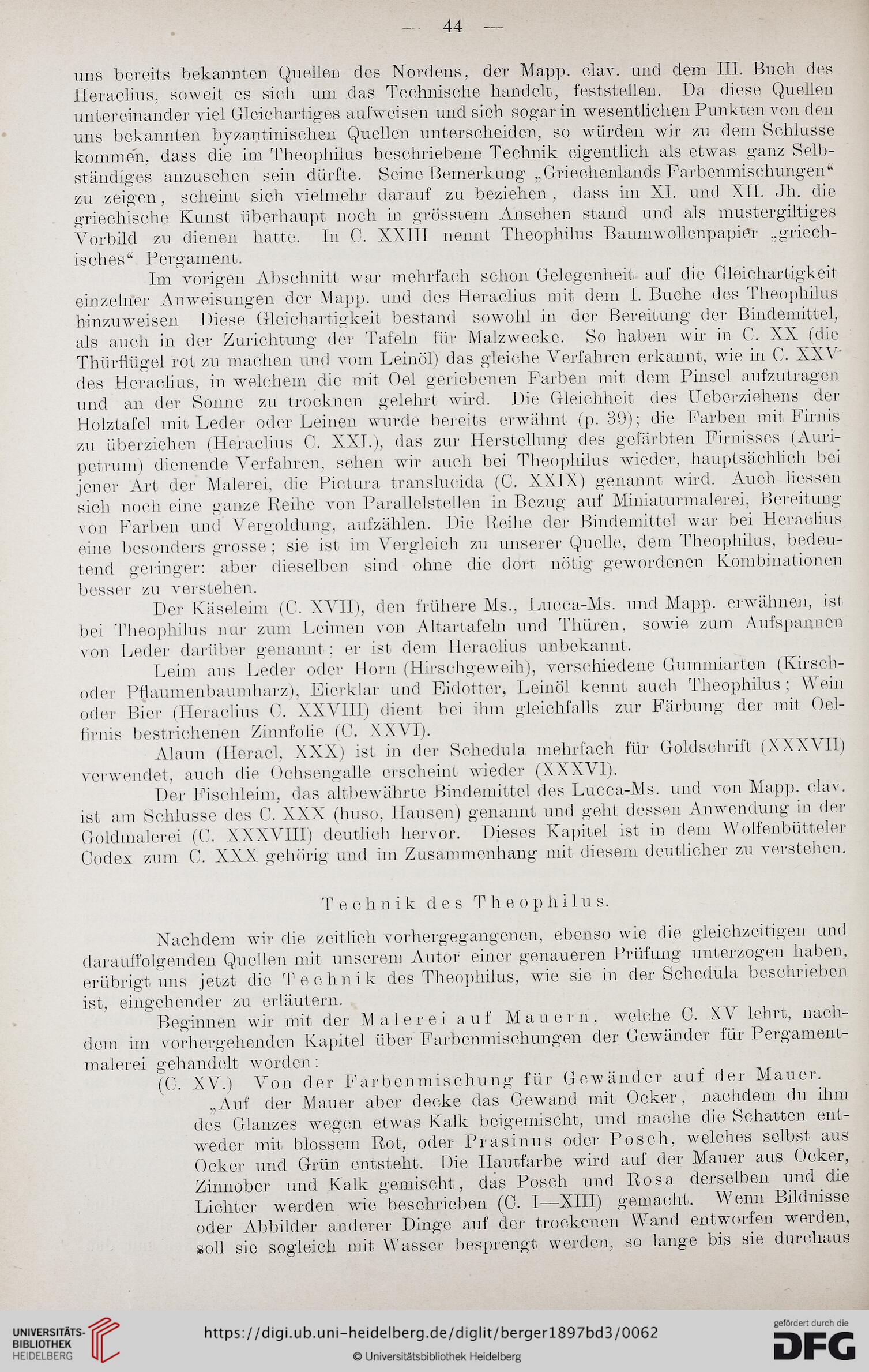44
uns bereits bekannten Quellen des Nordens, der Mapp. clav. und dem III. Buch des
Heraclius, soweit es sich uni das Technische handelt, feststellen. Da diese Quellen
untereinander viel Gleichartiges aufweisen und sich sogar in wesentlichen Punkten von den
uns bekannten byzantinischen Quellen unterscheiden, so würden wir zu dem Schlüsse
kommen, dass die im Theophilus beschriebene Technik eigentlich als etwas ganz Selb-
ständiges anzusehen sein dürfte. Seine Bemerkung „Griechenlands Farbenmischungen“
zu zeigen, scheint sich vielmehr darauf zu beziehen , dass im XI. und XII. Jh. die
griechische Kunst überhaupt noch in grösstem Ansehen stand und als mustergiltiges
Vorbild zu dienen hatte. In C. XXIII nennt Theophilus Baumwollenpapier „griech-
isches“ Pergament.
Im vorigen Abschnitt war mehrfach schon Gelegenheit auf die Gleichartigkeit
einzelner Anweisungen der Map]), und des Heraclius mit dem I. Buche des Theophilus
hinzuweisen Diese Gleichartigkeit bestand sowohl in der Bereitung der Bindemittel,
als auch in der Zurichtung der Tafeln für Malzwecke. So haben wir in C. XX (die
Thürflügel rot zu machen und vom Leinöl) das gleiche Verfahren erkannt, wie in G. XXV*
des Heraclius, in welchem die mit Oel geriebenen Farben mit dem Pinsel aufzutragen
und an der Sonne zu trocknen gelehrt wird. Die Gleichheit des Ueberziehens der
Holztafel mit Ledei· oder Leinen wurde bereits erwähnt (p. 39); die Farben mit Firnis
zu überziehen (Heraclius C. XXI.), das zur Herstellung des gefärbten Firnisses (Auri-
petrum) dienende Verfahren, sehen wir auch bei Theophilus wieder, hauptsächlich bei
jener Art der Malerei, die Piotura translucida (C. XXIX) genannt wird. Auch liessen
sich noch eine ganze Reihe von Parallelstellen in Bezug auf Miniaturmalerei, Bereitung
von Farben und Vergoldung, aufzählen. Die Reihe der Bindemittel war bei Heraclius
eine besonders grosse ; sie ist im Vergleich zu unserer Quelle, dem Theophilus, bedeu-
tend geringer: aber dieselben sind ohne die dort nötig gewordenen Kombinationen
besser zu verstehen.
Der Käseleim (C. XVII), den frühere Ms., Lucca-Ms. und Mapp, erwähnen, ist
bei Theophilus nm· zum Leimen von Altartafeln und Thüren, sowie zum Aufspannen
von Leder darüber genannt; er ist dem Heraclius unbekannt.
Leim aus Ledei· oder Horn (Hirschgeweih), verschiedene Gummiarten (Kirsch-
oder Pflaumenbaumharz), Eierklar und Eidotter, Leinöl kennt auch Theophilus ; Wein
oder Bier (Heraclius 0. XXVIII) dient bei ihm gleichfalls zur Färbung der mit Oel-
firnis bestrichenen Zinnfolie (C. XXVI).
Alaun (Heracl. XXX) ist in der Schedula mehrfach für Goldschrift (XXXVII)
verwendet, auch die Ochsengalle erscheint wieder (XXXVI).
Der Fischleim, das altbewährte Bindemittel des Lucca-Ms. und von Mapp. clav.
ist am Schlüsse des C. XXX (huso, Hausen) genannt und geht dessen Anwendung in der
Goldmalerei (C. XXXVIII) deutlich hervor. Dieses Kapitel ist in dem Wolfenbütteier
Codex zum C. XXX gehörig und im Zusammenhang mit diesem deutlicher zu verstehen.
Technik des Theophilus.
Nachdem wir die zeitlich vorhergegangenen, ebenso wie die gleichzeitigen und
darauffolgenden Quellen mit unserem Autor einer genaueren Prüfung unterzogen haben,
erübrigt uns jetzt die Technik des Theophilus, wie sie in der Schedula beschrieben
ist, eingehender zu erläutern.
Beginnen wir mit der Malerei auf Mauern, welche 0. XV lehrt, nach-
dem im vorhergehenden Kapitel über Farbenmischungen der Gewänder für Pergament-
malerei gehandelt worden:
(C. XV.) Von der Farbenmischung für Gewänder auf der Mauer.
„Auf der Mauer aber decke das Gewand mit Ocker, nachdem du ihm
des Glanzes wegen etwas Kalk beigemischt, und mache die Schatten ent-
weder mit blossem Rot, oder Prasinus oder Posch, welches selbst aus
Ocker und Grün entsteht. Die Hautfarbe wird auf der Mauer aus Ocker,
Zinnober und Kalk gemischt, das Posch und Rosa derselben und die
Lichter werden wie beschrieben (C. I—XIII) gemacht. Wenn Bildnisse
oder Abbilder anderer Dinge auf der trockenen Wand entworfen werden,
soll sie sogleich mit Wasser besprengt werden, so lange bis sie durchaus
uns bereits bekannten Quellen des Nordens, der Mapp. clav. und dem III. Buch des
Heraclius, soweit es sich uni das Technische handelt, feststellen. Da diese Quellen
untereinander viel Gleichartiges aufweisen und sich sogar in wesentlichen Punkten von den
uns bekannten byzantinischen Quellen unterscheiden, so würden wir zu dem Schlüsse
kommen, dass die im Theophilus beschriebene Technik eigentlich als etwas ganz Selb-
ständiges anzusehen sein dürfte. Seine Bemerkung „Griechenlands Farbenmischungen“
zu zeigen, scheint sich vielmehr darauf zu beziehen , dass im XI. und XII. Jh. die
griechische Kunst überhaupt noch in grösstem Ansehen stand und als mustergiltiges
Vorbild zu dienen hatte. In C. XXIII nennt Theophilus Baumwollenpapier „griech-
isches“ Pergament.
Im vorigen Abschnitt war mehrfach schon Gelegenheit auf die Gleichartigkeit
einzelner Anweisungen der Map]), und des Heraclius mit dem I. Buche des Theophilus
hinzuweisen Diese Gleichartigkeit bestand sowohl in der Bereitung der Bindemittel,
als auch in der Zurichtung der Tafeln für Malzwecke. So haben wir in C. XX (die
Thürflügel rot zu machen und vom Leinöl) das gleiche Verfahren erkannt, wie in G. XXV*
des Heraclius, in welchem die mit Oel geriebenen Farben mit dem Pinsel aufzutragen
und an der Sonne zu trocknen gelehrt wird. Die Gleichheit des Ueberziehens der
Holztafel mit Ledei· oder Leinen wurde bereits erwähnt (p. 39); die Farben mit Firnis
zu überziehen (Heraclius C. XXI.), das zur Herstellung des gefärbten Firnisses (Auri-
petrum) dienende Verfahren, sehen wir auch bei Theophilus wieder, hauptsächlich bei
jener Art der Malerei, die Piotura translucida (C. XXIX) genannt wird. Auch liessen
sich noch eine ganze Reihe von Parallelstellen in Bezug auf Miniaturmalerei, Bereitung
von Farben und Vergoldung, aufzählen. Die Reihe der Bindemittel war bei Heraclius
eine besonders grosse ; sie ist im Vergleich zu unserer Quelle, dem Theophilus, bedeu-
tend geringer: aber dieselben sind ohne die dort nötig gewordenen Kombinationen
besser zu verstehen.
Der Käseleim (C. XVII), den frühere Ms., Lucca-Ms. und Mapp, erwähnen, ist
bei Theophilus nm· zum Leimen von Altartafeln und Thüren, sowie zum Aufspannen
von Leder darüber genannt; er ist dem Heraclius unbekannt.
Leim aus Ledei· oder Horn (Hirschgeweih), verschiedene Gummiarten (Kirsch-
oder Pflaumenbaumharz), Eierklar und Eidotter, Leinöl kennt auch Theophilus ; Wein
oder Bier (Heraclius 0. XXVIII) dient bei ihm gleichfalls zur Färbung der mit Oel-
firnis bestrichenen Zinnfolie (C. XXVI).
Alaun (Heracl. XXX) ist in der Schedula mehrfach für Goldschrift (XXXVII)
verwendet, auch die Ochsengalle erscheint wieder (XXXVI).
Der Fischleim, das altbewährte Bindemittel des Lucca-Ms. und von Mapp. clav.
ist am Schlüsse des C. XXX (huso, Hausen) genannt und geht dessen Anwendung in der
Goldmalerei (C. XXXVIII) deutlich hervor. Dieses Kapitel ist in dem Wolfenbütteier
Codex zum C. XXX gehörig und im Zusammenhang mit diesem deutlicher zu verstehen.
Technik des Theophilus.
Nachdem wir die zeitlich vorhergegangenen, ebenso wie die gleichzeitigen und
darauffolgenden Quellen mit unserem Autor einer genaueren Prüfung unterzogen haben,
erübrigt uns jetzt die Technik des Theophilus, wie sie in der Schedula beschrieben
ist, eingehender zu erläutern.
Beginnen wir mit der Malerei auf Mauern, welche 0. XV lehrt, nach-
dem im vorhergehenden Kapitel über Farbenmischungen der Gewänder für Pergament-
malerei gehandelt worden:
(C. XV.) Von der Farbenmischung für Gewänder auf der Mauer.
„Auf der Mauer aber decke das Gewand mit Ocker, nachdem du ihm
des Glanzes wegen etwas Kalk beigemischt, und mache die Schatten ent-
weder mit blossem Rot, oder Prasinus oder Posch, welches selbst aus
Ocker und Grün entsteht. Die Hautfarbe wird auf der Mauer aus Ocker,
Zinnober und Kalk gemischt, das Posch und Rosa derselben und die
Lichter werden wie beschrieben (C. I—XIII) gemacht. Wenn Bildnisse
oder Abbilder anderer Dinge auf der trockenen Wand entworfen werden,
soll sie sogleich mit Wasser besprengt werden, so lange bis sie durchaus