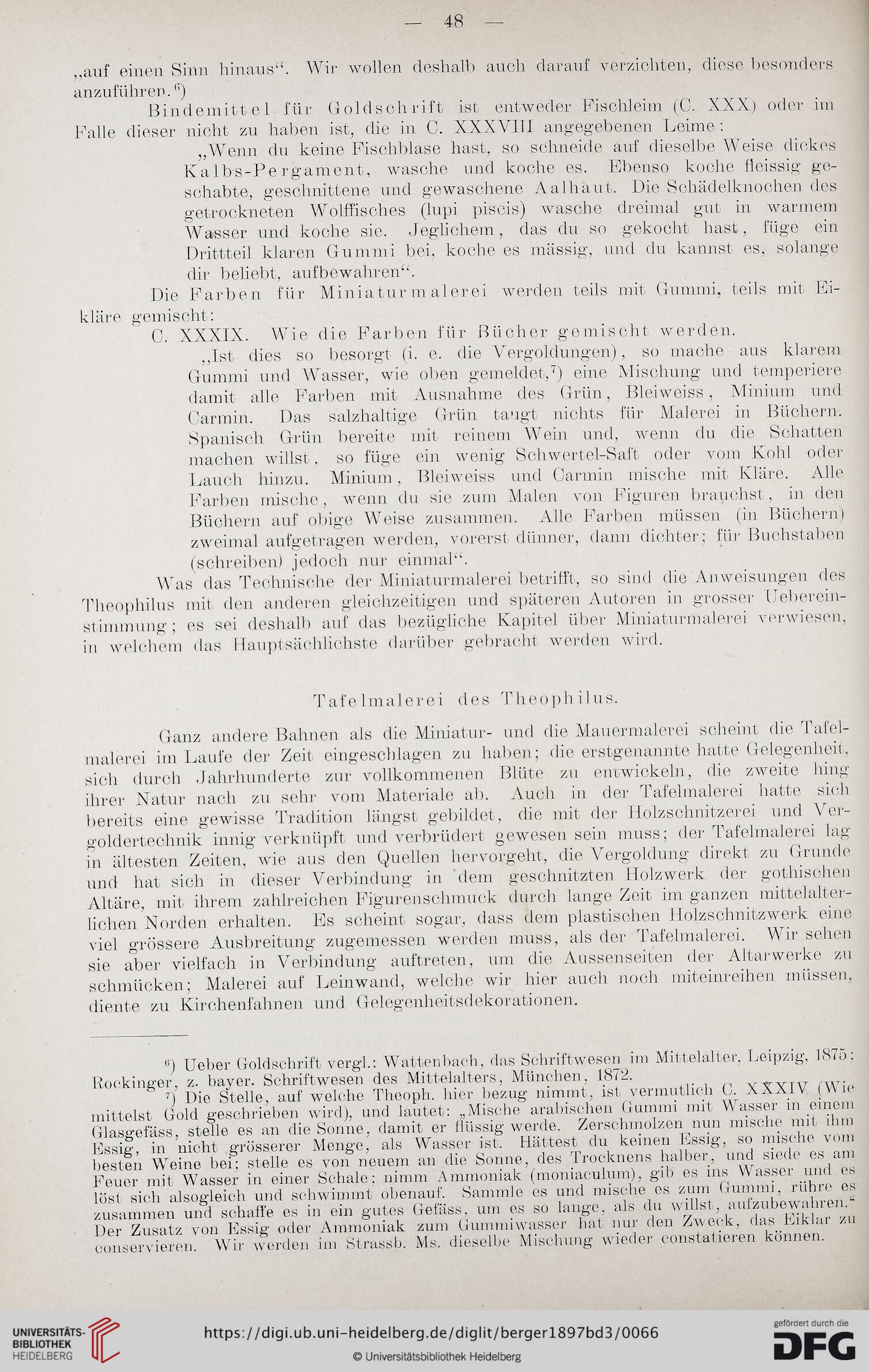48
„auf einen Sinn hinaus“. Wir wollen deshalb auch darauf verzichten, diese besonders
anzuführen.ß)
Bindemittel für Goldschrift ist entweder Fischleiin (G. XXX) oder im
Falle dieser nicht zu haben ist, die in C. XXXVIII angegebenen Leime :
„Wenn du keine Fischblase hast, so schneide auf dieselbe Weise dickes
Kalbs-Pergament, wasche und koche es. Ebenso koche fleissig ge-
schabte, geschnittene und gewaschene Aalhaut. Die Schädelknochen des
getrockneten Wolffisches (lupi piscis) wasche dreimal gut in warmem
Wasser und koche sie. Jeglichem, das du so gekocht hast, füge ein
Drittteil klaren Gummi bei, koche es mässig, und du kannst es, solange
dir behebt, auf bewahren“.
Die Farben für Miniaturmalerei werden teils mit Gummi, teils mit Er-
kläre gemischt:
C. XXXIX. Wie die Farben für Bücher gemischt werden.
„Ist dies so besorgt (i. e. die Vergoldungen), so mache aus klarem
Gummi und Wasser, wie oben gemeldet,* * 7) eine Mischung und temperiere
damit alle Farben mit Ausnahme des Grün, Bleiweiss, Minium und
Garmin. Das salzhaltige Grün taugt nichts für Malerei in Büchern.
Spanisch Grün bereite mit reinem Wein und, wenn du die Schatten
machen willst, so füge ein wenig Schwertel-Saft oder vom Kohl oder
Lauch hinzu. Minium, Blei weiss und Garmin mische mit Kläre. Alle
Farben mische, wenn du sie zum Malen von Figuren brauchst, in den
Büchern auf obige Weise zusammen. Alle Farben müssen (in Büchern)
zweimal aufgetragen werden, vorerst dünner, dann dichter; für Buchstaben
(schreiben) jedoch nur einmal“'.
Was das Technische der Miniaturmalerei betrifft, so sind die Anweisungen des
Theophilus mit den anderen gleichzeitigen und späteren Autoren in grosser Ueberein-
stimmung; es sei deshalb auf das bezügliche Kapitel über Miniaturmalerei verwiesen,
in welchem das Hauptsächlichste darüber gebracht werden wird.
TafeImalerei des Theophilus.
Ganz andere Bahnen als die Miniatur- und die Mauermalerei scheint, die Tafel-
malerei im Laufe der Zeit eingeschlagen zu haben; die erstgenannte hatte Gelegenheit,
sich durch Jahrhunderte zur vollkommenen Blüte zu entwickeln, die zweite hing
ihrer Natur nach zu sehr vom Materiale ab. Auch in der Tafelmalerei hatte sich
bereits eine gewisse Tradition längst gebildet, die mit der Holzschnitzerei und Ver-
goldertechnik innig verknüpft und verbrüdert gewesen sein muss; der Tafelmalerei lag
in ältesten Zeiten, wie aus den Quellen hervorgeht, die Vergoldung direkt zu Grunde
und hat sich in dieser Verbindung in dem geschnitzten Holzwerk der gothischen
Altäre, mit ihrem zahlreichen Figurenschmuck durch lange Zeit im ganzen mittelalter-
lichen Norden erhalten. Es scheint sogar, dass dem plastischen Holzschnitzwerk eine
viel grössere Ausbreitung zugemessen werden muss, als der Tafelmalerei. Wir sehen
sie aber vielfach in Verbindung auftreten, um die Aussenseiten der Altarwerke zu
schmücken; Malerei auf Leinwand, welche wir hier auch noch miteinreihen müssen,
diente zu Kirchenfahnen und Gelegenheitsdekorationen.
c) Ueber Goldschrift vergl.: Wattenbach, das Schriftwesen im Mittelalter, Leipzig, 1875:
Rockinger, z. bayer. Schriftwesen des Mittelalters, München, 1872.
7) Die Stehe, auf welche Theoph. hier bezug nimmt, ist, vermutlich C. XXXIV (Wie
mittelst Gold geschrieben wird), und lautet: „Mische arabischen Gummi mit Wasser in einem
Glasgefäss, stelle es an die Sonne, damit er flüssig werde. Zerschmolzen nun mische mit ihm
Essig, in nicht grösserer Menge, als Wasser ist. Hättest du keinen Essig, so mische vom
besten Weine bei; stelle es von neuem an die Sonne, des Trocknens halber, und siede es am
Feuer mit Wasser in einer Schale; nimm Ammoniak (moniaculum), gib es ins Wasser und es
löst sich alsogleich und schwimmt obenauf. Sammle es und mische es zum Gummi, rühre es
zusammen und schaffe es in ein gutes Gefäss, um es so lange, als du willst, aufzubewahren.“
Der Zusatz von Essig oder Ammoniak zum Gummiwasser hat nur den Zweck, das Eiklar zu
conservieren. Wir werden im Strassb. Ms. dieselbe Mischung wieder constatieren können.
„auf einen Sinn hinaus“. Wir wollen deshalb auch darauf verzichten, diese besonders
anzuführen.ß)
Bindemittel für Goldschrift ist entweder Fischleiin (G. XXX) oder im
Falle dieser nicht zu haben ist, die in C. XXXVIII angegebenen Leime :
„Wenn du keine Fischblase hast, so schneide auf dieselbe Weise dickes
Kalbs-Pergament, wasche und koche es. Ebenso koche fleissig ge-
schabte, geschnittene und gewaschene Aalhaut. Die Schädelknochen des
getrockneten Wolffisches (lupi piscis) wasche dreimal gut in warmem
Wasser und koche sie. Jeglichem, das du so gekocht hast, füge ein
Drittteil klaren Gummi bei, koche es mässig, und du kannst es, solange
dir behebt, auf bewahren“.
Die Farben für Miniaturmalerei werden teils mit Gummi, teils mit Er-
kläre gemischt:
C. XXXIX. Wie die Farben für Bücher gemischt werden.
„Ist dies so besorgt (i. e. die Vergoldungen), so mache aus klarem
Gummi und Wasser, wie oben gemeldet,* * 7) eine Mischung und temperiere
damit alle Farben mit Ausnahme des Grün, Bleiweiss, Minium und
Garmin. Das salzhaltige Grün taugt nichts für Malerei in Büchern.
Spanisch Grün bereite mit reinem Wein und, wenn du die Schatten
machen willst, so füge ein wenig Schwertel-Saft oder vom Kohl oder
Lauch hinzu. Minium, Blei weiss und Garmin mische mit Kläre. Alle
Farben mische, wenn du sie zum Malen von Figuren brauchst, in den
Büchern auf obige Weise zusammen. Alle Farben müssen (in Büchern)
zweimal aufgetragen werden, vorerst dünner, dann dichter; für Buchstaben
(schreiben) jedoch nur einmal“'.
Was das Technische der Miniaturmalerei betrifft, so sind die Anweisungen des
Theophilus mit den anderen gleichzeitigen und späteren Autoren in grosser Ueberein-
stimmung; es sei deshalb auf das bezügliche Kapitel über Miniaturmalerei verwiesen,
in welchem das Hauptsächlichste darüber gebracht werden wird.
TafeImalerei des Theophilus.
Ganz andere Bahnen als die Miniatur- und die Mauermalerei scheint, die Tafel-
malerei im Laufe der Zeit eingeschlagen zu haben; die erstgenannte hatte Gelegenheit,
sich durch Jahrhunderte zur vollkommenen Blüte zu entwickeln, die zweite hing
ihrer Natur nach zu sehr vom Materiale ab. Auch in der Tafelmalerei hatte sich
bereits eine gewisse Tradition längst gebildet, die mit der Holzschnitzerei und Ver-
goldertechnik innig verknüpft und verbrüdert gewesen sein muss; der Tafelmalerei lag
in ältesten Zeiten, wie aus den Quellen hervorgeht, die Vergoldung direkt zu Grunde
und hat sich in dieser Verbindung in dem geschnitzten Holzwerk der gothischen
Altäre, mit ihrem zahlreichen Figurenschmuck durch lange Zeit im ganzen mittelalter-
lichen Norden erhalten. Es scheint sogar, dass dem plastischen Holzschnitzwerk eine
viel grössere Ausbreitung zugemessen werden muss, als der Tafelmalerei. Wir sehen
sie aber vielfach in Verbindung auftreten, um die Aussenseiten der Altarwerke zu
schmücken; Malerei auf Leinwand, welche wir hier auch noch miteinreihen müssen,
diente zu Kirchenfahnen und Gelegenheitsdekorationen.
c) Ueber Goldschrift vergl.: Wattenbach, das Schriftwesen im Mittelalter, Leipzig, 1875:
Rockinger, z. bayer. Schriftwesen des Mittelalters, München, 1872.
7) Die Stehe, auf welche Theoph. hier bezug nimmt, ist, vermutlich C. XXXIV (Wie
mittelst Gold geschrieben wird), und lautet: „Mische arabischen Gummi mit Wasser in einem
Glasgefäss, stelle es an die Sonne, damit er flüssig werde. Zerschmolzen nun mische mit ihm
Essig, in nicht grösserer Menge, als Wasser ist. Hättest du keinen Essig, so mische vom
besten Weine bei; stelle es von neuem an die Sonne, des Trocknens halber, und siede es am
Feuer mit Wasser in einer Schale; nimm Ammoniak (moniaculum), gib es ins Wasser und es
löst sich alsogleich und schwimmt obenauf. Sammle es und mische es zum Gummi, rühre es
zusammen und schaffe es in ein gutes Gefäss, um es so lange, als du willst, aufzubewahren.“
Der Zusatz von Essig oder Ammoniak zum Gummiwasser hat nur den Zweck, das Eiklar zu
conservieren. Wir werden im Strassb. Ms. dieselbe Mischung wieder constatieren können.