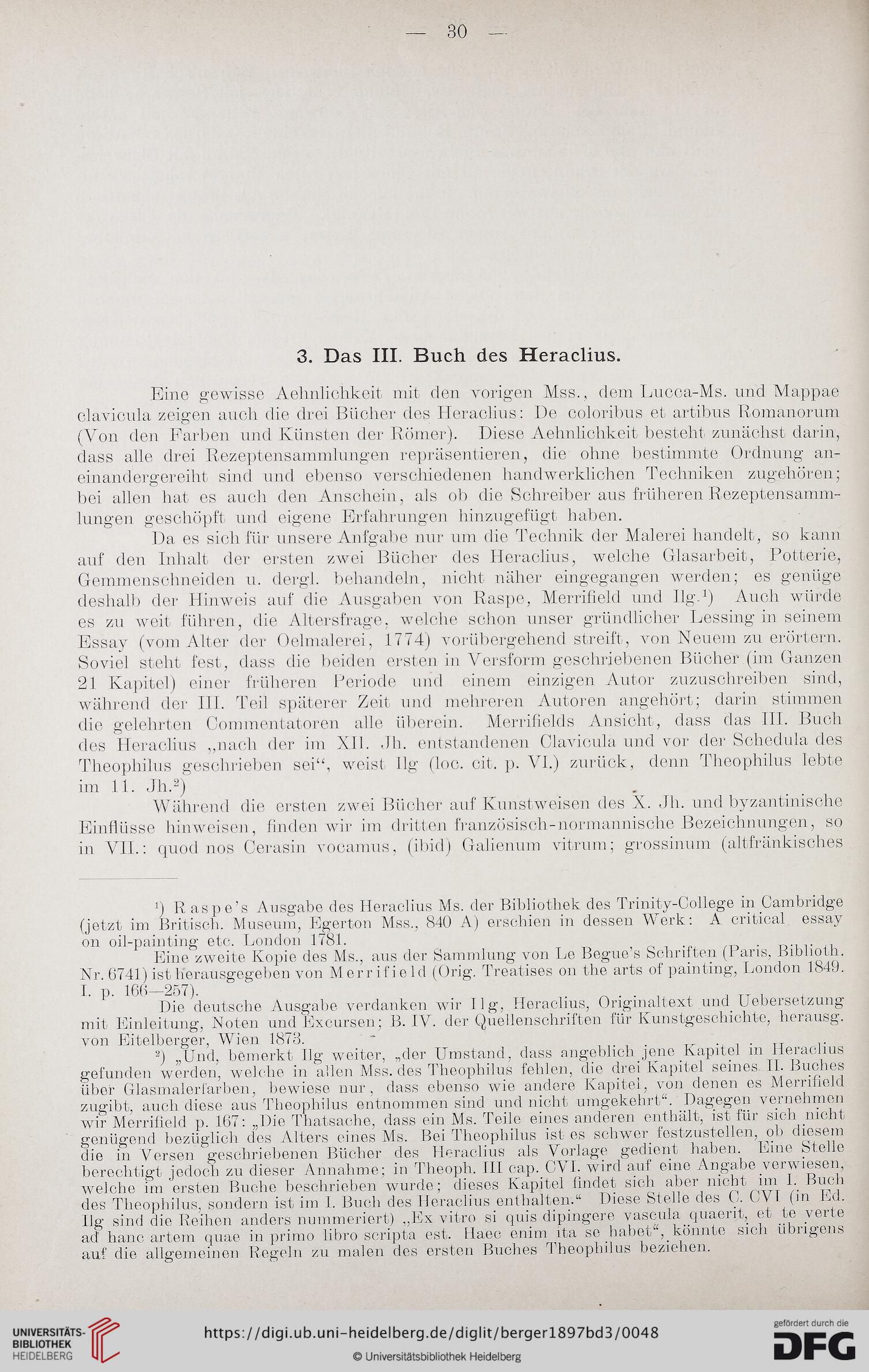30
3. Das III. Buch des Heraclius.
Eine gewisse Aehnlichkeit mit den vorigen Mss., dem Lucca-Ms. und Mappae
clavicula zeigen auch die drei Bücher des Heraclius: De coloribus et artibus Romanorum
(Von den Farben und Künsten der Römer). Diese Aehnlichkeit besteht zunächst darin,
dass alle drei Rezeptensammlungen repräsentieren, die ohne bestimmte Ordnung an-
einandergereiht sind und ebenso verschiedenen handwerklichen Techniken zugehören;
bei allen hat es auch den Anschein, als ob die Schreiber aus früheren Rezeptensamm-
lungen geschöpft und eigene Erfahrungen hinzugefügt haben.
Da es sich für unsere Aufgabe nur um die Technik der Malerei handelt, so kann
auf den Inhalt der ersten zwei Bücher des Heraclius, welche Glasarbeit, Potterie,
Gemmenschneiden u. dergl. behandeln, nicht näher eingegangen werden; es genüge
deshalb der Hinweis auf die Ausgaben von Raspe, Merrifield und Ilg.1) Auch würde
es zu weit führen, die Altersfrage, weiche schon unser gründlicher Lessing in seinem
Essay (vom Alter der Oelmalerei, 1774) vorübergehend streift, von Neuem zu erörtern.
Soviel steht fest, dass die beiden ersten in Versform geschriebenen Bücher (im Ganzen
21 Kapitel) einer früheren Periode und einem einzigen Autor zuzuschreiben sind,
während der III. Teil späterer Zeit und mehreren Autoren angehört; darin stimmen
die gelehrten Commentatoren alle überein. Merrifields Ansicht, dass das HL Buch
des Heraclius „nach der im XII. Jh. entstandenen Clavicula und vor der Schedula des
Theophilus geschrieben sei“, weist 11g (loc. eit. p. VI.) zurück, denn Theophilus lebte
im 11. Jh.2)
Während die ersten zwei Bücher auf Kunstweisen des X. Jh. und byzantinische
Einflüsse hinweisen, finden wir im dritten französisch-normannische Bezeichnungen, so
in VII.: quod nos Cerasin vocamus, (ibid) Galienum vitrum; grossinum (altfränkisches
’) R aspe’s Ausgabe des Heraclius Ms. der Bibliothek des Trinity-College in Cambridge
(jetzt im Britisch. Museum, Egerton Mss., 840 A) erschien in dessen Werk: A. critical essay
on oil-painting etc. London 1781.
Eine zweite Kopie des Ms., aus der Sammlung von Le Begue’s Schriften (Paris, Biblioth.
Nr. 6741) ist herausgegeben von Merrifield (Orig. Treatises on the arts of painting, London 1849.
I. p. 166—257).
Die deutsche Ausgabe verdanken wir Ilg, Heraclius, Originaltext und Uebersetzung
mit Einleitung, Noten und Excursen; B. IV. der Quellenschriften für Kunstgeschichte, herausg.
von Eitelberger, Wien 1873.
2) „Und, bemerkt Ilg weiter, „der Umstand, dass angeblich jene Kapitel in Heraclius
gefunden werden, welche in allen Mss. des Theophilus fehlen, die drei Kapitel seines II. Buches
über Glasmalerfarben, bewiese nur, dass ebenso wie andere Kapitel, von denen es Merrifield
zugibt, auch diese aus Theophilus entnommen sind und nicht umgekehrt“. Dagegen vernehmen
wir Merrifield p. 167: „Die Thatsache, dass ein Ms. Teile eines anderen enthält, ist für sich nicht
genügend bezüglich des Alters eines Ms. Bei Theophilus ist es schwer festzustellen, ob diesem
die in Versen geschriebenen Bücher des Heraclius als Vorlage gedient haben. Eine Stelle
berechtigt jedoch zu dieser Annahme; in Theoph. III cap. CVI. wird auf eine Angabe verwiesen,
welche im ersten Buche beschrieben wurde ; dieses Kapitel findet sich aber nicht im I. Buch
des Theophilus, sondern ist im I. Buch des Heraclius enthalten.“ Diese Stelle des C. CVI (in Ed.
Ilg sind die Reihen anders nummeriert) „Ex vitro si quis dipingere vascula quaerit, et te yerte
ad hanc artem quae in primo libro scripta est. Haec enim ita se habet“, könnte sich übrigens
auf die allgemeinen Regeln zu malen des ersten Buches Theophilus beziehen.
3. Das III. Buch des Heraclius.
Eine gewisse Aehnlichkeit mit den vorigen Mss., dem Lucca-Ms. und Mappae
clavicula zeigen auch die drei Bücher des Heraclius: De coloribus et artibus Romanorum
(Von den Farben und Künsten der Römer). Diese Aehnlichkeit besteht zunächst darin,
dass alle drei Rezeptensammlungen repräsentieren, die ohne bestimmte Ordnung an-
einandergereiht sind und ebenso verschiedenen handwerklichen Techniken zugehören;
bei allen hat es auch den Anschein, als ob die Schreiber aus früheren Rezeptensamm-
lungen geschöpft und eigene Erfahrungen hinzugefügt haben.
Da es sich für unsere Aufgabe nur um die Technik der Malerei handelt, so kann
auf den Inhalt der ersten zwei Bücher des Heraclius, welche Glasarbeit, Potterie,
Gemmenschneiden u. dergl. behandeln, nicht näher eingegangen werden; es genüge
deshalb der Hinweis auf die Ausgaben von Raspe, Merrifield und Ilg.1) Auch würde
es zu weit führen, die Altersfrage, weiche schon unser gründlicher Lessing in seinem
Essay (vom Alter der Oelmalerei, 1774) vorübergehend streift, von Neuem zu erörtern.
Soviel steht fest, dass die beiden ersten in Versform geschriebenen Bücher (im Ganzen
21 Kapitel) einer früheren Periode und einem einzigen Autor zuzuschreiben sind,
während der III. Teil späterer Zeit und mehreren Autoren angehört; darin stimmen
die gelehrten Commentatoren alle überein. Merrifields Ansicht, dass das HL Buch
des Heraclius „nach der im XII. Jh. entstandenen Clavicula und vor der Schedula des
Theophilus geschrieben sei“, weist 11g (loc. eit. p. VI.) zurück, denn Theophilus lebte
im 11. Jh.2)
Während die ersten zwei Bücher auf Kunstweisen des X. Jh. und byzantinische
Einflüsse hinweisen, finden wir im dritten französisch-normannische Bezeichnungen, so
in VII.: quod nos Cerasin vocamus, (ibid) Galienum vitrum; grossinum (altfränkisches
’) R aspe’s Ausgabe des Heraclius Ms. der Bibliothek des Trinity-College in Cambridge
(jetzt im Britisch. Museum, Egerton Mss., 840 A) erschien in dessen Werk: A. critical essay
on oil-painting etc. London 1781.
Eine zweite Kopie des Ms., aus der Sammlung von Le Begue’s Schriften (Paris, Biblioth.
Nr. 6741) ist herausgegeben von Merrifield (Orig. Treatises on the arts of painting, London 1849.
I. p. 166—257).
Die deutsche Ausgabe verdanken wir Ilg, Heraclius, Originaltext und Uebersetzung
mit Einleitung, Noten und Excursen; B. IV. der Quellenschriften für Kunstgeschichte, herausg.
von Eitelberger, Wien 1873.
2) „Und, bemerkt Ilg weiter, „der Umstand, dass angeblich jene Kapitel in Heraclius
gefunden werden, welche in allen Mss. des Theophilus fehlen, die drei Kapitel seines II. Buches
über Glasmalerfarben, bewiese nur, dass ebenso wie andere Kapitel, von denen es Merrifield
zugibt, auch diese aus Theophilus entnommen sind und nicht umgekehrt“. Dagegen vernehmen
wir Merrifield p. 167: „Die Thatsache, dass ein Ms. Teile eines anderen enthält, ist für sich nicht
genügend bezüglich des Alters eines Ms. Bei Theophilus ist es schwer festzustellen, ob diesem
die in Versen geschriebenen Bücher des Heraclius als Vorlage gedient haben. Eine Stelle
berechtigt jedoch zu dieser Annahme; in Theoph. III cap. CVI. wird auf eine Angabe verwiesen,
welche im ersten Buche beschrieben wurde ; dieses Kapitel findet sich aber nicht im I. Buch
des Theophilus, sondern ist im I. Buch des Heraclius enthalten.“ Diese Stelle des C. CVI (in Ed.
Ilg sind die Reihen anders nummeriert) „Ex vitro si quis dipingere vascula quaerit, et te yerte
ad hanc artem quae in primo libro scripta est. Haec enim ita se habet“, könnte sich übrigens
auf die allgemeinen Regeln zu malen des ersten Buches Theophilus beziehen.