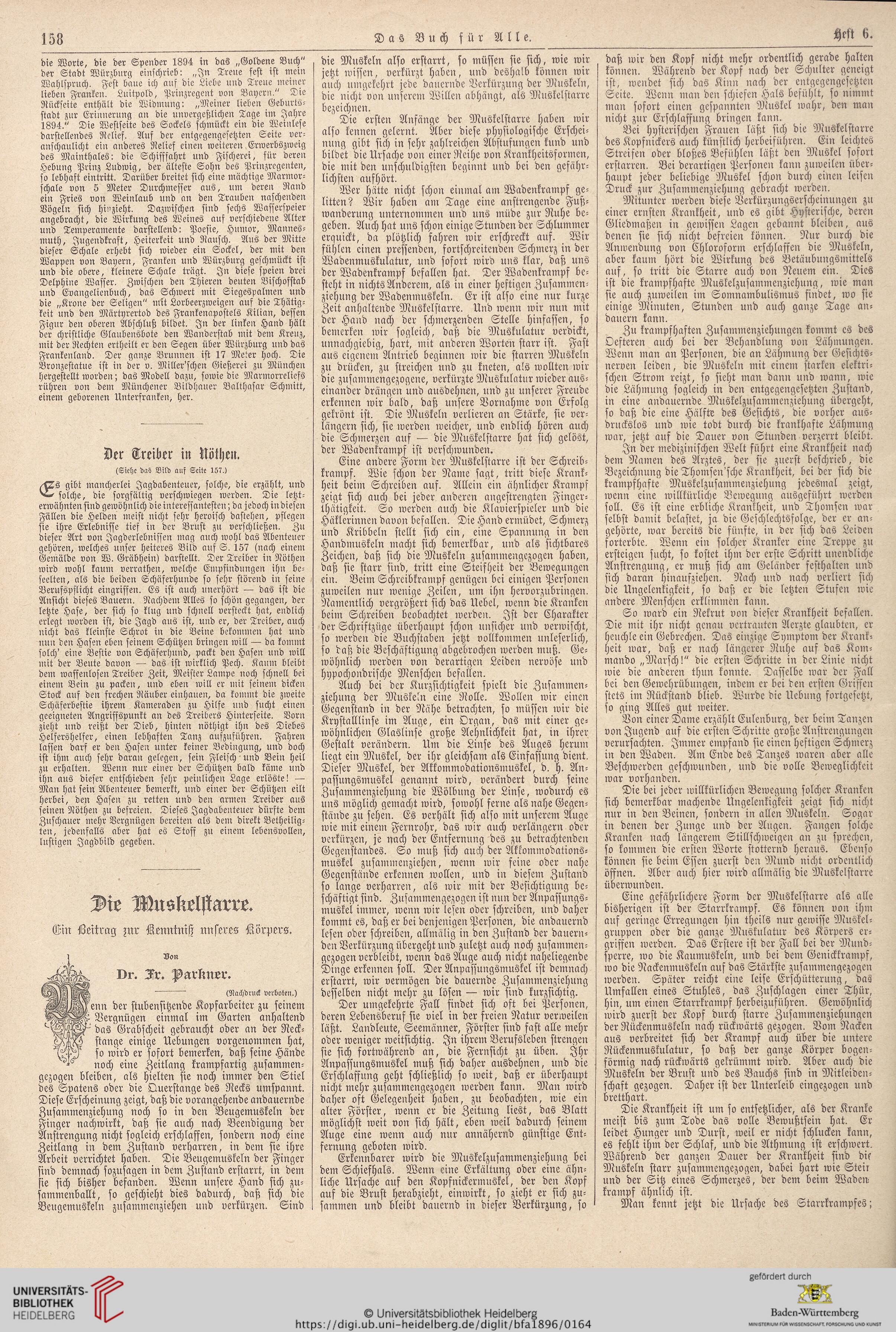158
Das Bum für Alle
Heft 6.
die Worte, die der Spender 1894 in das „Goldene Buch“
der Stadt Würzburg einſchrieh: „In Treue feſt iſt mein
Wahlſpruch. Feſt baue ich auf die Liebe und Treue meiner
lieben Franken. Luitpold, Prinzregent von Bayern.‘“ Die
Rückſeile enthält die Widmung: „Meiner lieben Gehurts-
ſtadt zur Erinnerung an die unpergeßlichen Tage im Jahre
1894.“ Die Weſtſeite des Sockels ſchmückt ein die Weinleſe
darſtellendes Relief. Auf der entgegengeſetzten Seite vex-
anſchaulicht ein anderes Relief einen weiteren Erwerbszweig
des Mainthales: die Schifffahrt und Fiſcherei, für dexen
Hebung Prinz Ludwig, der älteſte Sohn des Prinzregenten,
ſo lebhaft eintritt. Darüber breitet ſich eine mächtige Marmor-
ſchale von 5 Meter Durchmeſſer aus, um deren Rand
ein Fries von Weinlaub und an den Trauben naſchenden
Vögeln ſich hinzieht. Dazwiſchen ſind ſechs Waſſerſpeier
angebracht, die Wirkung des Weines auf perſchiedene Alter
und Temperamente darſtellend: Poeſie, Humor, Mannes-
muth, Jugendkraft, Heiterkeit und Rauſch. Aus der Mitte
dieſer Schale erhebt ſich wieder ein Sockel, der mit den
Waͤppen von Bayern, Franken und Würzbuxg geſchmückt iſt
und die obere, kleinere Schale trägt. In dieſe ſpeien drei
Delphine Wafſer. Zwiſchen den Thieren deuten Biſchofſtab
und Evangelienbuch, das Schwert mit Siegespalmen und
die „Krone der Seligen“ mit Lorbeerzweigen auf die Thätig-
keit und den Märtyrertod des Frankenapoſtels Kilian, deſſen
Figur den oberen Abſchluß bildet. In der linken Hand hält
der chriſtliche Glaubensbote den Wanderſtab mit dem Kreuz,
mit der Rechten ertheilt er den Segen über Würzburg und das
Frankenland. Der ganze Brunnen iſt 17 Meter hoch. Die
Bronzeſtatue iſt in der v. Miller'ſchen Gießerei zu München
hergeſtellt worden; das Modell dazu, ſowie die Marmorreliefs
rühren von dem Münchener Bildhauer Balthaſar Schmitt,
einem geborenen Unterfranken, her.
Der Treiber in Nöthen,
(Siehe das Bild auf Seite 157.)
E gibt mancherlei Jagdabenteuer, ſolche, die erzählt, und
ſolche, die ſorgfältig verſchwiegen werden. Die letzt-
erwähnten ſind gewöhnlich die intereſſanteſten; da jedoch in dieſen
Fällen die Helden meiſt nicht ſehr heroiſch daſtehen, pflegen
ſie ihre Erlebniſſe tief in der Bruſt zu verſchließen. Zu
dieſer Art von Jagderlebniſſen mag auch wohl das Abenteuer
gehören, welches unſer heiteres Bild auf S. 157 (nach einem
Gemälde von W. Gräbhein) darſtellt. Der Treiber in Nöthen
wird wohl kaum verraͤthen, welche Empfindungen ihn be-
ſeelten, als die beiden Schäferhunde ſo ſehr ſtörend in ſeine
Berufspflicht eingriffen. Es iſt auch unerhört — das iſt die
Anſicht dieſes Bauern. Nachdem Alles ſo ſchön gegangen, der
letzte Haſe, der ſich ſo klug und ſchnell verſteckt hat, endlich
erlegt worden iſt, die Jagd aus iſt, und er, der Treiber, auch
nicht das kleinſte Schrot in die Beine bekommen hat und
nun den Haſen eben ſeinem Schützen bringen will — da kommt
ſolch' eine Beſtie von Schäferhund, packt den Haſen und will
mit der Beute davon — das iſt wirklich Pech. Kaum bleibt
dem waffenloſen Treiber Zeit, Meiſter Lampe noch ſchnell bei
einem Bein zu packen, und eben will er mit ſeinem dicken
Stock auf den frechen Räuber einhauen, da kommt die zweite
Schäferbeſtie ihrem Kameraden zu Hilfe und ſucht einen
geeigneten Angriffspunkt an des Treibers Hinterſeite. Vorn
zieht und reißt der Dieb, hinten nöthigt ihn des Diebes
Helfershelfer, einen lebhaften Tanz aufzuführen. Fahren
laſſen darf er den Haſen unter keiner Bedingung, und doch
iſt ihm auch ſehr daran gelegen, ſein Fleiſch und Bein heil
zu erhalten. Wenn nur einer der Schützen bald käme und
ihn aus dieſer entſchieden ſehr peinlichen Lage erlöste! —
Man hat ſein Abenteuer bemerkt, und einer der Schützen eilt
herbei, den Haſen zu retten und den armen Treiber aus
ſeinen Nöthen zu befreien. Dieſes Jagdabenteuer dürfte dem
Zuſchauer mehr Vergnügen bereiten als dem direkt Betheilig-
ten, jedenfalls aber hat es Stoff zu einem lebensvollen,
luſtigen Jagdbild gegeben.
Die Musßhelſtarre.
Ein Beitrag zur Kenntniß unſeres Körpers.
Von
Dr. Fr. Parkner.
Nachdruck verboten.)
Fenn der ſtubenſitzende Kopfarbeiter zu ſeinem
y Vergnügen einmal im Garten anhaltend
das Graͤbſcheit gebraucht oder an der Reck-
*
ſo wird er fofort bemerken, daß ſeine Hände
noch eine Zeitlang krampfartig zuſammen-
gezogen bleiben, als hielten ſie noch immer den Stiel
des Spatens oder die Querſtange des Recks umſpannt.
Dieſe Erſcheinung zeigt, daß die vorangehende andauernde
Zuſammenziehung noch ſo in den Beugemuskeln der
Finger nachwirkt, daß ſie auch nach Beendigung der
Anſtrengung nicht ſogleich erſchlaffen, ſondern noch eine
Zeitlang in dem Zuſtand verharren, in dem ſie ihre
rbeit derrichtet haben. Die Beugemuskeln der Finger
ſind demnach ſozuſagen in dem Zuſtand erſtarrt, in dem
ſie ſich bisher befanden. Wenn unſere Hand ſich zu-
ſammenballt, ſo geſchieht dies dadurch, daß ſich die
Beugemuskeln zuſammenziehen und verkürzen. Sind
die Muskeln alſo erſtarrt, ſo müſſen ſie ſich, wie wir
jetzt wiſſen, verkürzt haben, und deshalb können wir
auch unigekehrt jede däuernde Verkürzung der Muskeln,
die nicht von unſerem Willen abhängt, als Muskelſtarre
bezeichnen.
Die erſten Anfänge der Muskelſtaxre haben wir
alſo kennen gelernt. Aber dieſe phyſiologiſche Erſchei-
nung gibt ſich in ſehr zahlreichen Abſtufungen kund und
bildet die Urſache von einer Reihe von Krankheitsformen,
die mit den unfchuldigſten beginnt und bei den gefähr-
lichſten aufhört.
litten? Wir haben am Tage eine anſtrengende Fuß-
wanderung unkernommen und uns müde zur Ruhe be-
geben. Auch hat uns ſchon einige Stunden der Schlummer
erquickt, da plötzlich fahren wir erſchreckt auf. Wir
fühlen einen preſſenden, fortſchreitenden Schmerz in der
Wadenmuskulatur, und ſofort wird uns klar, daß uns
der Wadenkrampf befallen hat. Der Wadenkrampf be-
ſteht in nichts Anderem, als in einer heftigen Zuſammen-
ziehung der Wadenmuskeln. Er iſt alſo eine nur kurze
Zeit anhaltende Muskelſtarre. Und wenn wir nun mit
bemerken wir ſogleich, daß die Muskulatur verdickt,
unnachgiebig, hark, mit anderen Worten ſtarr iſt. Faſt
aus eigenem Antrieb beginnen wir die ſtarren Muskeln
zu drücken, zu ſtreichen und zu kneten, als wollten wir
einander drängen und ausdehnen, und zu unſerer Freude
erkennen wir bald, daß unſere Vornahme von Erfolg
gekrönt iſt. Die Muskeln verlieren an Stärke, ſie ver-
längern ſich, ſie werden weicher, und endlich hören auch
der Wadenkrampf iſt verſchwunden.
Eine andere Form der Muskelſtarre iſt der Schreib-
krampf. Wie ſchon der Name ſagt, tritt dieſe Krank-
heit beim Schreiben auf. Allein ein ähnlicher Krampf
zeigt ſich auch bei jeder anderen angeſtrengten Finger-
ihätigfeit. So werden auch die Klavierſpieler und die
Häklerinnen davon befallen. Die Hand ermüdet, Schmerz
und Kribbeln ſtellt ſich ein, eine Spannung in den
Handmuskeln macht ſich bemerkbar, und als ſichtbares
Zeichen, daß ſich die Muskeln zuſammengezogen haben,
daß ſie ſtarr ſind, tritt eine Steifheit der Bewegungen
ein. Beim Schreibkrampf genügen bei einigen Perſonen
zuweilen nur wenige Zeilen, um ihn hervorzubringen.
Namentlich vergrößert ſich das Uebel, wenn die Kranken
beim Schreiben beobachtet werden. Iſt der Charakter
ſo werden die Buchſtaben jetzt vollkommen unleſerlich,
ſo daß die Beſchäftigung abgebrochen werden muß. Ge-
wöhnlich werden von derartigen Leiden nervöſe und
hypochondriſche Menſchen befallen.
Auch bei der Kurzſichtigkeit ſpielt die Zuſammen-
Wollen wir einen
Gegenſtand in der Nähe betrachten, ſo müſſen wir die
Kryſtalllinſe im Auge, ein Organ, das mit einer ge-
wöhnlichen Glaslinſe große Aehnlichkeit hat, in ihrer
Geſtalt verändern. Um die Linſe des Auges hexum
liegt ein Muskel, der ihr gleichſam als Einfaſſung dient.
Dieſer Muskel, der Akkommodationsmuskel, d. h. An-
paſſungsmuskel genannt wird, verändert durch ſeine
Zuſammenziehung die Wölbung der Linſe, wodurch es
uns möglich gemaͤcht wird, ſowohl ferne als nahe Gegen-
ſtände zu ſehen. Es verhält ſich alſo mit unſerem Auge
wie mit einem Fernrohr, das wir auch verlängern oder
verkürzen, je nach der Entfernung des zu betrachtenden
Gegenſtandes. So muß ſich auch der Akkommodations-
muskel zuſammenziehen, wenn wir feine oder nahe
Gegenſtände erkennen wollen, und in dieſem Zuſtand
ſo lange verharren, als wir mit der Beſichtigung be-
ſchäftigt ſind. Zuſammengezogen iſt nun der Anpaſſungs-
muskel immer, wenn wir leſen oder ſchreiben, und daher
kommt es, daß er bei denjenigen Perſonen, die andauernd
leſen oder ſchreiben, allmälig in den Zuſtand der dauern-
den Verkürzung übergeht und zuletzt auch noch zuſammen-
gezogen verbleibt, wenn das Auge auch nicht naheliegende
Dinge erkennen ſoll. Der Anpaſſungsmuskel iſt demnach
erſtarrt, wir vermögen die dauernde Zuſammenziehung
deſſelben nicht mehr zu löſen — wir ſind kurzſichtig.
Der umgekehrte Fall findet ſich oft bei Perſonen,
deren Lebensberuf ſie viel in der freien Natur verweilen
läßt. Landleute, Seemänner, Förſter ſind faſt alle mehr
oder weniger weitſichtig. In ihrem Berufsleben ſtrengen
ſie ſich fortwährend an, die Fernſicht zu üben.
Anpaſſungsmuskel muß ſich daher ausdehnen, und die
Erſchlaffung geht ſchließlich ſo weit, daß er überhaupt
nicht mehr zufammengezogen werden kann. Man wird
daher oft Gelegenheik haben, zu beobachten, wie ein
alter Förſter, wenn er die Zeitung liest, das Blatt
möglichſt weit von ſich hält, eben weil dadurch ſeinem
Auge eine wenn auch nur annähernd günſtige Ent-
fernung geboten wird.
Erkennbarer wird die Muskelzuſammenziehung bei
dem Schiefhals. Wenn eine Erkältung oder eine ähn-
liche Urſache auf den Kopfnickermuskel, der den Kopf
auf die Bruſt herabzieht, einwirkt, ſo zieht er ſich zu-
ſammen und bleibt dauernd in dieſer Verkürzung, ſo
daß wir den Kopf nicht mehr ordentlich gerade halten
können. Während der Kopf nach der Schulter geneigt
iſt, wendet fich das Kinn nach der entgegengeſetzten
Seite. Wenn man den ſchiefen Hals befühlt, ſo nimmt
man ſofort einen geſpannten Muskel wahr, den man
nicht zur Erſchlaffung bringen fann.
Bei hyſteriſchen Frauen läßt ſich die Muskelſtarre
des Kopfnickers auch künſtlich herbeiführen. Ein leichtes
Streifen oder bloßes Befühlen läßt den Muskel ſofort
erſtarten. Bei derartigen Perſonen kann zuweilen üher-
Druck zur Zuſammenziehung gebracht werden.
Milunter werden dieſe Verkürzungserſcheinungen zu
einer ernſten Krankheit, und es gibt Hyſteriſche, deren
Gliedmaßen in gewiſſen Lagen gebannt bleiben, aus
denen ſie ſich nicht befreien können. Nur durch die
Anwendung von Chloroform erſchlaffen die Muskeln,
aber kaum hört die Wirkung des Betäubungsmittels
auf, ſo tritk die Starre auch von Neuem ein. Dies
iſt die krampfhafte Muskelzuſammenziehung, wie man
ſie auch zuweilen im Somnambulismus findet, wo ſie
einige Minuten, Stunden und auch ganze Tage an-
dauern kann.
Zu krampfhaften Zuſammenziehungen kommt es des
Oefteren auch bei der Behandlung von Lähmungen.
Wenn man an Perſonen, die an Lähmung der Geſichts-
nerven leiden, die Muskeln mit einem ſtarken elektri-
ſchen Strom reizt, ſo ſieht man dann und wann, wie
die Lähmung ſogleich in den entgegengeſetzten Zuſtand,
in eine andauernde Muskelzuſammienziehung übergeht,
ſo daß die eine Hälfte des Geſichts, die vorher aus-
druckslos und wie todt durch die krankhafte Lähmung
war, jetzt auf die Dauer von Stunden verzerrt bleibt.
In der mediziniſchen Welt führt eine Krankheit nach
dem Namen des Arztes, der ſie zuerſt beſchrieb, die
Bezeichnung die Thomſen'ſche Krankheit, bei der ſich die
krampfhafte Muskelzuſammenziehung jedesmal zeigt,
wenn eine willkürliche Bewegung ausgeführt werden
ſoll. Es iſt eine erbliche Krankheit, und Thomſen war
ſelbſt damit belaſtet, ja die Geſchlechtsfolge, der er an-
gehörte, mar bereits die fünfte, in der ſich das Leiden
forterbte. Wenn ein ſolcher Kranker eine Treppe zu
erſteigen ſucht, ſo koſtet ihm der erſte Schritt unendliche
Anſtrengung, er muß ſich am Geländer feſthalten und
ſich daran hinaufziehen. Nach und nach verliert ſich
die Ungelenkigkeit, ſo daß er die letzten Stufen wie
andere Menſchen erklimmen kann.
So ward ein Rekrut von dieſer Krankheit befallen.
Die mit ihr nicht genau vertrauten Aerzte glaubten, er
heuchle ein Gebrechen. Das einzige Symptom der Krank-
heit war, daß er nach längerer Ruhe auf das Kom-
mando „Marſch!“ die erſten Schritte in der Linie nicht
wie die anderen thun konnte. Daſſelbe war der Fall
bei den Gewehrübungen, indem er bei den erſten Griffen
ſtets im Rückſtand blieb. Wurde die Uebung fortgeſetzt,
ſo ging Alles gut weiter.
Von einer Dame erzählt Eulenburg, der beim Tanzen
von Jugend auf die erſten Schritte große Anſtrengungen
verurſachten. Immer empfand ſie einen heftigen Schmerz
in den Waden Am Ende des Tanzes waren aber alle
Beſchwerden geſchwunden, und die volle Beweglichkeit
war vorhanden.
Die bei jeder willkürlichen Bewegung ſolcher Kranken
ſich bemerkbar machende Ungelenkigkeit zeigt ſich nicht
nur in den Beinen, ſondern in allen Muskeln. Sogar
in denen der Zunge und der Augen. Fangen ſolche
Kranken nach längerem Stillſchweigen an zu ſprechen,
ſo kommen die erſten Worte ſtotternd heraus. Ebenſo
können ſie beim Eſſen zuerſt den Mund nicht ordentlich
öffnen. Aber auch hier wird allmälig die Muskelſtarre
überwunden.
Eine gefährlichere Form der Muskelſtarre als alle
bisherigen iſt der Starrkrampf. Es können von ihm
auf geringe Erregungen hin theils nur gewiſſe Muskel-
gruppen oder diè ganze Muskulatur des Körpers er-
griffen werden. Das Erxſtere iſt der Fall bei der Mund-
ſperre, wo die Kaumuskeln, und bei dem Genickkrampf,
wo die Nackenmuskeln auf das Stärkſte zuſammengezogen
werden. Später reicht eine leiſe Erſchütterung, das
Umfallen eines Stuhles, das Zuſchlagen einer Thür,
hin, um einen Starrkrampf herbeizuführen. Gewöhnlich
wird zuerſt der Kopf durch ſtarre Zuſammenziehungen
der Ruͤckenmuskeln nach rückwärts gezogen. Vom Nacken
aus verbreitet ſich der Krampf auch über die untere
Rückenmuskulatur, ſo daß der ganze Körper bogen-
förmig nach rückwärts gekrümmt wird. Aber auch die
Muskeln der Bruſt und des Bauchs ſind in Mitleiden-
ſchaft gezogen. Daher iſt der Unterleib eingezogen und
bretthart.
Die Krankheit iſt um ſo entſetzlicher, als der Kranke
meiſt bis zum Tode das volle Bewußtſein hat. Er
leidet Hunger und Durſt, weil er nicht ſchlucken kann,
es fehlt ihm der Schlaf, und die Athmung iſt erſchwert.
Während der ganzen Dauer der Krankheit ſind die
Muskeln ſtarr zuſammengezogen, dabei hart wie Steir
und der Sitz eines Schmerzes, der dem beim Waden
krampf ähnlich iſt. *
Man kennt jetzt die Urſache des Starrkrampfes;
Das Bum für Alle
Heft 6.
die Worte, die der Spender 1894 in das „Goldene Buch“
der Stadt Würzburg einſchrieh: „In Treue feſt iſt mein
Wahlſpruch. Feſt baue ich auf die Liebe und Treue meiner
lieben Franken. Luitpold, Prinzregent von Bayern.‘“ Die
Rückſeile enthält die Widmung: „Meiner lieben Gehurts-
ſtadt zur Erinnerung an die unpergeßlichen Tage im Jahre
1894.“ Die Weſtſeite des Sockels ſchmückt ein die Weinleſe
darſtellendes Relief. Auf der entgegengeſetzten Seite vex-
anſchaulicht ein anderes Relief einen weiteren Erwerbszweig
des Mainthales: die Schifffahrt und Fiſcherei, für dexen
Hebung Prinz Ludwig, der älteſte Sohn des Prinzregenten,
ſo lebhaft eintritt. Darüber breitet ſich eine mächtige Marmor-
ſchale von 5 Meter Durchmeſſer aus, um deren Rand
ein Fries von Weinlaub und an den Trauben naſchenden
Vögeln ſich hinzieht. Dazwiſchen ſind ſechs Waſſerſpeier
angebracht, die Wirkung des Weines auf perſchiedene Alter
und Temperamente darſtellend: Poeſie, Humor, Mannes-
muth, Jugendkraft, Heiterkeit und Rauſch. Aus der Mitte
dieſer Schale erhebt ſich wieder ein Sockel, der mit den
Waͤppen von Bayern, Franken und Würzbuxg geſchmückt iſt
und die obere, kleinere Schale trägt. In dieſe ſpeien drei
Delphine Wafſer. Zwiſchen den Thieren deuten Biſchofſtab
und Evangelienbuch, das Schwert mit Siegespalmen und
die „Krone der Seligen“ mit Lorbeerzweigen auf die Thätig-
keit und den Märtyrertod des Frankenapoſtels Kilian, deſſen
Figur den oberen Abſchluß bildet. In der linken Hand hält
der chriſtliche Glaubensbote den Wanderſtab mit dem Kreuz,
mit der Rechten ertheilt er den Segen über Würzburg und das
Frankenland. Der ganze Brunnen iſt 17 Meter hoch. Die
Bronzeſtatue iſt in der v. Miller'ſchen Gießerei zu München
hergeſtellt worden; das Modell dazu, ſowie die Marmorreliefs
rühren von dem Münchener Bildhauer Balthaſar Schmitt,
einem geborenen Unterfranken, her.
Der Treiber in Nöthen,
(Siehe das Bild auf Seite 157.)
E gibt mancherlei Jagdabenteuer, ſolche, die erzählt, und
ſolche, die ſorgfältig verſchwiegen werden. Die letzt-
erwähnten ſind gewöhnlich die intereſſanteſten; da jedoch in dieſen
Fällen die Helden meiſt nicht ſehr heroiſch daſtehen, pflegen
ſie ihre Erlebniſſe tief in der Bruſt zu verſchließen. Zu
dieſer Art von Jagderlebniſſen mag auch wohl das Abenteuer
gehören, welches unſer heiteres Bild auf S. 157 (nach einem
Gemälde von W. Gräbhein) darſtellt. Der Treiber in Nöthen
wird wohl kaum verraͤthen, welche Empfindungen ihn be-
ſeelten, als die beiden Schäferhunde ſo ſehr ſtörend in ſeine
Berufspflicht eingriffen. Es iſt auch unerhört — das iſt die
Anſicht dieſes Bauern. Nachdem Alles ſo ſchön gegangen, der
letzte Haſe, der ſich ſo klug und ſchnell verſteckt hat, endlich
erlegt worden iſt, die Jagd aus iſt, und er, der Treiber, auch
nicht das kleinſte Schrot in die Beine bekommen hat und
nun den Haſen eben ſeinem Schützen bringen will — da kommt
ſolch' eine Beſtie von Schäferhund, packt den Haſen und will
mit der Beute davon — das iſt wirklich Pech. Kaum bleibt
dem waffenloſen Treiber Zeit, Meiſter Lampe noch ſchnell bei
einem Bein zu packen, und eben will er mit ſeinem dicken
Stock auf den frechen Räuber einhauen, da kommt die zweite
Schäferbeſtie ihrem Kameraden zu Hilfe und ſucht einen
geeigneten Angriffspunkt an des Treibers Hinterſeite. Vorn
zieht und reißt der Dieb, hinten nöthigt ihn des Diebes
Helfershelfer, einen lebhaften Tanz aufzuführen. Fahren
laſſen darf er den Haſen unter keiner Bedingung, und doch
iſt ihm auch ſehr daran gelegen, ſein Fleiſch und Bein heil
zu erhalten. Wenn nur einer der Schützen bald käme und
ihn aus dieſer entſchieden ſehr peinlichen Lage erlöste! —
Man hat ſein Abenteuer bemerkt, und einer der Schützen eilt
herbei, den Haſen zu retten und den armen Treiber aus
ſeinen Nöthen zu befreien. Dieſes Jagdabenteuer dürfte dem
Zuſchauer mehr Vergnügen bereiten als dem direkt Betheilig-
ten, jedenfalls aber hat es Stoff zu einem lebensvollen,
luſtigen Jagdbild gegeben.
Die Musßhelſtarre.
Ein Beitrag zur Kenntniß unſeres Körpers.
Von
Dr. Fr. Parkner.
Nachdruck verboten.)
Fenn der ſtubenſitzende Kopfarbeiter zu ſeinem
y Vergnügen einmal im Garten anhaltend
das Graͤbſcheit gebraucht oder an der Reck-
*
ſo wird er fofort bemerken, daß ſeine Hände
noch eine Zeitlang krampfartig zuſammen-
gezogen bleiben, als hielten ſie noch immer den Stiel
des Spatens oder die Querſtange des Recks umſpannt.
Dieſe Erſcheinung zeigt, daß die vorangehende andauernde
Zuſammenziehung noch ſo in den Beugemuskeln der
Finger nachwirkt, daß ſie auch nach Beendigung der
Anſtrengung nicht ſogleich erſchlaffen, ſondern noch eine
Zeitlang in dem Zuſtand verharren, in dem ſie ihre
rbeit derrichtet haben. Die Beugemuskeln der Finger
ſind demnach ſozuſagen in dem Zuſtand erſtarrt, in dem
ſie ſich bisher befanden. Wenn unſere Hand ſich zu-
ſammenballt, ſo geſchieht dies dadurch, daß ſich die
Beugemuskeln zuſammenziehen und verkürzen. Sind
die Muskeln alſo erſtarrt, ſo müſſen ſie ſich, wie wir
jetzt wiſſen, verkürzt haben, und deshalb können wir
auch unigekehrt jede däuernde Verkürzung der Muskeln,
die nicht von unſerem Willen abhängt, als Muskelſtarre
bezeichnen.
Die erſten Anfänge der Muskelſtaxre haben wir
alſo kennen gelernt. Aber dieſe phyſiologiſche Erſchei-
nung gibt ſich in ſehr zahlreichen Abſtufungen kund und
bildet die Urſache von einer Reihe von Krankheitsformen,
die mit den unfchuldigſten beginnt und bei den gefähr-
lichſten aufhört.
litten? Wir haben am Tage eine anſtrengende Fuß-
wanderung unkernommen und uns müde zur Ruhe be-
geben. Auch hat uns ſchon einige Stunden der Schlummer
erquickt, da plötzlich fahren wir erſchreckt auf. Wir
fühlen einen preſſenden, fortſchreitenden Schmerz in der
Wadenmuskulatur, und ſofort wird uns klar, daß uns
der Wadenkrampf befallen hat. Der Wadenkrampf be-
ſteht in nichts Anderem, als in einer heftigen Zuſammen-
ziehung der Wadenmuskeln. Er iſt alſo eine nur kurze
Zeit anhaltende Muskelſtarre. Und wenn wir nun mit
bemerken wir ſogleich, daß die Muskulatur verdickt,
unnachgiebig, hark, mit anderen Worten ſtarr iſt. Faſt
aus eigenem Antrieb beginnen wir die ſtarren Muskeln
zu drücken, zu ſtreichen und zu kneten, als wollten wir
einander drängen und ausdehnen, und zu unſerer Freude
erkennen wir bald, daß unſere Vornahme von Erfolg
gekrönt iſt. Die Muskeln verlieren an Stärke, ſie ver-
längern ſich, ſie werden weicher, und endlich hören auch
der Wadenkrampf iſt verſchwunden.
Eine andere Form der Muskelſtarre iſt der Schreib-
krampf. Wie ſchon der Name ſagt, tritt dieſe Krank-
heit beim Schreiben auf. Allein ein ähnlicher Krampf
zeigt ſich auch bei jeder anderen angeſtrengten Finger-
ihätigfeit. So werden auch die Klavierſpieler und die
Häklerinnen davon befallen. Die Hand ermüdet, Schmerz
und Kribbeln ſtellt ſich ein, eine Spannung in den
Handmuskeln macht ſich bemerkbar, und als ſichtbares
Zeichen, daß ſich die Muskeln zuſammengezogen haben,
daß ſie ſtarr ſind, tritt eine Steifheit der Bewegungen
ein. Beim Schreibkrampf genügen bei einigen Perſonen
zuweilen nur wenige Zeilen, um ihn hervorzubringen.
Namentlich vergrößert ſich das Uebel, wenn die Kranken
beim Schreiben beobachtet werden. Iſt der Charakter
ſo werden die Buchſtaben jetzt vollkommen unleſerlich,
ſo daß die Beſchäftigung abgebrochen werden muß. Ge-
wöhnlich werden von derartigen Leiden nervöſe und
hypochondriſche Menſchen befallen.
Auch bei der Kurzſichtigkeit ſpielt die Zuſammen-
Wollen wir einen
Gegenſtand in der Nähe betrachten, ſo müſſen wir die
Kryſtalllinſe im Auge, ein Organ, das mit einer ge-
wöhnlichen Glaslinſe große Aehnlichkeit hat, in ihrer
Geſtalt verändern. Um die Linſe des Auges hexum
liegt ein Muskel, der ihr gleichſam als Einfaſſung dient.
Dieſer Muskel, der Akkommodationsmuskel, d. h. An-
paſſungsmuskel genannt wird, verändert durch ſeine
Zuſammenziehung die Wölbung der Linſe, wodurch es
uns möglich gemaͤcht wird, ſowohl ferne als nahe Gegen-
ſtände zu ſehen. Es verhält ſich alſo mit unſerem Auge
wie mit einem Fernrohr, das wir auch verlängern oder
verkürzen, je nach der Entfernung des zu betrachtenden
Gegenſtandes. So muß ſich auch der Akkommodations-
muskel zuſammenziehen, wenn wir feine oder nahe
Gegenſtände erkennen wollen, und in dieſem Zuſtand
ſo lange verharren, als wir mit der Beſichtigung be-
ſchäftigt ſind. Zuſammengezogen iſt nun der Anpaſſungs-
muskel immer, wenn wir leſen oder ſchreiben, und daher
kommt es, daß er bei denjenigen Perſonen, die andauernd
leſen oder ſchreiben, allmälig in den Zuſtand der dauern-
den Verkürzung übergeht und zuletzt auch noch zuſammen-
gezogen verbleibt, wenn das Auge auch nicht naheliegende
Dinge erkennen ſoll. Der Anpaſſungsmuskel iſt demnach
erſtarrt, wir vermögen die dauernde Zuſammenziehung
deſſelben nicht mehr zu löſen — wir ſind kurzſichtig.
Der umgekehrte Fall findet ſich oft bei Perſonen,
deren Lebensberuf ſie viel in der freien Natur verweilen
läßt. Landleute, Seemänner, Förſter ſind faſt alle mehr
oder weniger weitſichtig. In ihrem Berufsleben ſtrengen
ſie ſich fortwährend an, die Fernſicht zu üben.
Anpaſſungsmuskel muß ſich daher ausdehnen, und die
Erſchlaffung geht ſchließlich ſo weit, daß er überhaupt
nicht mehr zufammengezogen werden kann. Man wird
daher oft Gelegenheik haben, zu beobachten, wie ein
alter Förſter, wenn er die Zeitung liest, das Blatt
möglichſt weit von ſich hält, eben weil dadurch ſeinem
Auge eine wenn auch nur annähernd günſtige Ent-
fernung geboten wird.
Erkennbarer wird die Muskelzuſammenziehung bei
dem Schiefhals. Wenn eine Erkältung oder eine ähn-
liche Urſache auf den Kopfnickermuskel, der den Kopf
auf die Bruſt herabzieht, einwirkt, ſo zieht er ſich zu-
ſammen und bleibt dauernd in dieſer Verkürzung, ſo
daß wir den Kopf nicht mehr ordentlich gerade halten
können. Während der Kopf nach der Schulter geneigt
iſt, wendet fich das Kinn nach der entgegengeſetzten
Seite. Wenn man den ſchiefen Hals befühlt, ſo nimmt
man ſofort einen geſpannten Muskel wahr, den man
nicht zur Erſchlaffung bringen fann.
Bei hyſteriſchen Frauen läßt ſich die Muskelſtarre
des Kopfnickers auch künſtlich herbeiführen. Ein leichtes
Streifen oder bloßes Befühlen läßt den Muskel ſofort
erſtarten. Bei derartigen Perſonen kann zuweilen üher-
Druck zur Zuſammenziehung gebracht werden.
Milunter werden dieſe Verkürzungserſcheinungen zu
einer ernſten Krankheit, und es gibt Hyſteriſche, deren
Gliedmaßen in gewiſſen Lagen gebannt bleiben, aus
denen ſie ſich nicht befreien können. Nur durch die
Anwendung von Chloroform erſchlaffen die Muskeln,
aber kaum hört die Wirkung des Betäubungsmittels
auf, ſo tritk die Starre auch von Neuem ein. Dies
iſt die krampfhafte Muskelzuſammenziehung, wie man
ſie auch zuweilen im Somnambulismus findet, wo ſie
einige Minuten, Stunden und auch ganze Tage an-
dauern kann.
Zu krampfhaften Zuſammenziehungen kommt es des
Oefteren auch bei der Behandlung von Lähmungen.
Wenn man an Perſonen, die an Lähmung der Geſichts-
nerven leiden, die Muskeln mit einem ſtarken elektri-
ſchen Strom reizt, ſo ſieht man dann und wann, wie
die Lähmung ſogleich in den entgegengeſetzten Zuſtand,
in eine andauernde Muskelzuſammienziehung übergeht,
ſo daß die eine Hälfte des Geſichts, die vorher aus-
druckslos und wie todt durch die krankhafte Lähmung
war, jetzt auf die Dauer von Stunden verzerrt bleibt.
In der mediziniſchen Welt führt eine Krankheit nach
dem Namen des Arztes, der ſie zuerſt beſchrieb, die
Bezeichnung die Thomſen'ſche Krankheit, bei der ſich die
krampfhafte Muskelzuſammenziehung jedesmal zeigt,
wenn eine willkürliche Bewegung ausgeführt werden
ſoll. Es iſt eine erbliche Krankheit, und Thomſen war
ſelbſt damit belaſtet, ja die Geſchlechtsfolge, der er an-
gehörte, mar bereits die fünfte, in der ſich das Leiden
forterbte. Wenn ein ſolcher Kranker eine Treppe zu
erſteigen ſucht, ſo koſtet ihm der erſte Schritt unendliche
Anſtrengung, er muß ſich am Geländer feſthalten und
ſich daran hinaufziehen. Nach und nach verliert ſich
die Ungelenkigkeit, ſo daß er die letzten Stufen wie
andere Menſchen erklimmen kann.
So ward ein Rekrut von dieſer Krankheit befallen.
Die mit ihr nicht genau vertrauten Aerzte glaubten, er
heuchle ein Gebrechen. Das einzige Symptom der Krank-
heit war, daß er nach längerer Ruhe auf das Kom-
mando „Marſch!“ die erſten Schritte in der Linie nicht
wie die anderen thun konnte. Daſſelbe war der Fall
bei den Gewehrübungen, indem er bei den erſten Griffen
ſtets im Rückſtand blieb. Wurde die Uebung fortgeſetzt,
ſo ging Alles gut weiter.
Von einer Dame erzählt Eulenburg, der beim Tanzen
von Jugend auf die erſten Schritte große Anſtrengungen
verurſachten. Immer empfand ſie einen heftigen Schmerz
in den Waden Am Ende des Tanzes waren aber alle
Beſchwerden geſchwunden, und die volle Beweglichkeit
war vorhanden.
Die bei jeder willkürlichen Bewegung ſolcher Kranken
ſich bemerkbar machende Ungelenkigkeit zeigt ſich nicht
nur in den Beinen, ſondern in allen Muskeln. Sogar
in denen der Zunge und der Augen. Fangen ſolche
Kranken nach längerem Stillſchweigen an zu ſprechen,
ſo kommen die erſten Worte ſtotternd heraus. Ebenſo
können ſie beim Eſſen zuerſt den Mund nicht ordentlich
öffnen. Aber auch hier wird allmälig die Muskelſtarre
überwunden.
Eine gefährlichere Form der Muskelſtarre als alle
bisherigen iſt der Starrkrampf. Es können von ihm
auf geringe Erregungen hin theils nur gewiſſe Muskel-
gruppen oder diè ganze Muskulatur des Körpers er-
griffen werden. Das Erxſtere iſt der Fall bei der Mund-
ſperre, wo die Kaumuskeln, und bei dem Genickkrampf,
wo die Nackenmuskeln auf das Stärkſte zuſammengezogen
werden. Später reicht eine leiſe Erſchütterung, das
Umfallen eines Stuhles, das Zuſchlagen einer Thür,
hin, um einen Starrkrampf herbeizuführen. Gewöhnlich
wird zuerſt der Kopf durch ſtarre Zuſammenziehungen
der Ruͤckenmuskeln nach rückwärts gezogen. Vom Nacken
aus verbreitet ſich der Krampf auch über die untere
Rückenmuskulatur, ſo daß der ganze Körper bogen-
förmig nach rückwärts gekrümmt wird. Aber auch die
Muskeln der Bruſt und des Bauchs ſind in Mitleiden-
ſchaft gezogen. Daher iſt der Unterleib eingezogen und
bretthart.
Die Krankheit iſt um ſo entſetzlicher, als der Kranke
meiſt bis zum Tode das volle Bewußtſein hat. Er
leidet Hunger und Durſt, weil er nicht ſchlucken kann,
es fehlt ihm der Schlaf, und die Athmung iſt erſchwert.
Während der ganzen Dauer der Krankheit ſind die
Muskeln ſtarr zuſammengezogen, dabei hart wie Steir
und der Sitz eines Schmerzes, der dem beim Waden
krampf ähnlich iſt. *
Man kennt jetzt die Urſache des Starrkrampfes;