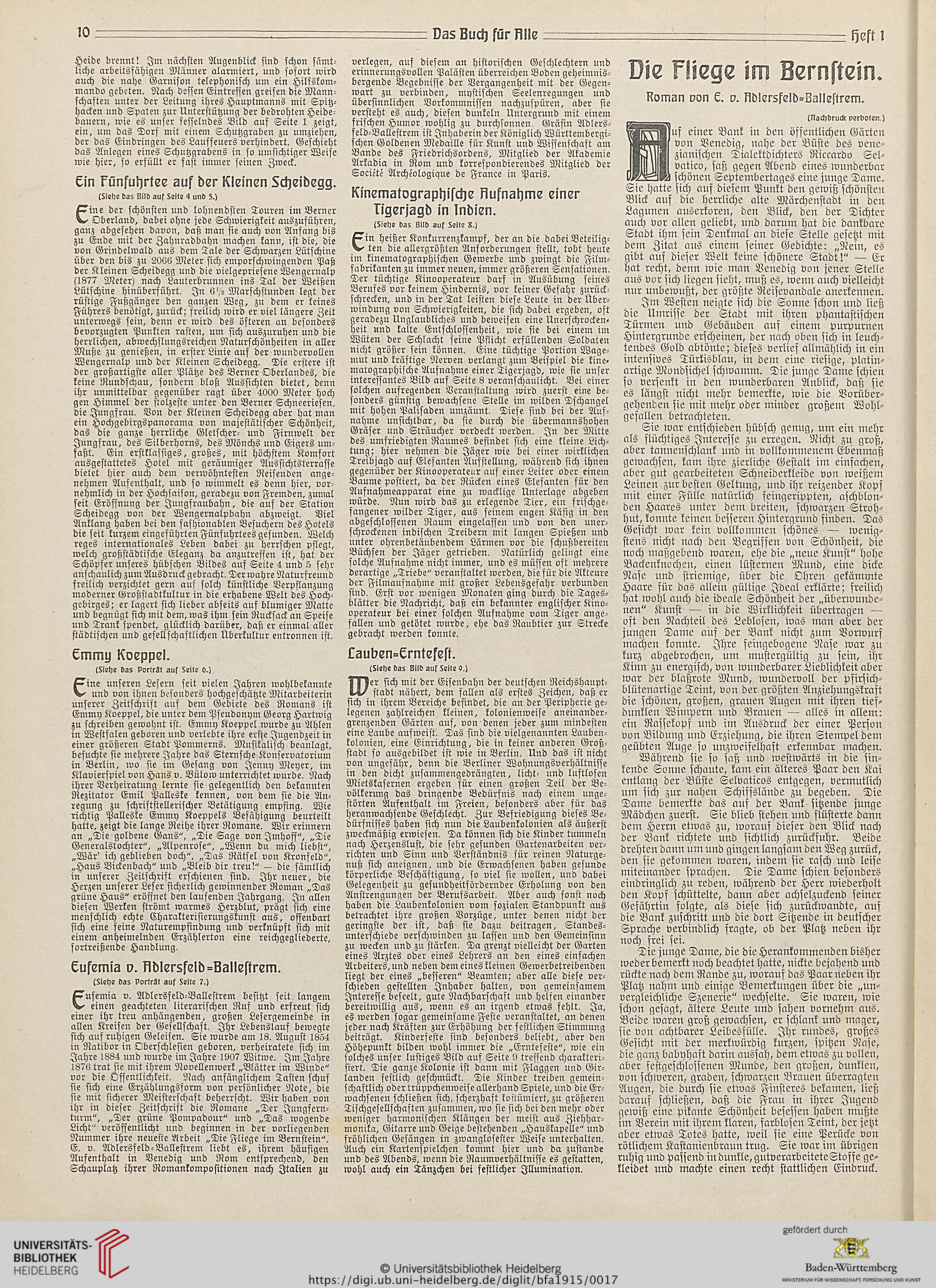10
V35 Luch füi- MIe
Heft 1
Heide brennt! Im nächsten Augenblick sind schon sämt-
liche arbeitsfähigen Männer alarmiert, und sofort wird
auch die nahe Garnison telephonisch um ein Hilfskom-
mando gebeten. Nach dessen Eintreffen greifen die Mann-
schaften unter der Leitung ihres Hauptmanns mit Spitz-
hacken und Spaten zur Unterstützung der bedrohten Heide-
bauern, wie es unser fesselndes Bild auf Seite 1 zeigt,
ein, um das Dorf mit einem Schutzgraben zu umziehen,
der das Eindringen des Lauffeuers verhindert. Geschieht
das Anlegen eines Schutzgrabens in so umsichtiger Weise
wie hier, so erfüllt er fast immer seinen Zweck.
Lin fünfuhrtee auf der Kleinen Scheidegg.
(Ziehe das Süd aus 8eite 4 und S.)
/^ine der schönsten und lohnendsten Touren im Berner
Oberland, dabei ohne jede Schwierigkeit auszuführen,
ganz abgesehen davon, daß man sie auch von Anfang bis
zu Ende mit der Zahnradbahn machen kann, ist die, die
von Grindelwald aus dem Tale der Schwarzen Lütschine
über den bis zu 2066 Meter sich emporschwingenden Paß
der Kleinen Scheidegg und die vielgepriesene Wengernalp
(1877 Meter) nach Lauterbrunnen ins Tal der Weißen
Lütschine hinübersührt. In 6V- Marschstunden legt der
rüstige Fußgänger den ganzen Weg, zu dem er "keines
Führers benötigt, zurück; freilich wird er viel längere Zeit
unterwegs sein, denn er wird des öfteren an besonders
bevorzugten Punkten rasten, um sich auszuruhen und die
herrlichen, abwechslungsreichen Naturschönheiten in aller
Muße zu genießen, in erster Linie auf der wundervollen
Wengernalp und der Kleinen Scheidegg. Die erstere ist
der großartigste aller Plätze des Berner Oberlandes, die
keine Rundschau, sondern bloß Aussichten bietet, denn
ihr unmittelbar gegenüber ragt über 4000 Meter hoch
gen Himmel der stolzeste unter den Berner Schneeriesen,
die Jungfrau. Von der Kleinen Scheidegg aber hat man
ein Hochgebirgspanorama von majestätischer Schönheit,
das die ganze herrliche Gletscher- und Firnwelt der
Jungfrau, des Silberhorns, des Mönchs und Eigers um-
faßt. Ein erstklassiges, großes, mit höchstem Komfort
ausgestattetes Hotel mit geräumiger Aussichtsterrasse
bietet hier auch dem verwöhntesten Reisenden ange-
nehmen Aufenthalt, und so wimmelt es denn hier, vor-
nehmlich in der Hochsaison, geradezu von Fremden, zumal
seit Eröffnung der Jungfraubahn, die aus der Station
Scheidegg von der Wengernalpbahn abzweigt. Viel
Anklang haben bei den sashionablen Besuchern des Hotels
die seit kurzem eingeführten Fünsuhrtees gefunden. Welch
reges internationales Leben dabei zu herrschen pflegt,
welch großstädtische Eleganz da anzutreffen ist, hat der
Schöpfer unseres hübschen Bildes auf Seite 4 und 5 sehr
anschaulich zum Ausdruck gebracht. Der wahre Naturfreund
freilich verzichtet gern aus solch künstliche Verpflanzung
moderner Großstadtkultur in die erhabene Welt des Hoch-
gebirges; er lagert sich lieber abseits auf blumiger Matte
und begnügt sich mit dem, was ihm sein Rucksack an Speise
und Trank spendet, glücklich darüber, daß er einmal aller
städtischen und gesellschaftlichen Überkultur entronnen ist.
Lmml) Koeppel.
(Ziehe das pottrLt auf Zeile ü.)
bine unseren Lesern seit vielen Jahren wohlbekannte
und von ihnen besonders hochgeschätzte Mitarbeiterin
unserer Zeitschrift auf dem Gebiete des Romans ist
Emmy Koeppel, die unter dem Pseudonym Georg Hartwig
zu schreiben gewohnt ist. Emmy Koeppel wurde zu Ahlen
in Westfalen geboren und verlebte ihre erste Jugendzeit in
einer größeren Stadt Pommerns. Musikalisch beanlagt,
besuchte sie mehrere Jahre das Sternsche Konservatorium
in Berlin, wo sie im Gesang von Jenny Meyer, im
Klavierspiel von Hans v. Bülow unterrichtet wurde. Nach
ihrer Verheiratung lernte sie gelegentlich den bekannten
Rezitator Emil Palleske kennen, von dem sie die An-
regung zu schriftstellerischer Betätigung empfing. Wie
richtig Palleske Emmy Koeppels Befähigung beurteilt
hatte, zeigt die lange Reihe ihrer Romane. Wir erinnern
an „Die goldene Gans", „Die Sage von Imhoff", „Die
Generalstochter", „Alpenrose", „Wenn du mich liebst",
„Wär' ich geblieben doch", „Das Rätsel von Kronfeld",
„Haus Bickenbach" und „Bleib dir treu!" — die sämtlich
in unserer Zeitschrift erschienen sind. Ihr neuer, die
Herzen unserer Leser sicherlich gewinnender Roman „Das
grüne Haus" eröffnet den laufenden Jahrgang. In allen
diesen Werken strömt warmes Herzblut, prägt sich eine
menschlich echte Charakterisierungskunst aus, offenbart
sich eine feine Naturempfindung und verknüpft sich mit
einem anheimelnden Erzählerton eine reichgegliederte,
fortreißende Handlung.
kufemia o. ffdlei'5feid--8aUestl'em.
(Ziehe das Porträt aus Zeüe 7.)
Eufemia v. Adlersfeld-Ballestrem besitzt seit langem
einen geachteten literarischen Ruf und erfreut sich
einer ihr treu anhängenden, großen Lesergemeinde in
allen Kreisen der Gesellschaft. Ihr Lebenslauf bewegte
sich auf ruhigen Geleisen. Sie wurde am 18. August 1854
in Natibor in Oberschlesien geboren, verheiratete sich im
Jahre 1884 und würbe im Jahre 1907 Witwe. Im Jahre
1876 trat sie mit ihrem Novellenwerk „Blätter im Winde"
vor die Öffentlichkeit. Nach anfänglichem Tasten schuf
sie sich eine Erzählungsform von persönlicher Note, die
sie mit sicherer Meisterschaft beherrscht. Wir haben von
ihr in dieser Zeitschrift die Romane „Der Jungfern-
turm", „Der grüne Pompadour" und „Das wogende
Licht" veröffentlicht und beginnen in der vorliegenden
Nummer ihre neueste Arbeit „Die Fliege im Bernstein".
E. v. Adlersfeld-Ballestrem liebt es, ihrem häufigen
Aufenthalt in Venedig und Rom entsprechend, den
Schauplatz ihrer Romankompositionen nach Italien zu
verlegen, auf diesem an historischen Geschlechtern und
erinnerungsvollen Palästen überreichen Boden geheimnis-
bergende Begebnisse der Vergangenheit mit der Gegen-
wart zu verbinden, mystischen Seelenregungen und
übersinnlichen Vorkommnissen nachzuspüren, aber sie
versteht es auch, diesen dunkeln Untergrund mit einem
frischen Humor wohlig zu durchsonnen. Gräfin Adlers-
seld-Ballestrem ist Inhaberin der Königlich Württembergi-
schen Goldenen Medaille für Kunst und Wissenschaft am
Bande des Friedrichsordens, Mitglied der Akademie
Arkadia in Rom und korrespondierendes Mitglied der
Societe Archeologique de France in Paris.
Kinematogl'aphische Ausnahme einer-
ligel-jagd in Indien.
(Ziehe das Süd aus Zeüe 8.)
^in heißer Konkurrenzkampf, der an die dabei Beteilig-
ten die allergrößten Anforderungen stellt, tobt heute
im kinematographischen Gewerbe und zwingt die Film-
fabrikanten zu immer neuen, immer größeren Sensationen.
Der tüchtige Kinooperateur darf in Ausübung seines
Berufes vor keinem Hindernis, vor keiner Gefahr zurück-
schrecken, und in der Tat leisten diese Leute in der Über-
windung von Schwierigkeiten, die sich dabei ergeben, oft
geradezu Unglaubliches und beweisen eine Unerschrocken-
heit und kalte Entschlossenheit, wie sie bei einem im
Wüten der Schlacht seine Pflicht erfüllenden Soldaten
nicht größer sein können. Eine tüchtige Portion Wage-
mut und kräftige Nerven verlangt zum Beispiel die kine-
matographische Aufnahme einer Tigerjagd, wie sie unser
interessantes Bild auf Seite 8 veranschaulicht. Bei einer
solchen aufregenden Veranstaltung wird zuerst eine be-
sonders günstig bewachsene Stelle im wilden Dschangel
mit hohen Palisaden umzäunt. Diese sind bei der Auf-
nahme unsichtbar, da sie durch die übermannshohen
Gräser und Sträucher verdeckt werden. In der Mitte
des umfriedigten Raumes befindet sich eine kleine Lich-
tung; hier nehmen die Jäger wie bei einer wirklichen
Treibjagd auf Elefanten Aufstellung, während sich ihnen
gegenüber der Kinooperateur auf einer Leiter oder einem
Baume postiert, da der Rücken eines Elefanten für den
Aufnahmeapparat eine zu wacklige Unterlage abgeben
würde. Nun wird das zu erlegende Tier, ein srischge-
fangener wilder Tiger, aus seinem engen Käfig in den
abgeschlossenen Raum eingelassen und von den uner-
schrockenen indischen Treibern mit langen Spießen und
unter ohrenbetäubendem Lärmen vor die schußbereiten
Büchsen der Jäger getrieben. Natürlich gelingt eine
solche Ausnahme nicht immer, und es müssen oft mehrere
derartige „Triebe" veranstaltet werden, die für die Akteure
der Filmaufnahme mit großer Lebensgefahr verbunden
sind. Erst vor wenigen Monaten ging durch die Tages-
hlätter die Nachricht, daß ein bekannter englischer Kino-
operateur bei einer solchen Aufnahme vom Tiger ange-
fallen und getötet wurde, ehe das Raubtier zur Strecke
gebracht werden konnte.
Lauben-Ll-ntefest.
(Ziehe das Süd auf Zeüe Y.)
er sich mit der Eisenbahn der deutschen Reichshaupt-
stadt nähert, dem fallen als erstes Zeichen, daß er
sich in ihrem Bereiche befindet, die an der Peripherie ge-
legenen zahlreichen kleinen, kolonienweise aneinander-
grenzenden Gärten auf, von denen jeder zum mindesten
eine Laube aufweist. Das sind die vielgenannten Lauben-
kolonien, eine Einrichtung, die in keiner anderen Groß-
stadt so ausgebildet ist wie in Berlin. Und das ist nicht
von ungefähr, denn die Berliner Wohnungsverhältnisse
in den dicht zusammengedrängten, licht- und lustlosen
Mietskasernen ergeben für einen großen Teil der Be-
völkerung das dringende Bedürfnis nach einem unge-
störten Aufenthalt im Freien, besonders aber für das
Heranwachsende Geschlecht. Zur Befriedigung dieses Be-
dürfnisses haben sich nun die Laubenkolonien als äußerst
zweckmäßig erwiesen. Da können sich die Kinder tummeln
nach Herzenslust, die sehr gesunden Gartenarbeiten ver-
richten und Sinn und Verständnis für reinen Naturge-
nuß sich aneignen, und die Erwachsenen haben gesunde
körperliche Beschäftigung, so viel sie wollen, und dabei
Gelegenheit zu gesundheitfördernder Erholung von den
Anstrengungen der Berufsarbeit. Aber auch sonst noch
haben die Laubenkolonien vom sozialen Standpunkt aus
betrachtet ihre großen Vorzüge, unter denen nicht der
geringste der ist, daß sie dazu beitragen, Standes-
unterschiede verschwinden zu lassen und den Gemeinsinn
zu wecken und zu stärken. Da grenzt vielleicht der Garten
eines Arztes oder eines Lehrers an den eines einfachen
Arbeiters, und neben dem eines kleinen Gewerbetreibenden
liegt der eines „besseren" Beamten; aber alle diese ver-
schieden gestellten Inhaber halten, von gemeinsamem
Interesse beseelt, gute Nachbarschaft und helfen einander
bereitwillig aus, wenn es an irgend etwas fehlt. Ja,
es werden sogar gemeinsame Feste veranstaltet, an denen
jeder nach Kräften zur Erhöhung der festlichen Stimmung
beiträgt. Kinderfeste sind besonders beliebt, aber den
Höhepunkt bilden wohl immer die „Erntefeste", wie ein
solches unser lustiges Bild auf Seite 9 treffend charakteri-
siert. Die ganze Kolonie ist dann mit Flaggen und Gir-
landen festlich geschmückt. Die Kinder treiben gemein-
schaftlich odertrüppchenweiseallerhand Spiele, und die Er-
wachsenen schließen sich, scherzhaft kostümiert, zu größeren
Tischgesellschaften zusammen, wo sie sich bei den mehr oder
weniger harmonischen Klängen der meist aus Ziehhar-
monika, Gitarre und Geige bestehenden „Hauskapelle" und
fröhlichen Gesängen in zwanglosester Weise unterhalten.
Auch ein Kartenspielchen kommt hier und da zustande
und des Abends, wenn die Raumverhältnisse es gestatten,
wohl auch ein Tänzchen bei festlicher Illumination.
Vie fliege im vemstein.
Homsn von e. v. vdlei-rfeld-vallestrem.
(Nachdruck verboten.)
uf einer Bank in den öffentlichen Gärten
von Venedig, nahe der Büste des vene-
zianischen Dialektdichters Riccardo Sel-
vatico, saß gegen Abend eines wunderbar
schönen Septembertages eine junge Dame.
Sie hatte sich auf diesem Punkt den gewiß schönsten
Blick auf die herrliche alte Märchenstadt in den
Lagunen auserkoren, den Blick, den der Dichter
auch vor allen geliebt, und darum hat die dankbare
Stadt ihm sein Denkmal an diese Stelle gesetzt mit
dem Zitat aus einem seiner Gedichte: „Nein, es
gibt auf dieser Welt keine schönere Stadt!" — Er
hat recht, denn wie man Venedig von jener Stelle
aus vor sich liegen sieht, muß es, wenn auch vielleicht
nur unbewußt, der größte Reisevandale anerkennen.
Im Westen neigte sich die Sonne schon und ließ
die Umrisse der Stadt mit ihren phantastischen
Türmen und Gebäuden auf einem purpurnen
Hintergründe erscheinen, der nach oben sich in leuch-
tendes Gold abtönte; dieses verlief allmählich in ein
intensives Türkisblau, in dem eine riesige, platin-
artige Mondsichel schwamm. Die junge Dame schien
so versenkt in den wunderbaren Anblick, daß sie
es längst nicht mehr bemerkte, wie die Vorüber-
gehenden sie mit mehr oder minder großem Wohl-
gefallen betrachteten.
Sie war entschieden hübsch genug, um ein mehr
als flüchtiges Interesse zu erregen. Nicht zu groß,
aber tannenschlank und in vollkommenem Ebenmaß
gewachsen, kam ihre zierliche Gestalt im einfachen,
aber gut gearbeiteten Schneiderkleide von weißem
Leinen zur besten Geltung, und ihr reizender Kopf
mit einer Fülle natürlich feingerippten, aschblon-
den Haares unter dem breiten, schwarzen Stroh-
hut, konnte keinen besseren Hintergrund finden. Das
Gesicht Ivar kein vollkommen schönes — wenig-
stens nicht nach den Begriffen von Schönheit, die
noch maßgebend waren, ehe die „neue Kunst" hohe
Backenknochen, einen lüsternen Mund, eine dicke
Nase und striemige, über die Ohren gekämmte
Haare für das allein gültige Ideal erklärte; freilich
hat wohl auch die ideale Schönheit der „überwunde-
nen" Kunst — in die Wirklichkeit übertragen —
oft den Nachteil des Leblosen, was man aber der
jungen Dame auf der Bank nicht zum Vorwurf
machen konnte. Ihre feingebogene Nase war zu
kurz abgebrochen, um mustergültig zu sein, ihr
Kinn zu energisch, von wunderbarer Lieblichkeit aber
war der blaßrote Mund, wundervoll der pfirsich-
blütenartige Teint, von der größten Anziehungskraft
die schönen, großen, grauen Augen mit ihren tief-
dunklen Wimpern und Brauen — alles in allem:
ein Rassekopf und im Ausdruck der einer Person
von Bildung und Erziehung, die ihren Stempel dem
geübten Auge so unzweifelhaft erkennbar machen.
Während sie so saß und westwärts in die sin-
kende Sonne schaute, kam eiu älteres Paar den Kai
entlang der Büste Selvaticos entgegen, vermutlich
um sich zur nahen Schiffslände zu begeben. Die
Dame bemerkte das auf der Bank sitzende junge
Mädchen zuerst. Sie blieb stehen und flüsterte dann
dem Herrn etwas zu, worauf dieser den Blick nach
der Bank richtete und sichtlich zurückfuhr. Beide
drehten dann um und gingen langsam den Weg zurück,
deu sic gekommen waren, indem sie rasch und leise
miteinander sprachen. Die Dame schien besonders
eindringlich zu reden, während der Herr wiederholt
den Kopf schüttelte, dann aber achselzuckend seiner
Gefährtin folgte, als diefe fich zurückwandte, auf
die Bank zuschritt und die dort Sitzende in deutscher
Sprache verbindlich fragte, ob der Platz neben ihr
noch frei sei.
Die junge Dame, die die Herankommenden bisher
wederbemerkt noch beachtet hatte, nickte bejahend und
rückte nach dem Rande zu, worauf das Paar neben ihr
Platz nahm und einige Bemerkungen über die „un-
vergleichliche Szenerie" wechselte. Sie waren, wie
schon gesagt, ältere Leute und sahen vornehm aus.
Beide waren groß gewachsen, er schlank und mager,
sie von achtbarer Leibesfülle. Ihr rundes, großes
Gesicht mit der merkwürdig kurzen, spitzen Nase,
die ganz babyhaft darin aussah, dem etwas zu vollen,
aber festgeschlossenen Munde, den großen, dunklen,
von schweren, graden, schwarzen Brauen überragten
Augen, die durch sie etwas Finsteres bekamen, ließ
darauf schließen, daß die Frau in ihrer Jugend
gewiß eine pikante Schönheit besessen haben mußte
im Verein mit ihrem klaren, farblosen Teint, der jetzt
aber etwas Totes hatte, weil sie eine Perücke von
rötlichem Kastanienbraun trug. Sie war im übrigen
ruhig und passend in dunkle, gutverarbeitetcStoffe ge-
kleidet und machte einen recht stattlichen Eindruck.
V35 Luch füi- MIe
Heft 1
Heide brennt! Im nächsten Augenblick sind schon sämt-
liche arbeitsfähigen Männer alarmiert, und sofort wird
auch die nahe Garnison telephonisch um ein Hilfskom-
mando gebeten. Nach dessen Eintreffen greifen die Mann-
schaften unter der Leitung ihres Hauptmanns mit Spitz-
hacken und Spaten zur Unterstützung der bedrohten Heide-
bauern, wie es unser fesselndes Bild auf Seite 1 zeigt,
ein, um das Dorf mit einem Schutzgraben zu umziehen,
der das Eindringen des Lauffeuers verhindert. Geschieht
das Anlegen eines Schutzgrabens in so umsichtiger Weise
wie hier, so erfüllt er fast immer seinen Zweck.
Lin fünfuhrtee auf der Kleinen Scheidegg.
(Ziehe das Süd aus 8eite 4 und S.)
/^ine der schönsten und lohnendsten Touren im Berner
Oberland, dabei ohne jede Schwierigkeit auszuführen,
ganz abgesehen davon, daß man sie auch von Anfang bis
zu Ende mit der Zahnradbahn machen kann, ist die, die
von Grindelwald aus dem Tale der Schwarzen Lütschine
über den bis zu 2066 Meter sich emporschwingenden Paß
der Kleinen Scheidegg und die vielgepriesene Wengernalp
(1877 Meter) nach Lauterbrunnen ins Tal der Weißen
Lütschine hinübersührt. In 6V- Marschstunden legt der
rüstige Fußgänger den ganzen Weg, zu dem er "keines
Führers benötigt, zurück; freilich wird er viel längere Zeit
unterwegs sein, denn er wird des öfteren an besonders
bevorzugten Punkten rasten, um sich auszuruhen und die
herrlichen, abwechslungsreichen Naturschönheiten in aller
Muße zu genießen, in erster Linie auf der wundervollen
Wengernalp und der Kleinen Scheidegg. Die erstere ist
der großartigste aller Plätze des Berner Oberlandes, die
keine Rundschau, sondern bloß Aussichten bietet, denn
ihr unmittelbar gegenüber ragt über 4000 Meter hoch
gen Himmel der stolzeste unter den Berner Schneeriesen,
die Jungfrau. Von der Kleinen Scheidegg aber hat man
ein Hochgebirgspanorama von majestätischer Schönheit,
das die ganze herrliche Gletscher- und Firnwelt der
Jungfrau, des Silberhorns, des Mönchs und Eigers um-
faßt. Ein erstklassiges, großes, mit höchstem Komfort
ausgestattetes Hotel mit geräumiger Aussichtsterrasse
bietet hier auch dem verwöhntesten Reisenden ange-
nehmen Aufenthalt, und so wimmelt es denn hier, vor-
nehmlich in der Hochsaison, geradezu von Fremden, zumal
seit Eröffnung der Jungfraubahn, die aus der Station
Scheidegg von der Wengernalpbahn abzweigt. Viel
Anklang haben bei den sashionablen Besuchern des Hotels
die seit kurzem eingeführten Fünsuhrtees gefunden. Welch
reges internationales Leben dabei zu herrschen pflegt,
welch großstädtische Eleganz da anzutreffen ist, hat der
Schöpfer unseres hübschen Bildes auf Seite 4 und 5 sehr
anschaulich zum Ausdruck gebracht. Der wahre Naturfreund
freilich verzichtet gern aus solch künstliche Verpflanzung
moderner Großstadtkultur in die erhabene Welt des Hoch-
gebirges; er lagert sich lieber abseits auf blumiger Matte
und begnügt sich mit dem, was ihm sein Rucksack an Speise
und Trank spendet, glücklich darüber, daß er einmal aller
städtischen und gesellschaftlichen Überkultur entronnen ist.
Lmml) Koeppel.
(Ziehe das pottrLt auf Zeile ü.)
bine unseren Lesern seit vielen Jahren wohlbekannte
und von ihnen besonders hochgeschätzte Mitarbeiterin
unserer Zeitschrift auf dem Gebiete des Romans ist
Emmy Koeppel, die unter dem Pseudonym Georg Hartwig
zu schreiben gewohnt ist. Emmy Koeppel wurde zu Ahlen
in Westfalen geboren und verlebte ihre erste Jugendzeit in
einer größeren Stadt Pommerns. Musikalisch beanlagt,
besuchte sie mehrere Jahre das Sternsche Konservatorium
in Berlin, wo sie im Gesang von Jenny Meyer, im
Klavierspiel von Hans v. Bülow unterrichtet wurde. Nach
ihrer Verheiratung lernte sie gelegentlich den bekannten
Rezitator Emil Palleske kennen, von dem sie die An-
regung zu schriftstellerischer Betätigung empfing. Wie
richtig Palleske Emmy Koeppels Befähigung beurteilt
hatte, zeigt die lange Reihe ihrer Romane. Wir erinnern
an „Die goldene Gans", „Die Sage von Imhoff", „Die
Generalstochter", „Alpenrose", „Wenn du mich liebst",
„Wär' ich geblieben doch", „Das Rätsel von Kronfeld",
„Haus Bickenbach" und „Bleib dir treu!" — die sämtlich
in unserer Zeitschrift erschienen sind. Ihr neuer, die
Herzen unserer Leser sicherlich gewinnender Roman „Das
grüne Haus" eröffnet den laufenden Jahrgang. In allen
diesen Werken strömt warmes Herzblut, prägt sich eine
menschlich echte Charakterisierungskunst aus, offenbart
sich eine feine Naturempfindung und verknüpft sich mit
einem anheimelnden Erzählerton eine reichgegliederte,
fortreißende Handlung.
kufemia o. ffdlei'5feid--8aUestl'em.
(Ziehe das Porträt aus Zeüe 7.)
Eufemia v. Adlersfeld-Ballestrem besitzt seit langem
einen geachteten literarischen Ruf und erfreut sich
einer ihr treu anhängenden, großen Lesergemeinde in
allen Kreisen der Gesellschaft. Ihr Lebenslauf bewegte
sich auf ruhigen Geleisen. Sie wurde am 18. August 1854
in Natibor in Oberschlesien geboren, verheiratete sich im
Jahre 1884 und würbe im Jahre 1907 Witwe. Im Jahre
1876 trat sie mit ihrem Novellenwerk „Blätter im Winde"
vor die Öffentlichkeit. Nach anfänglichem Tasten schuf
sie sich eine Erzählungsform von persönlicher Note, die
sie mit sicherer Meisterschaft beherrscht. Wir haben von
ihr in dieser Zeitschrift die Romane „Der Jungfern-
turm", „Der grüne Pompadour" und „Das wogende
Licht" veröffentlicht und beginnen in der vorliegenden
Nummer ihre neueste Arbeit „Die Fliege im Bernstein".
E. v. Adlersfeld-Ballestrem liebt es, ihrem häufigen
Aufenthalt in Venedig und Rom entsprechend, den
Schauplatz ihrer Romankompositionen nach Italien zu
verlegen, auf diesem an historischen Geschlechtern und
erinnerungsvollen Palästen überreichen Boden geheimnis-
bergende Begebnisse der Vergangenheit mit der Gegen-
wart zu verbinden, mystischen Seelenregungen und
übersinnlichen Vorkommnissen nachzuspüren, aber sie
versteht es auch, diesen dunkeln Untergrund mit einem
frischen Humor wohlig zu durchsonnen. Gräfin Adlers-
seld-Ballestrem ist Inhaberin der Königlich Württembergi-
schen Goldenen Medaille für Kunst und Wissenschaft am
Bande des Friedrichsordens, Mitglied der Akademie
Arkadia in Rom und korrespondierendes Mitglied der
Societe Archeologique de France in Paris.
Kinematogl'aphische Ausnahme einer-
ligel-jagd in Indien.
(Ziehe das Süd aus Zeüe 8.)
^in heißer Konkurrenzkampf, der an die dabei Beteilig-
ten die allergrößten Anforderungen stellt, tobt heute
im kinematographischen Gewerbe und zwingt die Film-
fabrikanten zu immer neuen, immer größeren Sensationen.
Der tüchtige Kinooperateur darf in Ausübung seines
Berufes vor keinem Hindernis, vor keiner Gefahr zurück-
schrecken, und in der Tat leisten diese Leute in der Über-
windung von Schwierigkeiten, die sich dabei ergeben, oft
geradezu Unglaubliches und beweisen eine Unerschrocken-
heit und kalte Entschlossenheit, wie sie bei einem im
Wüten der Schlacht seine Pflicht erfüllenden Soldaten
nicht größer sein können. Eine tüchtige Portion Wage-
mut und kräftige Nerven verlangt zum Beispiel die kine-
matographische Aufnahme einer Tigerjagd, wie sie unser
interessantes Bild auf Seite 8 veranschaulicht. Bei einer
solchen aufregenden Veranstaltung wird zuerst eine be-
sonders günstig bewachsene Stelle im wilden Dschangel
mit hohen Palisaden umzäunt. Diese sind bei der Auf-
nahme unsichtbar, da sie durch die übermannshohen
Gräser und Sträucher verdeckt werden. In der Mitte
des umfriedigten Raumes befindet sich eine kleine Lich-
tung; hier nehmen die Jäger wie bei einer wirklichen
Treibjagd auf Elefanten Aufstellung, während sich ihnen
gegenüber der Kinooperateur auf einer Leiter oder einem
Baume postiert, da der Rücken eines Elefanten für den
Aufnahmeapparat eine zu wacklige Unterlage abgeben
würde. Nun wird das zu erlegende Tier, ein srischge-
fangener wilder Tiger, aus seinem engen Käfig in den
abgeschlossenen Raum eingelassen und von den uner-
schrockenen indischen Treibern mit langen Spießen und
unter ohrenbetäubendem Lärmen vor die schußbereiten
Büchsen der Jäger getrieben. Natürlich gelingt eine
solche Ausnahme nicht immer, und es müssen oft mehrere
derartige „Triebe" veranstaltet werden, die für die Akteure
der Filmaufnahme mit großer Lebensgefahr verbunden
sind. Erst vor wenigen Monaten ging durch die Tages-
hlätter die Nachricht, daß ein bekannter englischer Kino-
operateur bei einer solchen Aufnahme vom Tiger ange-
fallen und getötet wurde, ehe das Raubtier zur Strecke
gebracht werden konnte.
Lauben-Ll-ntefest.
(Ziehe das Süd auf Zeüe Y.)
er sich mit der Eisenbahn der deutschen Reichshaupt-
stadt nähert, dem fallen als erstes Zeichen, daß er
sich in ihrem Bereiche befindet, die an der Peripherie ge-
legenen zahlreichen kleinen, kolonienweise aneinander-
grenzenden Gärten auf, von denen jeder zum mindesten
eine Laube aufweist. Das sind die vielgenannten Lauben-
kolonien, eine Einrichtung, die in keiner anderen Groß-
stadt so ausgebildet ist wie in Berlin. Und das ist nicht
von ungefähr, denn die Berliner Wohnungsverhältnisse
in den dicht zusammengedrängten, licht- und lustlosen
Mietskasernen ergeben für einen großen Teil der Be-
völkerung das dringende Bedürfnis nach einem unge-
störten Aufenthalt im Freien, besonders aber für das
Heranwachsende Geschlecht. Zur Befriedigung dieses Be-
dürfnisses haben sich nun die Laubenkolonien als äußerst
zweckmäßig erwiesen. Da können sich die Kinder tummeln
nach Herzenslust, die sehr gesunden Gartenarbeiten ver-
richten und Sinn und Verständnis für reinen Naturge-
nuß sich aneignen, und die Erwachsenen haben gesunde
körperliche Beschäftigung, so viel sie wollen, und dabei
Gelegenheit zu gesundheitfördernder Erholung von den
Anstrengungen der Berufsarbeit. Aber auch sonst noch
haben die Laubenkolonien vom sozialen Standpunkt aus
betrachtet ihre großen Vorzüge, unter denen nicht der
geringste der ist, daß sie dazu beitragen, Standes-
unterschiede verschwinden zu lassen und den Gemeinsinn
zu wecken und zu stärken. Da grenzt vielleicht der Garten
eines Arztes oder eines Lehrers an den eines einfachen
Arbeiters, und neben dem eines kleinen Gewerbetreibenden
liegt der eines „besseren" Beamten; aber alle diese ver-
schieden gestellten Inhaber halten, von gemeinsamem
Interesse beseelt, gute Nachbarschaft und helfen einander
bereitwillig aus, wenn es an irgend etwas fehlt. Ja,
es werden sogar gemeinsame Feste veranstaltet, an denen
jeder nach Kräften zur Erhöhung der festlichen Stimmung
beiträgt. Kinderfeste sind besonders beliebt, aber den
Höhepunkt bilden wohl immer die „Erntefeste", wie ein
solches unser lustiges Bild auf Seite 9 treffend charakteri-
siert. Die ganze Kolonie ist dann mit Flaggen und Gir-
landen festlich geschmückt. Die Kinder treiben gemein-
schaftlich odertrüppchenweiseallerhand Spiele, und die Er-
wachsenen schließen sich, scherzhaft kostümiert, zu größeren
Tischgesellschaften zusammen, wo sie sich bei den mehr oder
weniger harmonischen Klängen der meist aus Ziehhar-
monika, Gitarre und Geige bestehenden „Hauskapelle" und
fröhlichen Gesängen in zwanglosester Weise unterhalten.
Auch ein Kartenspielchen kommt hier und da zustande
und des Abends, wenn die Raumverhältnisse es gestatten,
wohl auch ein Tänzchen bei festlicher Illumination.
Vie fliege im vemstein.
Homsn von e. v. vdlei-rfeld-vallestrem.
(Nachdruck verboten.)
uf einer Bank in den öffentlichen Gärten
von Venedig, nahe der Büste des vene-
zianischen Dialektdichters Riccardo Sel-
vatico, saß gegen Abend eines wunderbar
schönen Septembertages eine junge Dame.
Sie hatte sich auf diesem Punkt den gewiß schönsten
Blick auf die herrliche alte Märchenstadt in den
Lagunen auserkoren, den Blick, den der Dichter
auch vor allen geliebt, und darum hat die dankbare
Stadt ihm sein Denkmal an diese Stelle gesetzt mit
dem Zitat aus einem seiner Gedichte: „Nein, es
gibt auf dieser Welt keine schönere Stadt!" — Er
hat recht, denn wie man Venedig von jener Stelle
aus vor sich liegen sieht, muß es, wenn auch vielleicht
nur unbewußt, der größte Reisevandale anerkennen.
Im Westen neigte sich die Sonne schon und ließ
die Umrisse der Stadt mit ihren phantastischen
Türmen und Gebäuden auf einem purpurnen
Hintergründe erscheinen, der nach oben sich in leuch-
tendes Gold abtönte; dieses verlief allmählich in ein
intensives Türkisblau, in dem eine riesige, platin-
artige Mondsichel schwamm. Die junge Dame schien
so versenkt in den wunderbaren Anblick, daß sie
es längst nicht mehr bemerkte, wie die Vorüber-
gehenden sie mit mehr oder minder großem Wohl-
gefallen betrachteten.
Sie war entschieden hübsch genug, um ein mehr
als flüchtiges Interesse zu erregen. Nicht zu groß,
aber tannenschlank und in vollkommenem Ebenmaß
gewachsen, kam ihre zierliche Gestalt im einfachen,
aber gut gearbeiteten Schneiderkleide von weißem
Leinen zur besten Geltung, und ihr reizender Kopf
mit einer Fülle natürlich feingerippten, aschblon-
den Haares unter dem breiten, schwarzen Stroh-
hut, konnte keinen besseren Hintergrund finden. Das
Gesicht Ivar kein vollkommen schönes — wenig-
stens nicht nach den Begriffen von Schönheit, die
noch maßgebend waren, ehe die „neue Kunst" hohe
Backenknochen, einen lüsternen Mund, eine dicke
Nase und striemige, über die Ohren gekämmte
Haare für das allein gültige Ideal erklärte; freilich
hat wohl auch die ideale Schönheit der „überwunde-
nen" Kunst — in die Wirklichkeit übertragen —
oft den Nachteil des Leblosen, was man aber der
jungen Dame auf der Bank nicht zum Vorwurf
machen konnte. Ihre feingebogene Nase war zu
kurz abgebrochen, um mustergültig zu sein, ihr
Kinn zu energisch, von wunderbarer Lieblichkeit aber
war der blaßrote Mund, wundervoll der pfirsich-
blütenartige Teint, von der größten Anziehungskraft
die schönen, großen, grauen Augen mit ihren tief-
dunklen Wimpern und Brauen — alles in allem:
ein Rassekopf und im Ausdruck der einer Person
von Bildung und Erziehung, die ihren Stempel dem
geübten Auge so unzweifelhaft erkennbar machen.
Während sie so saß und westwärts in die sin-
kende Sonne schaute, kam eiu älteres Paar den Kai
entlang der Büste Selvaticos entgegen, vermutlich
um sich zur nahen Schiffslände zu begeben. Die
Dame bemerkte das auf der Bank sitzende junge
Mädchen zuerst. Sie blieb stehen und flüsterte dann
dem Herrn etwas zu, worauf dieser den Blick nach
der Bank richtete und sichtlich zurückfuhr. Beide
drehten dann um und gingen langsam den Weg zurück,
deu sic gekommen waren, indem sie rasch und leise
miteinander sprachen. Die Dame schien besonders
eindringlich zu reden, während der Herr wiederholt
den Kopf schüttelte, dann aber achselzuckend seiner
Gefährtin folgte, als diefe fich zurückwandte, auf
die Bank zuschritt und die dort Sitzende in deutscher
Sprache verbindlich fragte, ob der Platz neben ihr
noch frei sei.
Die junge Dame, die die Herankommenden bisher
wederbemerkt noch beachtet hatte, nickte bejahend und
rückte nach dem Rande zu, worauf das Paar neben ihr
Platz nahm und einige Bemerkungen über die „un-
vergleichliche Szenerie" wechselte. Sie waren, wie
schon gesagt, ältere Leute und sahen vornehm aus.
Beide waren groß gewachsen, er schlank und mager,
sie von achtbarer Leibesfülle. Ihr rundes, großes
Gesicht mit der merkwürdig kurzen, spitzen Nase,
die ganz babyhaft darin aussah, dem etwas zu vollen,
aber festgeschlossenen Munde, den großen, dunklen,
von schweren, graden, schwarzen Brauen überragten
Augen, die durch sie etwas Finsteres bekamen, ließ
darauf schließen, daß die Frau in ihrer Jugend
gewiß eine pikante Schönheit besessen haben mußte
im Verein mit ihrem klaren, farblosen Teint, der jetzt
aber etwas Totes hatte, weil sie eine Perücke von
rötlichem Kastanienbraun trug. Sie war im übrigen
ruhig und passend in dunkle, gutverarbeitetcStoffe ge-
kleidet und machte einen recht stattlichen Eindruck.