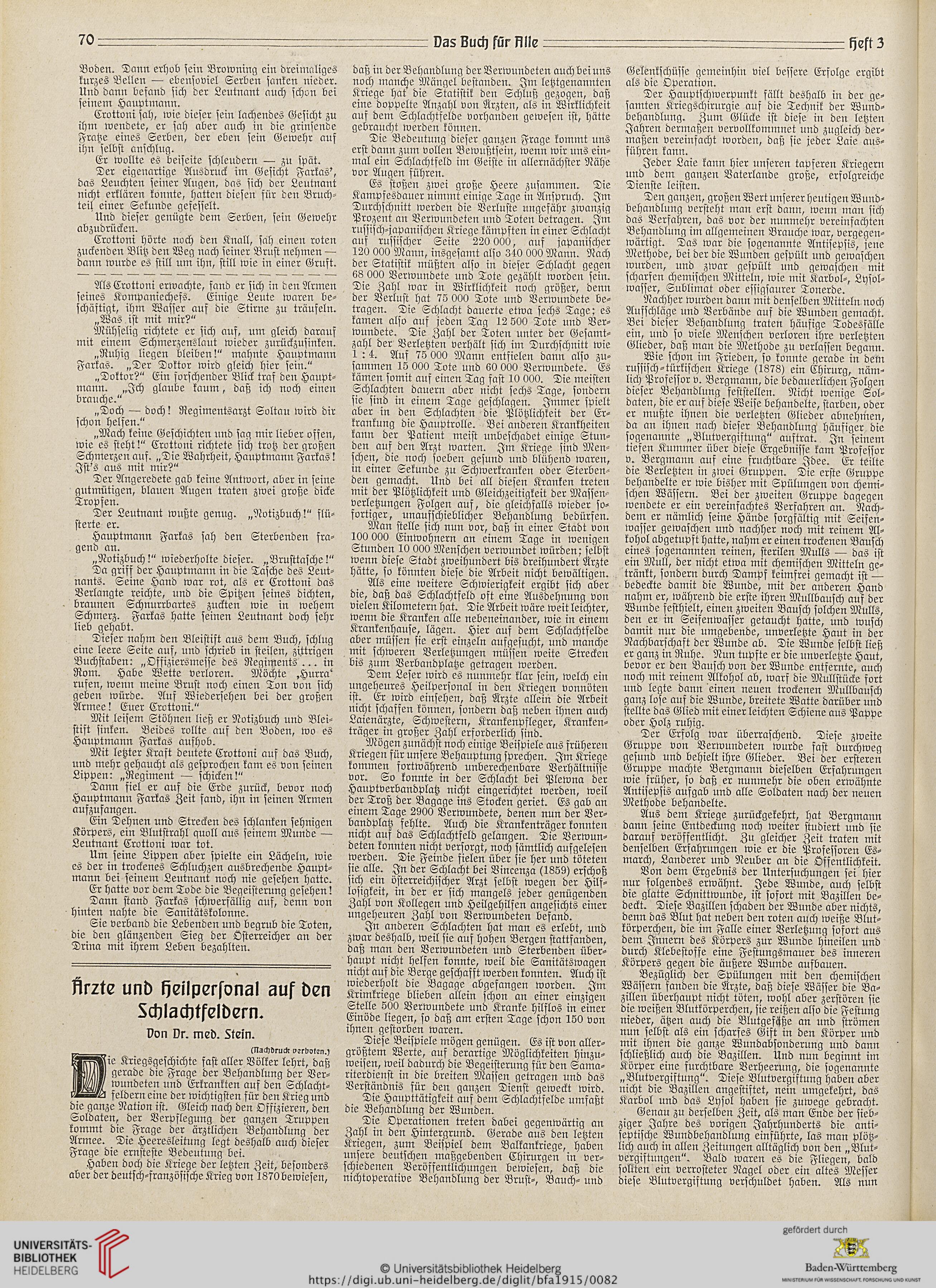70 .. .-
Boden. Dann erhob sein Browning ein dreimaliges
kurzes Bellen — ebensoviel Serben sanken nieder.
Und dann befand sich der Leutnant auch schon bei
seinem Hauptmann.
Crottoni sah, wie dieser sein lachendes Gesicht zu
ihm wendete, er sah aber auch in die grinsende
Fratze eines Serben, der eben sein Gewehr auf
ihn selbst anschlug.
Er wollte es beiseite schleudern — zu spät.
Der eigenartige Ausdruck im Gesicht Farkas',
das Leuchten seiner Augen, das sich der Leutnant
nicht erklären konnte, hatten diesen für den Bruch-
teil einer Sekunde gefesselt.
Und dieser genügte dem Serben, sein Gewehr
abzudrücken.
Crottoni hörte noch den Knall, sah einen roten
zuckenden Blitz den Weg nach seiner Brust nehmen —
dann wurde es still uni ihn, still wie in einer Gruft.
Als Crottoni erwachte, fand er sich in den Armen
seines Kompaniechefs. Einige Leute waren be-
schäftigt, ihm Wasser auf die Stirne zu träufeln.
„Was ist mit mir?"
Mühselig richtete er sich aus, um gleich darauf
mit einem Schmerzenslaut wieder zurückzusinken.
„Ruhig liegen bleiben!" mahnte Hauptmann
Farkas. „Der Doktor wird gleich hier sein."
„Doktor?" Ein forschender Blick traf den Haupt-
mann. „Ich glaube kaum, daß ich noch einen
brauche."
„Doch — doch! Regimentsarzt Soltau wird dir
schon helfen."
„Mach keine Geschichten und sag mir lieber offen,
wie es steht!" Crottoni richtete sich trotz der großen
Schmerzen auf. „Die Wahrheit, Hauptmann Farkas!
Jst's aus mit mir?"
Der Angeredete gab keine Antwort, aber in seine
gutmütigen, blauen Augen traten zwei große dicke
Tropfen.
Der Leutnant wußte genug. „Notizbuch!" flü-
sterte er.
Hauptmann Farkas sah den Sterbenden fra-
gend an.
„Notizbuch!" wiederholte dieser. „Brusttasche!"
Da griff der Hauptmann in die Tasche des Leut-
nants. Seine Hand war rot, als er Crottoni das
Verlangte reichte, und die Spitzen seines dichten,
braunen Schnurrbartes zuckten wie in wehem
Schmerz. Farkas hatte seinen Leutnant doch sehr
lieb gehabt.
Dieser nahm den Bleistift aus dem Buch, schlug
eine leere Seite auf, und schrieb in steilen, zittrigen
Buchstaben: „Offiziersmesse des Regiments... in
Rom. Habe Wette verloren. Möchte ,Hurra'
rufen, wenn meine Brust noch einen Ton von sich
geben würde. Auf Wiedersehen bei der großen
Armee! Euer Crottoni."
Mit leisem Stöhnen ließ er Notizbuch und Blei-
stift sinken. Beides rollte auf den Boden, wo es
Hauptmann Farkas aufhob.
Mit letzter Kraft deutete Crottoni auf das Buch,
und mehr gehaucht als gesprochen kam es von seinen
Lippen: „Regiment — schicken!"
Dann fiel er auf die Erde zurück, bevor noch
Hauptmann Farkas Zeit fand, ihn in seinen Armen
aufzufangen.
Ein Dehnen und Strecken des schlanken sehnigen
Körpers, ein Blutstrahl quoll aus seinem Munde —
Leutnant Crottoni war tot.
Um seine Lippen aber spielte ein Lächeln, wie
es der in trockenes Schluchzen ausbrechende Haupt-
mann bei seinem Leutnant noch nie gesehen hatte.
Er hatte vor dem Tode die Begeisterung gesehen!
Dann stand Farkas schwerfällig auf, denn von
hinten nahte die Sanitätskolonne.
Sie verband die Lebenden und begrub die Toten,
die den glänzenden Sieg der Österreicher an der
Drina mit ihrem Leben bezahlten.
ftsrte und ffeilpessonal auf den
Tchlachtfeldem.
von vr. med. 5tein.
lNachd^uck ori-boten.)
K^Lie Kriegsgeschichte fast aller Völker lehrt, daß
M u II gerade die Frage der Behandlung der Ver-
iM/jV wundsten und Erkrankten auf den Schlacht-
feldern eine der wichtigsten für den Krieg und
die ganze Nation ist. Gleich nach den Offizieren, den
Soldaten, der Verpflegung der ganzen Truppen
kommt die Frage der ärztlichen Behandlung der
Armee. Die Heeresleitung legt deshalb auch dieser
Frage die ernsteste Bedeutung bei.
Haben doch die Kriege der letzten Zeit, besonders
aber der deutsch-französische Krieg von 1870 bewiesen,
— Vas Ruch für M!e -1
daß in der Behandlung der Verwundeten auch beinns
noch manche Mängel bestanden. In: letztgenannten
Kriege hat die Statistik den Schluß gezogen, daß
eine doppelte Anzahl von Ärzten, als in Wirklichkeit
auf dem Schlachtfelde vorhanden gewesen ist, hätte
gebraucht werden können.
Die Bedeutung dieser ganzen Frage kommt uns
erst dann zum vollen Bewußtsein, wenn wir uns ein-
mal ein Schlachtfeld im Geiste in allernächster Nähe
vor Augen führen.
Es stoßen zwei große Heere zusammen. Die
Kampfesdauer nimmt einige Tage in Anspruch. Im
Durchschnitt werden die Verluste ungefähr zwanzig
Prozent an Verwundeten und Toten betragen. Im
russisch-japanischen Kriege kämpften in einer Schlacht
auf russischer Seite 220 000, auf japanischer
120 000 Mann, insgesamt also 340 000 Mann. Nach
der Statistik müßten also in dieser Schlacht gegen
68 000 Verwundete und Tote gezählt worden sein.
Die Zahl war in Wirklichkeit noch größer, denn
der Verlust hat 75 000 Tote und Verwundete be-
tragen. Die Schlacht dauerte etwa sechs Tage; es
kamen also auf jeden Tag 12 500 Tote und Ver-
wundete. Die Zahl der Toten unter der Gesamt-
zahl der Verletzten verhält sich im Durchschnitt wie
1 : 4. Auf 75 000 Mann entfielen dann also zu-
sammen 15 000 Tote und 60 000 Verwundete. Es
kämen somit auf einen Tag fast 10 000. Die meisten
Schlachten dauern aber nicht sechs Tage, sondern
sie sind in einem Tage geschlagen. Immer spielt
aber in den Schlachten die Plötzlichkeit der Er-
krankung die Hauptrolle. Bei anderen Krankheiten
kann der Patient meist unbeschadet einige Stun-
den auf den Arzt warten. Im Kriege sind Men-
schen, die noch soeben gesund und blühend waren,
in einer Sekunde zu Schwerkranken oder Sterben-
den gemacht. Und bei all diesen Kranken treten
mit der Plötzlichkeit und Gleichzeitigkeit der Massen-
verletzungen Folgen auf, die gleichfalls wieder so-
fortiger, uuauffchieblicher Behandlung bedürfen.
Man stelle sich nun vor, daß in einer Stadt von
100 000 Einwohnern an einem Tage in wenigen
Stunden 10 000 Menschen verwundet würden; selbst
wenn diese Stadt zweihundert bis dreihundert Ärzte
hätte, so könnten diese die Arbeit nicht bewältigen.
Als eine weitere Schwierigkeit ergibt sich aber
die, daß das Schlachtfeld oft eine Ausdehnung von
vielen Kilometern hat. Die Arbeit wäre weit leichter,
wenn die Kranken alle nebeneinander, wie in einem
Krankenhause, lägen. Hier auf dem Schlachtfelde
aber müssen sie erst einzeln aufgesucht, und manche
mit schweren Verletzungen müssen weite Strecken
bis zum Verbandplätze getragen werden.
Dem Leser wird es nunmehr klar sein, welch ein
ungeheures Heilpersonal in den Kriegen vonnöten
ist. Er wird einsehen, daß Arzte allein die Arbeit
nicht schaffen können, sondern daß neben ihnen auch
Laienärzte, Schwestern, Krankenpfleger, Kranken-
träger in großer Zahl erforderlich sind.
Mögen zunächst noch einige Beispiele aus früheren
Kriegen für unsere Behauptung sprechen. Im Kriege
kommen fortwährend unberechenbare Verhältnisse
vor. So konnte in der Schlacht bei Plewna der
Hauptverbandplatz nicht eingerichtet werden, weil
der Troß der Bagage ins Stocken geriet. Es gab an
einem Tage 2900 Verwundete, denen nun der Ver-
bandplatz fehlte. Auch die Krankenträger konnten
nicht auf das Schlachtfeld gelangen. Die Verwun-
deten konnten nicht versorgt, noch sämtlich aufgelesen
werden. Die Feinde fielen über sie her und töteten
sie alle. In der Schlacht bei Vincenza (1859) erschoß
sich ein österreichischer Arzt selbst wegen der Hilf-
losigkeit, in der er sich mangels jeder genügenden
Zahl von Kollegen und Heilgehilfen angesichts einer
ungeheuren Zahl von Verwundeten befand.
In anderen Schlachten hat man es erlebt, und
zwar deshalb, weil sie auf hohen Bergen stattfanden,
daß man den Verwundeten und Sterbenden über-
haupt nicht helfen konnte, weil die Sanitätswagen
nicht auf die Berge geschafft werden konnten. Auch ist
wiederholt die Bagage abgefangen worden. Im
Krimkriege blieben allein schon an einer einzigen
Stelle 500 Verwundete und Kranke hilflos in einer
Einöde liegen, so daß am ersten Tage schon 150 von
ihnen gestorben waren.
Diese Beispiele mögen genügen. Es ist von aller-
größtem Werte, auf derartige Möglichkeiten hinzu-
weisen, weil dadurch die Begeisterung für den Sama-
riterdienst in die breiten Massen getragen und das
Verständnis für den ganzen Dienst geweckt wird.
Die Haupttätigkeit auf dem Schlachtfelde umfaßt
die Behandlung der Wunden.
Die Operationen treten dabei gegenwärtig an
Zahl in den Hintergrund. Gerade aus den letzten
Kriegen, zum Beispiel dem Balkankriege, haben
unsere deutschen maßgebenden Chirurgen in ver-
schiedenen Veröffentlichungen bewiesen, daß die
nichtoperative Behandlung der Brust-, Bauch- und
-___2
Gelenkschüsse gemeinhin viel bessere Erfolge ergibt
als die Operation.
Der Hauptschwerpunkt fällt deshalb in der ge-
samten Kriegschirurgie aus die Technik der Wund-
behandlung. Zum Glücke ist diese in den letzten
Jahren dermaßen vervollkommnet und zugleich der-
maßen vereinfacht worden, daß sie jeder Laie aus-
führen kann.
Jeder Laie kann hier unseren tapferen Kriegern
und dem ganzen Vaterlande große, erfolgreiche
Dienste leisten.
Den ganzen, großen Wert unserer heutigen Wund-
behandlung versteht man erst dann, wenn man sich
das Verfahren, das vor der nunmehr vereinfachten
Behandlung im allgemeinen Brauche war, vergegen-
wärtigt. Das war die sogenannte Antisepsis, jene
Methode, bei der die Wunden gespült und gewaschen
wurden, und zwar gespült und gewaschen mit
scharfen chemischen Mitteln, wie mit Karbol-, Lysol-
wasser, Sublimat oder essigsaurer Tonerde.
Nachher wurden dann mit denselben Mittelnmoch
Aufschläge und Verbände auf die Wunden gemacht.
Bei dieser Behandlung traten häufige Todesfälle
ein, und so viele Menschen verloren ihre verletzten
Glieder, daß man die Methode zu verlassen begann.
Wie schon im Frieden, so konnte gerade in dem
russisch-türkischen Kriege (1878) ein Chirurg, näm-
lich Professor v. Bergmann, die bedauerlichen Folgen
dieser Behandlung feststellen. Nicht wenige Sol-
daten, die er auf diese Weise behandelte, starben, oder
er mußte ihnen die verletzten Glieder abnehmen,
da an ihnen nach dieser Behandlung häufiger die
fogeuannte „Blutvergiftung" auftrat. In seinem
tiefen Kummer über diese Ergebnisse kam Professor
v. Bergmann auf eine fruchtbare Idee. Er teilte
die Verletzten in zwei Gruppen. Die erste Gruppe
behandelte er wie bisher mit Spülungen von chemi-
schen Wässern. Bei der zweiten Gruppe dagegen
wendete er ein vereinfachtes Verfahren an. Nach-
dem er nämlich seine Hände sorgfältig mit Seifen-
wasser gewaschen und nachher noch mit reinem Al-
kohol abgetupft hatte, nahm er einen trockenen Bausch
eines sogenannten reinen, sterilen Mulls — das ist
ein Mull, der nicht etwa mit chemischen Mitteln ge-
tränkt, sondern durch Dampf keimfrei gemacht ist —
bedeckte damit die Wunde, mit der anderen Hand
nahm er, während die erste ihren Mullbausch auf der
Wunde festhielt, einen zweiten Bausch solchen Mulls,
den er in Seifenwasser getaucht hatte, und wusch
damit nur die umgebende, unverletzte Haut in der
Nachbarschaft der Wunde ab. Die Wunde selbst ließ
er ganz in Ruhe. Nun tupfte er die unverletzte Haut,
bevor er den Bausch von der Wunde entfernte, auch
noch mit reinem Alkohol ab, warf die Mullstücke fort
und legte dann einen neuen trockenen Mullbausch
ganz lose auf die Wunde, breitete Watte darüber und
stellte das Glied mit einer leichten Schiene aus Pappe
oder Holz ruhig.
Der Erfolg war überraschend. Diese zweite
Gruppe von Verwundeten wurde fast durchweg
gesund und behielt ihre Glieder. Bei der ersteren
Gruppe machte Bergmann dieselben Erfahrungen
wie früher, so daß er nunmehr die oben erwähnte
Antisepsis aufgab und alle Soldaten nach der neuen
Methode behandelte.
Aus dem Kriege zurückgekehrt, hat Bergmann
dann seine Entdeckung noch weiter studiert und sic
darauf veröffentlicht. Zu gleicher Zeit traten mit
denselben Erfahrungen wie er die Professoren Es-
march, Länderer und Neuber an die Öffentlichkeit.
Von dem Ergebnis der Untersuchungen sei hier
nur folgendes erwähnt. Jede Wunde, auch selbst
die glatte Schnittwunde, ist sofort mit Bazillen be-
deckt. Diese Bazillen schaden der Wunde aber nichts,
denn das Blut hat neben den roten auch weiße Blut-
körperchen, die im Falle einer Verletzung sofort aus
dem Innern des Körpers zur Wunde hineilen und
durch Klebestoffe eine Festungsmauer des inneren
Körpers gegen die äußere Wunde aufbauen.
Bezüglich der Spülungen mit den chemischen
Wässern fanden die Arzte, daß diese Wässer die Ba-
zillen überhaupt nicht töten, wohl aber zerstören sie
die Weißen Blutkörperchen, sie reißen also die Festung
nieder, ätzen auch die Blutgefäße an und strömen
nun selbst als ein scharfes Gift in den Körper und
mit ihnen die ganze Wundabsonderung und dann
schließlich auch die Bazillen. Und nun beginnt im
Körper eine furchtbare Verheerung, die sogenannte
„Blutvergiftung". Diese Blutvergiftung haben aber
nicht die Bazillen angestiftet, nein umgekehrt, das
Karbol und das Lysol haben sie zuwege gebracht.
Genau zu derselben Zeit, als man Ende der sieb-
ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts die anti-
septische Wundbehandlung einführte, las man plötz-
lich auch in allen Zeitungen alltäglich von den „Blut-
vergiftungen". Bald waren es die Fliegen, bald
sollten ein verrosteter Nagel oder ein altes Messer
diese Blutvergiftung verschuldet haben. Als nun
Boden. Dann erhob sein Browning ein dreimaliges
kurzes Bellen — ebensoviel Serben sanken nieder.
Und dann befand sich der Leutnant auch schon bei
seinem Hauptmann.
Crottoni sah, wie dieser sein lachendes Gesicht zu
ihm wendete, er sah aber auch in die grinsende
Fratze eines Serben, der eben sein Gewehr auf
ihn selbst anschlug.
Er wollte es beiseite schleudern — zu spät.
Der eigenartige Ausdruck im Gesicht Farkas',
das Leuchten seiner Augen, das sich der Leutnant
nicht erklären konnte, hatten diesen für den Bruch-
teil einer Sekunde gefesselt.
Und dieser genügte dem Serben, sein Gewehr
abzudrücken.
Crottoni hörte noch den Knall, sah einen roten
zuckenden Blitz den Weg nach seiner Brust nehmen —
dann wurde es still uni ihn, still wie in einer Gruft.
Als Crottoni erwachte, fand er sich in den Armen
seines Kompaniechefs. Einige Leute waren be-
schäftigt, ihm Wasser auf die Stirne zu träufeln.
„Was ist mit mir?"
Mühselig richtete er sich aus, um gleich darauf
mit einem Schmerzenslaut wieder zurückzusinken.
„Ruhig liegen bleiben!" mahnte Hauptmann
Farkas. „Der Doktor wird gleich hier sein."
„Doktor?" Ein forschender Blick traf den Haupt-
mann. „Ich glaube kaum, daß ich noch einen
brauche."
„Doch — doch! Regimentsarzt Soltau wird dir
schon helfen."
„Mach keine Geschichten und sag mir lieber offen,
wie es steht!" Crottoni richtete sich trotz der großen
Schmerzen auf. „Die Wahrheit, Hauptmann Farkas!
Jst's aus mit mir?"
Der Angeredete gab keine Antwort, aber in seine
gutmütigen, blauen Augen traten zwei große dicke
Tropfen.
Der Leutnant wußte genug. „Notizbuch!" flü-
sterte er.
Hauptmann Farkas sah den Sterbenden fra-
gend an.
„Notizbuch!" wiederholte dieser. „Brusttasche!"
Da griff der Hauptmann in die Tasche des Leut-
nants. Seine Hand war rot, als er Crottoni das
Verlangte reichte, und die Spitzen seines dichten,
braunen Schnurrbartes zuckten wie in wehem
Schmerz. Farkas hatte seinen Leutnant doch sehr
lieb gehabt.
Dieser nahm den Bleistift aus dem Buch, schlug
eine leere Seite auf, und schrieb in steilen, zittrigen
Buchstaben: „Offiziersmesse des Regiments... in
Rom. Habe Wette verloren. Möchte ,Hurra'
rufen, wenn meine Brust noch einen Ton von sich
geben würde. Auf Wiedersehen bei der großen
Armee! Euer Crottoni."
Mit leisem Stöhnen ließ er Notizbuch und Blei-
stift sinken. Beides rollte auf den Boden, wo es
Hauptmann Farkas aufhob.
Mit letzter Kraft deutete Crottoni auf das Buch,
und mehr gehaucht als gesprochen kam es von seinen
Lippen: „Regiment — schicken!"
Dann fiel er auf die Erde zurück, bevor noch
Hauptmann Farkas Zeit fand, ihn in seinen Armen
aufzufangen.
Ein Dehnen und Strecken des schlanken sehnigen
Körpers, ein Blutstrahl quoll aus seinem Munde —
Leutnant Crottoni war tot.
Um seine Lippen aber spielte ein Lächeln, wie
es der in trockenes Schluchzen ausbrechende Haupt-
mann bei seinem Leutnant noch nie gesehen hatte.
Er hatte vor dem Tode die Begeisterung gesehen!
Dann stand Farkas schwerfällig auf, denn von
hinten nahte die Sanitätskolonne.
Sie verband die Lebenden und begrub die Toten,
die den glänzenden Sieg der Österreicher an der
Drina mit ihrem Leben bezahlten.
ftsrte und ffeilpessonal auf den
Tchlachtfeldem.
von vr. med. 5tein.
lNachd^uck ori-boten.)
K^Lie Kriegsgeschichte fast aller Völker lehrt, daß
M u II gerade die Frage der Behandlung der Ver-
iM/jV wundsten und Erkrankten auf den Schlacht-
feldern eine der wichtigsten für den Krieg und
die ganze Nation ist. Gleich nach den Offizieren, den
Soldaten, der Verpflegung der ganzen Truppen
kommt die Frage der ärztlichen Behandlung der
Armee. Die Heeresleitung legt deshalb auch dieser
Frage die ernsteste Bedeutung bei.
Haben doch die Kriege der letzten Zeit, besonders
aber der deutsch-französische Krieg von 1870 bewiesen,
— Vas Ruch für M!e -1
daß in der Behandlung der Verwundeten auch beinns
noch manche Mängel bestanden. In: letztgenannten
Kriege hat die Statistik den Schluß gezogen, daß
eine doppelte Anzahl von Ärzten, als in Wirklichkeit
auf dem Schlachtfelde vorhanden gewesen ist, hätte
gebraucht werden können.
Die Bedeutung dieser ganzen Frage kommt uns
erst dann zum vollen Bewußtsein, wenn wir uns ein-
mal ein Schlachtfeld im Geiste in allernächster Nähe
vor Augen führen.
Es stoßen zwei große Heere zusammen. Die
Kampfesdauer nimmt einige Tage in Anspruch. Im
Durchschnitt werden die Verluste ungefähr zwanzig
Prozent an Verwundeten und Toten betragen. Im
russisch-japanischen Kriege kämpften in einer Schlacht
auf russischer Seite 220 000, auf japanischer
120 000 Mann, insgesamt also 340 000 Mann. Nach
der Statistik müßten also in dieser Schlacht gegen
68 000 Verwundete und Tote gezählt worden sein.
Die Zahl war in Wirklichkeit noch größer, denn
der Verlust hat 75 000 Tote und Verwundete be-
tragen. Die Schlacht dauerte etwa sechs Tage; es
kamen also auf jeden Tag 12 500 Tote und Ver-
wundete. Die Zahl der Toten unter der Gesamt-
zahl der Verletzten verhält sich im Durchschnitt wie
1 : 4. Auf 75 000 Mann entfielen dann also zu-
sammen 15 000 Tote und 60 000 Verwundete. Es
kämen somit auf einen Tag fast 10 000. Die meisten
Schlachten dauern aber nicht sechs Tage, sondern
sie sind in einem Tage geschlagen. Immer spielt
aber in den Schlachten die Plötzlichkeit der Er-
krankung die Hauptrolle. Bei anderen Krankheiten
kann der Patient meist unbeschadet einige Stun-
den auf den Arzt warten. Im Kriege sind Men-
schen, die noch soeben gesund und blühend waren,
in einer Sekunde zu Schwerkranken oder Sterben-
den gemacht. Und bei all diesen Kranken treten
mit der Plötzlichkeit und Gleichzeitigkeit der Massen-
verletzungen Folgen auf, die gleichfalls wieder so-
fortiger, uuauffchieblicher Behandlung bedürfen.
Man stelle sich nun vor, daß in einer Stadt von
100 000 Einwohnern an einem Tage in wenigen
Stunden 10 000 Menschen verwundet würden; selbst
wenn diese Stadt zweihundert bis dreihundert Ärzte
hätte, so könnten diese die Arbeit nicht bewältigen.
Als eine weitere Schwierigkeit ergibt sich aber
die, daß das Schlachtfeld oft eine Ausdehnung von
vielen Kilometern hat. Die Arbeit wäre weit leichter,
wenn die Kranken alle nebeneinander, wie in einem
Krankenhause, lägen. Hier auf dem Schlachtfelde
aber müssen sie erst einzeln aufgesucht, und manche
mit schweren Verletzungen müssen weite Strecken
bis zum Verbandplätze getragen werden.
Dem Leser wird es nunmehr klar sein, welch ein
ungeheures Heilpersonal in den Kriegen vonnöten
ist. Er wird einsehen, daß Arzte allein die Arbeit
nicht schaffen können, sondern daß neben ihnen auch
Laienärzte, Schwestern, Krankenpfleger, Kranken-
träger in großer Zahl erforderlich sind.
Mögen zunächst noch einige Beispiele aus früheren
Kriegen für unsere Behauptung sprechen. Im Kriege
kommen fortwährend unberechenbare Verhältnisse
vor. So konnte in der Schlacht bei Plewna der
Hauptverbandplatz nicht eingerichtet werden, weil
der Troß der Bagage ins Stocken geriet. Es gab an
einem Tage 2900 Verwundete, denen nun der Ver-
bandplatz fehlte. Auch die Krankenträger konnten
nicht auf das Schlachtfeld gelangen. Die Verwun-
deten konnten nicht versorgt, noch sämtlich aufgelesen
werden. Die Feinde fielen über sie her und töteten
sie alle. In der Schlacht bei Vincenza (1859) erschoß
sich ein österreichischer Arzt selbst wegen der Hilf-
losigkeit, in der er sich mangels jeder genügenden
Zahl von Kollegen und Heilgehilfen angesichts einer
ungeheuren Zahl von Verwundeten befand.
In anderen Schlachten hat man es erlebt, und
zwar deshalb, weil sie auf hohen Bergen stattfanden,
daß man den Verwundeten und Sterbenden über-
haupt nicht helfen konnte, weil die Sanitätswagen
nicht auf die Berge geschafft werden konnten. Auch ist
wiederholt die Bagage abgefangen worden. Im
Krimkriege blieben allein schon an einer einzigen
Stelle 500 Verwundete und Kranke hilflos in einer
Einöde liegen, so daß am ersten Tage schon 150 von
ihnen gestorben waren.
Diese Beispiele mögen genügen. Es ist von aller-
größtem Werte, auf derartige Möglichkeiten hinzu-
weisen, weil dadurch die Begeisterung für den Sama-
riterdienst in die breiten Massen getragen und das
Verständnis für den ganzen Dienst geweckt wird.
Die Haupttätigkeit auf dem Schlachtfelde umfaßt
die Behandlung der Wunden.
Die Operationen treten dabei gegenwärtig an
Zahl in den Hintergrund. Gerade aus den letzten
Kriegen, zum Beispiel dem Balkankriege, haben
unsere deutschen maßgebenden Chirurgen in ver-
schiedenen Veröffentlichungen bewiesen, daß die
nichtoperative Behandlung der Brust-, Bauch- und
-___2
Gelenkschüsse gemeinhin viel bessere Erfolge ergibt
als die Operation.
Der Hauptschwerpunkt fällt deshalb in der ge-
samten Kriegschirurgie aus die Technik der Wund-
behandlung. Zum Glücke ist diese in den letzten
Jahren dermaßen vervollkommnet und zugleich der-
maßen vereinfacht worden, daß sie jeder Laie aus-
führen kann.
Jeder Laie kann hier unseren tapferen Kriegern
und dem ganzen Vaterlande große, erfolgreiche
Dienste leisten.
Den ganzen, großen Wert unserer heutigen Wund-
behandlung versteht man erst dann, wenn man sich
das Verfahren, das vor der nunmehr vereinfachten
Behandlung im allgemeinen Brauche war, vergegen-
wärtigt. Das war die sogenannte Antisepsis, jene
Methode, bei der die Wunden gespült und gewaschen
wurden, und zwar gespült und gewaschen mit
scharfen chemischen Mitteln, wie mit Karbol-, Lysol-
wasser, Sublimat oder essigsaurer Tonerde.
Nachher wurden dann mit denselben Mittelnmoch
Aufschläge und Verbände auf die Wunden gemacht.
Bei dieser Behandlung traten häufige Todesfälle
ein, und so viele Menschen verloren ihre verletzten
Glieder, daß man die Methode zu verlassen begann.
Wie schon im Frieden, so konnte gerade in dem
russisch-türkischen Kriege (1878) ein Chirurg, näm-
lich Professor v. Bergmann, die bedauerlichen Folgen
dieser Behandlung feststellen. Nicht wenige Sol-
daten, die er auf diese Weise behandelte, starben, oder
er mußte ihnen die verletzten Glieder abnehmen,
da an ihnen nach dieser Behandlung häufiger die
fogeuannte „Blutvergiftung" auftrat. In seinem
tiefen Kummer über diese Ergebnisse kam Professor
v. Bergmann auf eine fruchtbare Idee. Er teilte
die Verletzten in zwei Gruppen. Die erste Gruppe
behandelte er wie bisher mit Spülungen von chemi-
schen Wässern. Bei der zweiten Gruppe dagegen
wendete er ein vereinfachtes Verfahren an. Nach-
dem er nämlich seine Hände sorgfältig mit Seifen-
wasser gewaschen und nachher noch mit reinem Al-
kohol abgetupft hatte, nahm er einen trockenen Bausch
eines sogenannten reinen, sterilen Mulls — das ist
ein Mull, der nicht etwa mit chemischen Mitteln ge-
tränkt, sondern durch Dampf keimfrei gemacht ist —
bedeckte damit die Wunde, mit der anderen Hand
nahm er, während die erste ihren Mullbausch auf der
Wunde festhielt, einen zweiten Bausch solchen Mulls,
den er in Seifenwasser getaucht hatte, und wusch
damit nur die umgebende, unverletzte Haut in der
Nachbarschaft der Wunde ab. Die Wunde selbst ließ
er ganz in Ruhe. Nun tupfte er die unverletzte Haut,
bevor er den Bausch von der Wunde entfernte, auch
noch mit reinem Alkohol ab, warf die Mullstücke fort
und legte dann einen neuen trockenen Mullbausch
ganz lose auf die Wunde, breitete Watte darüber und
stellte das Glied mit einer leichten Schiene aus Pappe
oder Holz ruhig.
Der Erfolg war überraschend. Diese zweite
Gruppe von Verwundeten wurde fast durchweg
gesund und behielt ihre Glieder. Bei der ersteren
Gruppe machte Bergmann dieselben Erfahrungen
wie früher, so daß er nunmehr die oben erwähnte
Antisepsis aufgab und alle Soldaten nach der neuen
Methode behandelte.
Aus dem Kriege zurückgekehrt, hat Bergmann
dann seine Entdeckung noch weiter studiert und sic
darauf veröffentlicht. Zu gleicher Zeit traten mit
denselben Erfahrungen wie er die Professoren Es-
march, Länderer und Neuber an die Öffentlichkeit.
Von dem Ergebnis der Untersuchungen sei hier
nur folgendes erwähnt. Jede Wunde, auch selbst
die glatte Schnittwunde, ist sofort mit Bazillen be-
deckt. Diese Bazillen schaden der Wunde aber nichts,
denn das Blut hat neben den roten auch weiße Blut-
körperchen, die im Falle einer Verletzung sofort aus
dem Innern des Körpers zur Wunde hineilen und
durch Klebestoffe eine Festungsmauer des inneren
Körpers gegen die äußere Wunde aufbauen.
Bezüglich der Spülungen mit den chemischen
Wässern fanden die Arzte, daß diese Wässer die Ba-
zillen überhaupt nicht töten, wohl aber zerstören sie
die Weißen Blutkörperchen, sie reißen also die Festung
nieder, ätzen auch die Blutgefäße an und strömen
nun selbst als ein scharfes Gift in den Körper und
mit ihnen die ganze Wundabsonderung und dann
schließlich auch die Bazillen. Und nun beginnt im
Körper eine furchtbare Verheerung, die sogenannte
„Blutvergiftung". Diese Blutvergiftung haben aber
nicht die Bazillen angestiftet, nein umgekehrt, das
Karbol und das Lysol haben sie zuwege gebracht.
Genau zu derselben Zeit, als man Ende der sieb-
ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts die anti-
septische Wundbehandlung einführte, las man plötz-
lich auch in allen Zeitungen alltäglich von den „Blut-
vergiftungen". Bald waren es die Fliegen, bald
sollten ein verrosteter Nagel oder ein altes Messer
diese Blutvergiftung verschuldet haben. Als nun