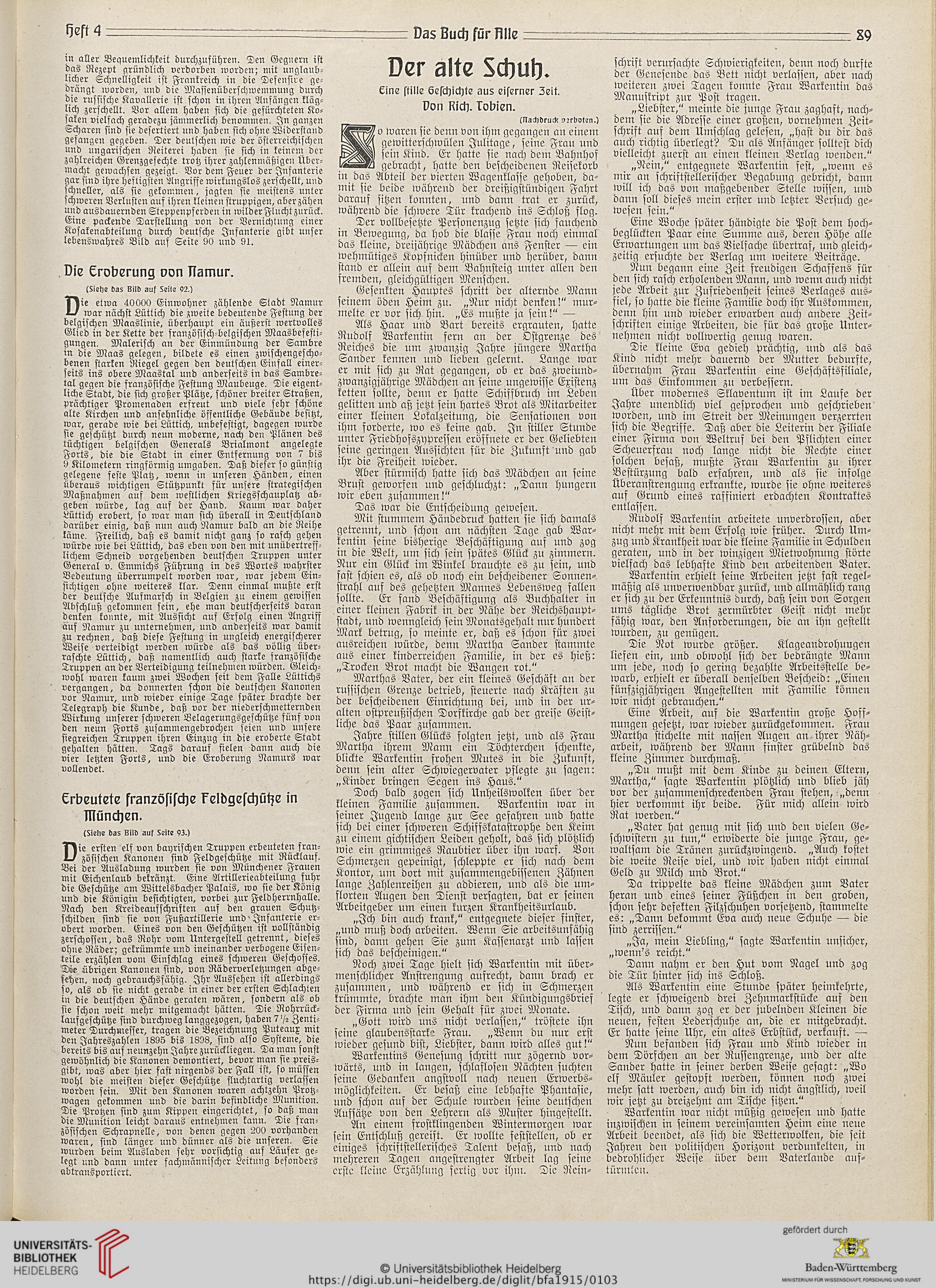kiest 4
Va5 8uch fül- Mle — .. - '. ' - .—. 8Y
in aller Bequemlichkeit durchzuführen. Den Gegnern ist
das Rezept gründlich verdorben worden; mit unglaub-
licher Schnelligkeit ist Frankreich in die Defensive ge-
drängt worden, und die Massenüberschwemmung durch
die russische Kavallerie ist schon in ihren Anfängen kläg-
lich zerschellt. Vor allem haben sich die gefürchteten Ko-
saken vielfach geradezu jämmerlich benommen. In ganzen
Scharen sind sie desertiert und haben sich ohne Widerstand
gefangen gegeben. Der deutschen wie der österreichischen
und ungarischen Reiterei haben sie sich in keinem der
zahlreichen Grenzgefechte trotz ihrer zahlenmäßigen Über-
macht gewachsen gezeigt. Vor dem Feuer der Infanterie
gar sind ihre heftigsten Angriffe wirkungslos zerschellt, und
schneller, als sie gekommen, jagten sie meistens unter
schweren Verlusten aus ihren kleinen struppigen, aber zähen
und ausdauernden Steppenpferden in wilderFluchtzurück.
Eine packende Darstellung von der Vernichtung einer
Kosakenabteilung durch deutsche Infanterie gibt unser
lebenswahres Bild auf Seite 90 und 91.
Vie kl-obei'ung von slamur.
lSiehs Ü35 MU> sus 5e!ts Y2.)
I^ie etwa 40000 Einwohner zählende Stadt Namur
L/ war nächst Lüttich die zweite bedeutende Festung der
belgischen Maaslinie, überhaupt ein äußerst wertvolles
Glied in der Kette der französisch-belgischen Maasbefesti-
gungen. Malerisch an der Einmündung der Sambre
in die Maas gelegen, bildete es einen zwischengescho-
benen starken Riegel gegen den deutschen Einfall einer-
seits ins obere Maastal und anderseits in das Sambre-
tal gegen die französische Festung Maubeuge. Die eigent-
liche Stadt, die sich großer Plätze, schöner breiter Straßen,
prächtiger Promenaden erfreut und viele sehr schöne
alte Kirchen und ansehnliche öffentliche Gebäude besitzt,
war, gerade wie bei Lüttich, unbefestigt, dagegen wurde
sie geschützt durch neun moderne, nach den Plänen des
tüchtigen belgischen Generals Brialmont angelegte
Forts, die die Stadt in einer Entfernung von 7 bis
9 Kilometern ringförmig umgaben. Daß dieser so günstig
gelegene feste Platz, wenn in unseren Händen, einen
überaus wichtigen Stützpunkt für unsere strategischen
Maßnahmen auf dem westlichen Kriegsschauplatz ab-
geben würde, lag auf der Hand. Kaum war daher
Lüttich erobert, so war man sich überall in Deutschland
darüber einig, daß nun auch Namur bald an die Reihe
käme. Freilich, daß es damit nicht ganz so rasch gehen
würde wie bei Lüttich, das eben von den mit unübertreff-
lichem Schneid vorgehenden deutschen Truppen unter
General v. Emmichs Führung in des Wortes wahrster
Bedeutung überrumpelt worden war, war jedem Ein-
sichtigen ohne weiteres klar. Denn einmal mußte erst
der deutsche Aufmarsch in Belgien zu einem gewissen
Abschluß gekommen sein, ehe man deutscherseits daran
denken konnte, mit Aussicht auf Erfolg einen Angriff
aus Namur zu unternehmen, und anderseits war damit
zu rechnen, daß diese Festung in ungleich energischerer
Weise verteidigt werden würde als das völlig über-
raschte Lüttich, daß namentlich auch starke französische
Truppen an der Verteidigung teilnehmen würden. Gleich-
wohl waren kaum zwei Wochen seit dem Falle Lüttichs
vergangen, da donnerten schon die deutschen Kanonen
vor Namur, und wieder einige Tage später brachte der
Telegraph die Kunde, daß vor der niederschmetternden
Wirkung unserer schweren Belagerungsgeschütze fünf von
den neun Forts zusammengebrochen seien und unsere
siegreichen Truppen ihren Einzug in die eroberte Stadt
gehalten hätten. Tags darauf fielen daun auch die
vier letzten Forts, und die Eroberung Namurs war
vollendet.
Erbeutete französische Veldgeschütze in
München.
iSiede d25 MId auf Seile yz.)
7^ie ersten elf von bayrischen Truppen erbeuteten fran-
I-/ zösischen Kanonen sind Feldgeschütze mit Rücklauf.
Bei der Ausladung wurden sie von Münchener Frauen
mit Eichenlaub bekränzt. Eine Artillerieabteilung fuhr
die Geschütze am Wittelsbacher Palais, wo sie der König
und die Königin besichtigten, vorbei zur Feldherrnhalle.
Nach den Kreideaufschriften auf den grauen Schutz-
schilden sind sie von Fußartillerie und'Infanterie er-
obert worden. Eines von den Geschützen ist vollständig
zerschossen, das Rohr vom Untergestell getrennt, dieses
ohne Räder; gekrümmte und ineinander verbogene Eisen-
teile erzählen vom Einschlag eines schweren Geschosses.
Die übrigen Kanonen sind, von Räderverletzungen abge-
sehen, noch gebrauchsfähig. Ihr Aussehen ist allerdings
so, als ob sie nicht gerade in einer der ersten Schlachten
in die deutschen Hände geraten wären, sondern als ob
sie schon weit mehr mitgemacht hätten. Die Rohrrück-
lausgeschütze sind durchweg langgezogen, haben 7 V- Zenti-
meter Durchmesser, tragen die Bezeichnung Puteaux mit
den Jahreszahlen 1895 bis 1898, sind also Systeme, die
bereits bis aus neunzehn Jahre zurückliegen. Da man sonst
gewöhnlich die Kanonen demontiert, bevor man sie preis-
gibt, was aber hier fast nirgends der Fall ist, so müssen
wohl die meisten dieser Geschütze fluchtartig verlassen
morden sein. Mit den Kanonen waren achtzehn Protz-
wagen gekommen und die darin befindliche Munition.
Die Protzen sind zum Kippen eingerichtet, so daß man
die Munition leicht daraus entnehmen kann. Die fran-
zösischen Schrapnelle, von denen gegen 200 vorhanden
waren, sind länger und dünner als die unseren. Sie
wurden beim Ausladen sehr vorsichtig auf Läufer ge-
legt und dann unter fachmännischer Leitung besonders
ablransporticrt.
Des alte 5chuh.
Line stille Seschichte aus eiserner Zeit.
von vich. lobien.
Nachdruck »erbeten.)
o waren sie denn von ihm gegangen an einen:
gewitterschwülen Julitage, seine Frau und
sein Kind. Er hatte sie nach dem Bahnhof
gebracht, hatte den bescheidenen Reisekorb
in das Abteil der vierten Wagenklasse gehoben, da-
mit sie beide während der dreißigstündigen Fahrt
darauf sitzen konnten, und dann trat er zurück,
während die schwere Tür krachend ins Schloß flog.
Der vollbesetzte Personenzug setzte sich fauchend
in Bewegung, da hob die blasse Frau noch einmal
das kleine, dreijährige Mädchen ans Fenster — ein
wehmütiges Kopfnicken hinüber und herüber, dann
stand er allein auf dem Bahnsteig unter allen den
fremden, gleichgültigen Menschen.
Gesenkten Hauptes schritt der alternde Mann
seinem öden Heim zu. „Nur nicht denken!" mur-
melte er vor sich hin. „Es mußte ja sein!" —
Als Haar und Bart bereits ergrauten, hatte
Rudolf Warkentin fern an der Ostgrenze des
Reiches die um zwanzig Jahre jüngere Martha
Sander kennen und lieben gelernt. Lange war
er mit sich zu Rat gegangen, ob er das zweiund-
zwanzigjährige Mädchen an seine ungewisse Existenz
ketten sollte, denn er hatte Schiffbruch im Leben
gelitten und aß jetzt sein hartes Brot als Mitarbeiter
einer kleinen Lokalzeitung, die Sensationen von
ihm forderte, wo es keine gab. In stiller Stunde
unter Friedhofszypressen eröffnete er der Geliebten
seine geringen Aussichten für die Zukunft und gab
ihr die Freiheit wieder.
Aber stürmisch hatte sich das Mädchen an seine
Brust geworfen und geschluchzt: „Dann hungern
wir eben zusammen!"
Das war die Entscheidung gewesen.
Mit stummem Händedruck hatten sie sich damals
getrennt, und schon am nächsten Tage gab War-
kentin seine bisherige Beschäftigung auf und zog
in die Welt, um sich sein spätes Glück zu zimmern.
Nur ein Glück im Winkel brauchte es zu sein, und
fast schien es, als ob noch ein bescheidener Sonnen-
strahl auf des gehetzten Mannes Lebensweg fallen
sollte. Er fand Beschäftigung als Buchhalter in
einer kleinen Fabrik in der Nähe der Reichshaupt-
stadt, und wenngleich sein Monatsgehalt nur hundert
Mark betrug, so meinte er, daß es schon für zwei
ausreichen würde, denn Martha Sander stammte
aus einer kinderreichen Familie, in der es hieß:
„Trocken Brot macht die Wangen rot."
Marthas Vater, der ein kleines Geschäft an der
russischen Grenze betrieb, steuerte nach Kräften zu
der bescheidenen Einrichtung bei, und in der ur-
alten ostpreußischen Dorfkirche gab der greise Geist-
liche das Paar zusammen.
Jahre stillen Glücks folgten jetzt, und als Frau
Martha ihrem Mann ein Töchterchen schenkte,
blickte Warkentin frohen Mutes in die Zukunft,
denn sein alter Schwiegervater Pflegte zu sagen:
„Kinder bringen Segen ins Haus."
Doch bald zogen sich Unheilswolken über der
kleinen Familie zusammen. Warkentin war in
seiner Jugend lange zur See gefahren und hatte
sich bei einer schweren Schiffskatastrophe den Keim
zu einem gichtischen Leiden geholt, das sich plötzlich
wie ein grimmiges Raubtier über ihn warf. Von
Schmerzen gepeinigt, schleppte er sich nach dem
Kontor, um dort mit zusammengebissenen Zähnen
lange Zahlenreihen zu addieren, und als die um-
florten Augen den Dienst versagten, bat er seinen
Arbeitgeber um einen kurzen Krankheitsurlaub.
„Ich bin auch krank," entgegnete dieser finster,
„und muß doch arbeiten. Wenn Sie arbeitsunfähig
sind, dann gehen Sie zum Kassenarzt und lassen
sich das bescheinigen."
Noch zwei Tage hielt sich Warkentin mit über-
menschlicher Anstrengung aufrecht, dann brach er
zusammen, und während er sich in Schmerzen
krümmte, brachte man ihm den Kündigungsbrief
der Firma und sein Gehalt für zwei Monate.
„Gott wird uns nicht verlassen," tröstete ihn
seine glaubensstarke Frau. „Wenn du nur erst
wieder gesund bist, Liebster, dann wird alles gut!"
Warkentins Genesung schritt nur zögernd vor-
wärts, und in langen, schlaflosen Nächten suchten
seine Gedanken angstvoll nach neuen Erwerbs-
möglichkeiten. Er besaß eine lebhafte Phantasie,
und schon auf der Schule wurden seine deutschen
Aufsätze von den Lehrern als Muster hingestellt.
An einem frostklingenden Wintermorgen war
sein Entschluß gereift. Er wollte feststellen, ob er
einiges schriftstellerisches Talent besaß, und nach
mehreren Tagen angestrengter Arbeit lag seine
erste kleine Erzählung fertig vor ihm. Die Rein-
schrift verursachte Schwierigkeiten, denn noch durfte
der Genesende das Bett nicht verlassen, aber nach
weiteren zwei Tagen konnte Frau Warkentin das
Manuskript zur Post tragen.
„Liebster," meinte die junge Frau zaghaft, nach-
dem sie die Adresse einer großen, vornehmen Zeit-
schrift auf dem Umschlag gelesen, „hast du dir das
auch richtig überlegt? Du als Anfänger solltest dich
vielleicht zuerst an einen kleinen Verlag wenden."
„Nein," entgegnete Warkentin fest, „wenn es
mir an schriftstellerischer Begabung gebricht, dann
will ich das von maßgebender Stelle wissen, und
dann soll dieses mein erster und letzter Versuch ge-
wesen sein."
Eine Woche später händigte die Post dem hoch-
beglückten Paar eine Summe aus, deren Höhe alle
Erwartungen um das Vielfache übertraf, und gleich-
zeitig ersuchte der Verlag um weitere Beiträge.
Nun begann eine Zeit freudigen Schaffens für
den sich rasch erholenden Mann, und wenn auch nicht
jede Arbeit zur Zufriedenheit seines Verlages aus-
fiel, so hatte die kleine Familie doch ihr Auskommen,
denn hin und wieder erwarben auch andere Zeit-
schriften einige Arbeiten, die für das große Unter-
nehmen nicht vollwertig genug waren.
Die kleine Eva gedieh prächtig, und als das
Kind nicht mehr dauernd der Mutter bedurfte,
übernahm Frau Warkentin eine Geschäftsfiliale,
um das Einkommen zn verbessern.
Uber modernes Sklaventum ist im Laufe der
Jahre unendlich viel gesprochen und geschrieben
worden, und im Streit der Meinungen verzerrten
sich die Begriffe. Daß aber die Leiterin der Filiale
einer Firma von Weltruf bei den Pflichten einer
Scheuerfrau noch lange nicht die Rechte einer
solchen besaß, mußte Frau Warkentin zu ihrer
Bestürzung bald erfahren, und als sie infolge
Überanstrengung erkrankte, wurde sie ohne weiteres
auf Grund eines raffiniert erdachten Kontraktes
entlassen.
Rudolf Warkentin arbeitete unverdrossen, aber
nicht mehr mit dem Erfolg wie früher. Durch Um-
zug und Krankheit war die kleine Familie in Schulden
geraten, und in der winzigen Mietwohnung störte
vielfach das lebhafte Kind den arbeitenden Vater.
Warkentin erhielt seine Arbeiten jetzt fast regel-
mäßig als unverwendbar zurück, und allmählich rang
er sich zu der Erkenntnis durch, daß sein von Sorgen
ums tägliche Brot zermürbter Geist nicht mehr
fähig war, den Anforderungen, die an ihn gestellt
wurden, zu genügen.
Die Not wurde größer. Klageandrohungen
liefen ein, und obwohl sich der bedrängte Mann
um jede, noch so gering bezahlte Arbeitsstelle be-
warb, erhielt er überall denselben Bescheid: „Einen
fünfzigjährigen Angestellten mit Familie können
wir nicht gebrauchen."
Eine Arbeit, auf die Warkentin große Hoff-
nungen gesetzt, war wieder zurückgekommen. Frau
Martha stichelte mit nassen Augen an ihrer Näh-
arbeit, während der Mann finster grübelnd das
kleine Zimmer durchmaß.
„Du mußt mit dem Kinde zu deinen Eltern,
Martha," sagte Warkentin plötzlich und blieb jäh
vor der zusammenschreckenden Frau stehen, „denn
hier verkommt ihr beide. Für mich allein wird
Rat werden."
„Vater hat genug mit sich und den vielen Ge-
schwistern zu tun," erwiderte die junge Frau, ge-
waltsam die Tränen zurückzwingend. „Auch kostet
die weite Reise viel, und wir haben nicht einmal
Geld zu Milch und Brot."
Da trippelte das kleine Mädchen zum Vater
heran und eines seiner Füßchen in den groben,
schon sehr defekten Filzschuhen vorsetzend, stammelte
es: „Dann bekommt Eva auch neue Schuhe — die
sind zerrissen."
„Ja, mein Liebling," sagte Warkentin unsicher,
„wenn's reicht."
Dann nahm er den Hut vom Nagel und zog
die Tür hinter sich ins Schloß.
Als Warkentin eine Stunde später heimkehrte,
legte er schweigend drei Zehnmarkstücke auf den
Tisch, und dann zog er der jubelnden Kleinen die
neuen, festen Lederschuhe an, die er mitgebracht.
Er hatte seine Uhr, ein altes Erbstück, verkauft. —
Nun befanden sich Frau und Kind wieder in
dem Dörfchen an der Russengrenze, und der alte
Sander hatte in seiner derben Weise gesagt: „Wo
elf Mäuler gestopft werden, können noch zwei
mehr satt werden, auch bin ich nicht ängstlich, weil
wir jetzt zu dreizehnt am Tische sitzen."
Warkentin war nicht müßig gewesen und hatte
inzwischen in seinem vereinsamten Heim eine neue
Arbeit beendet, als sich die Wetterwolken, die seit
Jahren den politischen Horizont verdunkelten, in
bedrohlicher Weise über dem Vaterlande auf-
türmten.
Va5 8uch fül- Mle — .. - '. ' - .—. 8Y
in aller Bequemlichkeit durchzuführen. Den Gegnern ist
das Rezept gründlich verdorben worden; mit unglaub-
licher Schnelligkeit ist Frankreich in die Defensive ge-
drängt worden, und die Massenüberschwemmung durch
die russische Kavallerie ist schon in ihren Anfängen kläg-
lich zerschellt. Vor allem haben sich die gefürchteten Ko-
saken vielfach geradezu jämmerlich benommen. In ganzen
Scharen sind sie desertiert und haben sich ohne Widerstand
gefangen gegeben. Der deutschen wie der österreichischen
und ungarischen Reiterei haben sie sich in keinem der
zahlreichen Grenzgefechte trotz ihrer zahlenmäßigen Über-
macht gewachsen gezeigt. Vor dem Feuer der Infanterie
gar sind ihre heftigsten Angriffe wirkungslos zerschellt, und
schneller, als sie gekommen, jagten sie meistens unter
schweren Verlusten aus ihren kleinen struppigen, aber zähen
und ausdauernden Steppenpferden in wilderFluchtzurück.
Eine packende Darstellung von der Vernichtung einer
Kosakenabteilung durch deutsche Infanterie gibt unser
lebenswahres Bild auf Seite 90 und 91.
Vie kl-obei'ung von slamur.
lSiehs Ü35 MU> sus 5e!ts Y2.)
I^ie etwa 40000 Einwohner zählende Stadt Namur
L/ war nächst Lüttich die zweite bedeutende Festung der
belgischen Maaslinie, überhaupt ein äußerst wertvolles
Glied in der Kette der französisch-belgischen Maasbefesti-
gungen. Malerisch an der Einmündung der Sambre
in die Maas gelegen, bildete es einen zwischengescho-
benen starken Riegel gegen den deutschen Einfall einer-
seits ins obere Maastal und anderseits in das Sambre-
tal gegen die französische Festung Maubeuge. Die eigent-
liche Stadt, die sich großer Plätze, schöner breiter Straßen,
prächtiger Promenaden erfreut und viele sehr schöne
alte Kirchen und ansehnliche öffentliche Gebäude besitzt,
war, gerade wie bei Lüttich, unbefestigt, dagegen wurde
sie geschützt durch neun moderne, nach den Plänen des
tüchtigen belgischen Generals Brialmont angelegte
Forts, die die Stadt in einer Entfernung von 7 bis
9 Kilometern ringförmig umgaben. Daß dieser so günstig
gelegene feste Platz, wenn in unseren Händen, einen
überaus wichtigen Stützpunkt für unsere strategischen
Maßnahmen auf dem westlichen Kriegsschauplatz ab-
geben würde, lag auf der Hand. Kaum war daher
Lüttich erobert, so war man sich überall in Deutschland
darüber einig, daß nun auch Namur bald an die Reihe
käme. Freilich, daß es damit nicht ganz so rasch gehen
würde wie bei Lüttich, das eben von den mit unübertreff-
lichem Schneid vorgehenden deutschen Truppen unter
General v. Emmichs Führung in des Wortes wahrster
Bedeutung überrumpelt worden war, war jedem Ein-
sichtigen ohne weiteres klar. Denn einmal mußte erst
der deutsche Aufmarsch in Belgien zu einem gewissen
Abschluß gekommen sein, ehe man deutscherseits daran
denken konnte, mit Aussicht auf Erfolg einen Angriff
aus Namur zu unternehmen, und anderseits war damit
zu rechnen, daß diese Festung in ungleich energischerer
Weise verteidigt werden würde als das völlig über-
raschte Lüttich, daß namentlich auch starke französische
Truppen an der Verteidigung teilnehmen würden. Gleich-
wohl waren kaum zwei Wochen seit dem Falle Lüttichs
vergangen, da donnerten schon die deutschen Kanonen
vor Namur, und wieder einige Tage später brachte der
Telegraph die Kunde, daß vor der niederschmetternden
Wirkung unserer schweren Belagerungsgeschütze fünf von
den neun Forts zusammengebrochen seien und unsere
siegreichen Truppen ihren Einzug in die eroberte Stadt
gehalten hätten. Tags darauf fielen daun auch die
vier letzten Forts, und die Eroberung Namurs war
vollendet.
Erbeutete französische Veldgeschütze in
München.
iSiede d25 MId auf Seile yz.)
7^ie ersten elf von bayrischen Truppen erbeuteten fran-
I-/ zösischen Kanonen sind Feldgeschütze mit Rücklauf.
Bei der Ausladung wurden sie von Münchener Frauen
mit Eichenlaub bekränzt. Eine Artillerieabteilung fuhr
die Geschütze am Wittelsbacher Palais, wo sie der König
und die Königin besichtigten, vorbei zur Feldherrnhalle.
Nach den Kreideaufschriften auf den grauen Schutz-
schilden sind sie von Fußartillerie und'Infanterie er-
obert worden. Eines von den Geschützen ist vollständig
zerschossen, das Rohr vom Untergestell getrennt, dieses
ohne Räder; gekrümmte und ineinander verbogene Eisen-
teile erzählen vom Einschlag eines schweren Geschosses.
Die übrigen Kanonen sind, von Räderverletzungen abge-
sehen, noch gebrauchsfähig. Ihr Aussehen ist allerdings
so, als ob sie nicht gerade in einer der ersten Schlachten
in die deutschen Hände geraten wären, sondern als ob
sie schon weit mehr mitgemacht hätten. Die Rohrrück-
lausgeschütze sind durchweg langgezogen, haben 7 V- Zenti-
meter Durchmesser, tragen die Bezeichnung Puteaux mit
den Jahreszahlen 1895 bis 1898, sind also Systeme, die
bereits bis aus neunzehn Jahre zurückliegen. Da man sonst
gewöhnlich die Kanonen demontiert, bevor man sie preis-
gibt, was aber hier fast nirgends der Fall ist, so müssen
wohl die meisten dieser Geschütze fluchtartig verlassen
morden sein. Mit den Kanonen waren achtzehn Protz-
wagen gekommen und die darin befindliche Munition.
Die Protzen sind zum Kippen eingerichtet, so daß man
die Munition leicht daraus entnehmen kann. Die fran-
zösischen Schrapnelle, von denen gegen 200 vorhanden
waren, sind länger und dünner als die unseren. Sie
wurden beim Ausladen sehr vorsichtig auf Läufer ge-
legt und dann unter fachmännischer Leitung besonders
ablransporticrt.
Des alte 5chuh.
Line stille Seschichte aus eiserner Zeit.
von vich. lobien.
Nachdruck »erbeten.)
o waren sie denn von ihm gegangen an einen:
gewitterschwülen Julitage, seine Frau und
sein Kind. Er hatte sie nach dem Bahnhof
gebracht, hatte den bescheidenen Reisekorb
in das Abteil der vierten Wagenklasse gehoben, da-
mit sie beide während der dreißigstündigen Fahrt
darauf sitzen konnten, und dann trat er zurück,
während die schwere Tür krachend ins Schloß flog.
Der vollbesetzte Personenzug setzte sich fauchend
in Bewegung, da hob die blasse Frau noch einmal
das kleine, dreijährige Mädchen ans Fenster — ein
wehmütiges Kopfnicken hinüber und herüber, dann
stand er allein auf dem Bahnsteig unter allen den
fremden, gleichgültigen Menschen.
Gesenkten Hauptes schritt der alternde Mann
seinem öden Heim zu. „Nur nicht denken!" mur-
melte er vor sich hin. „Es mußte ja sein!" —
Als Haar und Bart bereits ergrauten, hatte
Rudolf Warkentin fern an der Ostgrenze des
Reiches die um zwanzig Jahre jüngere Martha
Sander kennen und lieben gelernt. Lange war
er mit sich zu Rat gegangen, ob er das zweiund-
zwanzigjährige Mädchen an seine ungewisse Existenz
ketten sollte, denn er hatte Schiffbruch im Leben
gelitten und aß jetzt sein hartes Brot als Mitarbeiter
einer kleinen Lokalzeitung, die Sensationen von
ihm forderte, wo es keine gab. In stiller Stunde
unter Friedhofszypressen eröffnete er der Geliebten
seine geringen Aussichten für die Zukunft und gab
ihr die Freiheit wieder.
Aber stürmisch hatte sich das Mädchen an seine
Brust geworfen und geschluchzt: „Dann hungern
wir eben zusammen!"
Das war die Entscheidung gewesen.
Mit stummem Händedruck hatten sie sich damals
getrennt, und schon am nächsten Tage gab War-
kentin seine bisherige Beschäftigung auf und zog
in die Welt, um sich sein spätes Glück zu zimmern.
Nur ein Glück im Winkel brauchte es zu sein, und
fast schien es, als ob noch ein bescheidener Sonnen-
strahl auf des gehetzten Mannes Lebensweg fallen
sollte. Er fand Beschäftigung als Buchhalter in
einer kleinen Fabrik in der Nähe der Reichshaupt-
stadt, und wenngleich sein Monatsgehalt nur hundert
Mark betrug, so meinte er, daß es schon für zwei
ausreichen würde, denn Martha Sander stammte
aus einer kinderreichen Familie, in der es hieß:
„Trocken Brot macht die Wangen rot."
Marthas Vater, der ein kleines Geschäft an der
russischen Grenze betrieb, steuerte nach Kräften zu
der bescheidenen Einrichtung bei, und in der ur-
alten ostpreußischen Dorfkirche gab der greise Geist-
liche das Paar zusammen.
Jahre stillen Glücks folgten jetzt, und als Frau
Martha ihrem Mann ein Töchterchen schenkte,
blickte Warkentin frohen Mutes in die Zukunft,
denn sein alter Schwiegervater Pflegte zu sagen:
„Kinder bringen Segen ins Haus."
Doch bald zogen sich Unheilswolken über der
kleinen Familie zusammen. Warkentin war in
seiner Jugend lange zur See gefahren und hatte
sich bei einer schweren Schiffskatastrophe den Keim
zu einem gichtischen Leiden geholt, das sich plötzlich
wie ein grimmiges Raubtier über ihn warf. Von
Schmerzen gepeinigt, schleppte er sich nach dem
Kontor, um dort mit zusammengebissenen Zähnen
lange Zahlenreihen zu addieren, und als die um-
florten Augen den Dienst versagten, bat er seinen
Arbeitgeber um einen kurzen Krankheitsurlaub.
„Ich bin auch krank," entgegnete dieser finster,
„und muß doch arbeiten. Wenn Sie arbeitsunfähig
sind, dann gehen Sie zum Kassenarzt und lassen
sich das bescheinigen."
Noch zwei Tage hielt sich Warkentin mit über-
menschlicher Anstrengung aufrecht, dann brach er
zusammen, und während er sich in Schmerzen
krümmte, brachte man ihm den Kündigungsbrief
der Firma und sein Gehalt für zwei Monate.
„Gott wird uns nicht verlassen," tröstete ihn
seine glaubensstarke Frau. „Wenn du nur erst
wieder gesund bist, Liebster, dann wird alles gut!"
Warkentins Genesung schritt nur zögernd vor-
wärts, und in langen, schlaflosen Nächten suchten
seine Gedanken angstvoll nach neuen Erwerbs-
möglichkeiten. Er besaß eine lebhafte Phantasie,
und schon auf der Schule wurden seine deutschen
Aufsätze von den Lehrern als Muster hingestellt.
An einem frostklingenden Wintermorgen war
sein Entschluß gereift. Er wollte feststellen, ob er
einiges schriftstellerisches Talent besaß, und nach
mehreren Tagen angestrengter Arbeit lag seine
erste kleine Erzählung fertig vor ihm. Die Rein-
schrift verursachte Schwierigkeiten, denn noch durfte
der Genesende das Bett nicht verlassen, aber nach
weiteren zwei Tagen konnte Frau Warkentin das
Manuskript zur Post tragen.
„Liebster," meinte die junge Frau zaghaft, nach-
dem sie die Adresse einer großen, vornehmen Zeit-
schrift auf dem Umschlag gelesen, „hast du dir das
auch richtig überlegt? Du als Anfänger solltest dich
vielleicht zuerst an einen kleinen Verlag wenden."
„Nein," entgegnete Warkentin fest, „wenn es
mir an schriftstellerischer Begabung gebricht, dann
will ich das von maßgebender Stelle wissen, und
dann soll dieses mein erster und letzter Versuch ge-
wesen sein."
Eine Woche später händigte die Post dem hoch-
beglückten Paar eine Summe aus, deren Höhe alle
Erwartungen um das Vielfache übertraf, und gleich-
zeitig ersuchte der Verlag um weitere Beiträge.
Nun begann eine Zeit freudigen Schaffens für
den sich rasch erholenden Mann, und wenn auch nicht
jede Arbeit zur Zufriedenheit seines Verlages aus-
fiel, so hatte die kleine Familie doch ihr Auskommen,
denn hin und wieder erwarben auch andere Zeit-
schriften einige Arbeiten, die für das große Unter-
nehmen nicht vollwertig genug waren.
Die kleine Eva gedieh prächtig, und als das
Kind nicht mehr dauernd der Mutter bedurfte,
übernahm Frau Warkentin eine Geschäftsfiliale,
um das Einkommen zn verbessern.
Uber modernes Sklaventum ist im Laufe der
Jahre unendlich viel gesprochen und geschrieben
worden, und im Streit der Meinungen verzerrten
sich die Begriffe. Daß aber die Leiterin der Filiale
einer Firma von Weltruf bei den Pflichten einer
Scheuerfrau noch lange nicht die Rechte einer
solchen besaß, mußte Frau Warkentin zu ihrer
Bestürzung bald erfahren, und als sie infolge
Überanstrengung erkrankte, wurde sie ohne weiteres
auf Grund eines raffiniert erdachten Kontraktes
entlassen.
Rudolf Warkentin arbeitete unverdrossen, aber
nicht mehr mit dem Erfolg wie früher. Durch Um-
zug und Krankheit war die kleine Familie in Schulden
geraten, und in der winzigen Mietwohnung störte
vielfach das lebhafte Kind den arbeitenden Vater.
Warkentin erhielt seine Arbeiten jetzt fast regel-
mäßig als unverwendbar zurück, und allmählich rang
er sich zu der Erkenntnis durch, daß sein von Sorgen
ums tägliche Brot zermürbter Geist nicht mehr
fähig war, den Anforderungen, die an ihn gestellt
wurden, zu genügen.
Die Not wurde größer. Klageandrohungen
liefen ein, und obwohl sich der bedrängte Mann
um jede, noch so gering bezahlte Arbeitsstelle be-
warb, erhielt er überall denselben Bescheid: „Einen
fünfzigjährigen Angestellten mit Familie können
wir nicht gebrauchen."
Eine Arbeit, auf die Warkentin große Hoff-
nungen gesetzt, war wieder zurückgekommen. Frau
Martha stichelte mit nassen Augen an ihrer Näh-
arbeit, während der Mann finster grübelnd das
kleine Zimmer durchmaß.
„Du mußt mit dem Kinde zu deinen Eltern,
Martha," sagte Warkentin plötzlich und blieb jäh
vor der zusammenschreckenden Frau stehen, „denn
hier verkommt ihr beide. Für mich allein wird
Rat werden."
„Vater hat genug mit sich und den vielen Ge-
schwistern zu tun," erwiderte die junge Frau, ge-
waltsam die Tränen zurückzwingend. „Auch kostet
die weite Reise viel, und wir haben nicht einmal
Geld zu Milch und Brot."
Da trippelte das kleine Mädchen zum Vater
heran und eines seiner Füßchen in den groben,
schon sehr defekten Filzschuhen vorsetzend, stammelte
es: „Dann bekommt Eva auch neue Schuhe — die
sind zerrissen."
„Ja, mein Liebling," sagte Warkentin unsicher,
„wenn's reicht."
Dann nahm er den Hut vom Nagel und zog
die Tür hinter sich ins Schloß.
Als Warkentin eine Stunde später heimkehrte,
legte er schweigend drei Zehnmarkstücke auf den
Tisch, und dann zog er der jubelnden Kleinen die
neuen, festen Lederschuhe an, die er mitgebracht.
Er hatte seine Uhr, ein altes Erbstück, verkauft. —
Nun befanden sich Frau und Kind wieder in
dem Dörfchen an der Russengrenze, und der alte
Sander hatte in seiner derben Weise gesagt: „Wo
elf Mäuler gestopft werden, können noch zwei
mehr satt werden, auch bin ich nicht ängstlich, weil
wir jetzt zu dreizehnt am Tische sitzen."
Warkentin war nicht müßig gewesen und hatte
inzwischen in seinem vereinsamten Heim eine neue
Arbeit beendet, als sich die Wetterwolken, die seit
Jahren den politischen Horizont verdunkelten, in
bedrohlicher Weise über dem Vaterlande auf-
türmten.