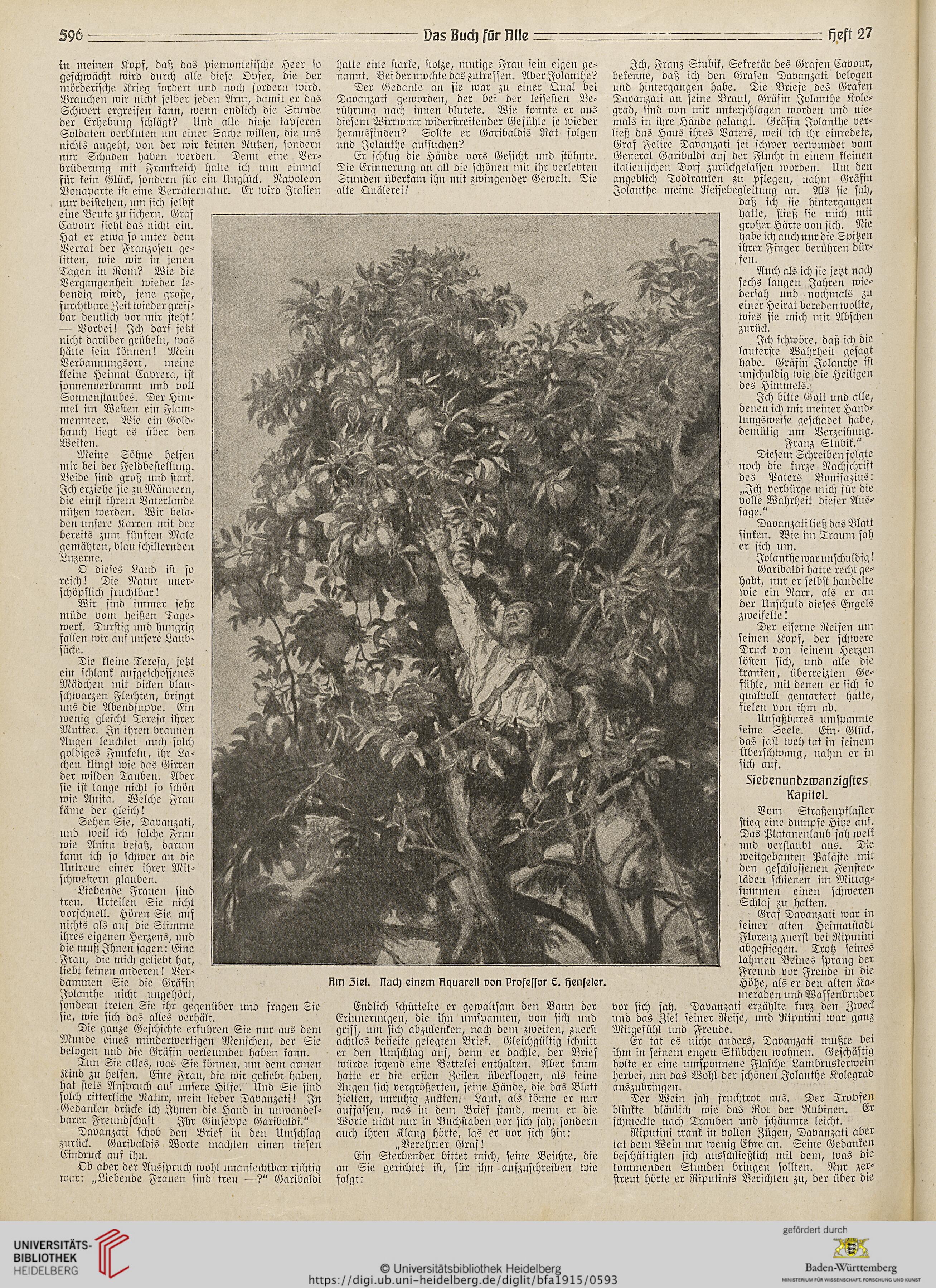5y6
1)35 Luch für Mle .7.77.-."7..-"-77.-/ " l)eft 27
in meinen Kopf, daß das Piemontesische Heer so
geschwächt wird durch alle diese Opfer, die der
mörderische Krieg fordert und noch fordern wird.
Brauchen wir nicht selber jeden Arm, damit er das
Schwert ergreifen kann, wenn endlich die Stunde
der Erhebung schlägt? Und alle diese tapferen
Soldaten verbluten um einer Sache willen, die uns
nichts angeht, von der wir keinen Nutzen, sondern
nur Schaden haben werden. Denn eine Ver-
brüderung mit Frankreich halte ich nun einmal
für kein Glück, sondern für ein Unglück. Napoleon
Bonaparte ist eine Verräternatur. Er wird Italien
nur beisteheu, um sich selbst
eine Beute zu sichern. Graf
Cavour sieht das nicht ein.
Hat er etwa so unter dem
Verrat der Franzosen ge-
litten, wie wir in jenen
Tagen in Rom? Wie die
Vergangenheit wieder le-
bendig wird, jene große,
furchtbare Zeit wieder greif-
bar deutlich vor mir steht!
— Vorbei! Ich darf jetzt
nicht darüber grübeln, was
hätte sein können! Mein
Verbannungsort, meine
kleine Heimat Caprera, ist
sonnenverbrannt und voll
Sonnenstaubes. Der Him-
mel im Westen ein Flam-
menmeer. Wie ein Gold-
hauch liegt es über den
Weiten.
Meine Söhne helfen
mir bei der Feldbestellung.
Beide sind groß und stark.
Ich erziehe sie zu Männern,
die einst ihren: Vaterlande
nützen werden. Wir bela-
den unsere Karren mit der
bereits zum fünften Male
gemähten, blau schillernden
Luzerne.
O dieses Land ist so
reich! Die Natur uner-
schöpflich fruchtbar!
Wir sind immer sehr
müde vom heißen Tage-
werk. Durstig und hungrig
fallen wir auf unsere Laub-
säcke.
Die kleine Teresa, jetzt
ein schlank aufgeschossenes
Mädchen mit dicken blau-
schwarzen Flechten, bringt
uns die Abendsuppe. Ein
wenig gleicht Teresa ihrer
Mutter. In ihren braunen
Augen leuchtet auch solch
goldiges Funkeln, ihr La-
chen klingt wie das Girren
der wilden Tauben. Aber
sie ist lange nicht so schön
wie Anita. Welche Frau
käme der gleich!
Sehen Sie, Davanzati,
und weil ich solche Frau
wie Anita besaß, darum
kann ich so schwer an die
Untreue einer ihrer Mit-
schwestern glauben.
Liebende Frauen sind
treu. Urteilen Sie nicht
vorschnell. Hören Sie auf
nichts als auf die Stimme
ihres eigenen Herzens, und
die muß Ihnen sagen: Eine
Frau, die mich geliebt hat,
liebt keinen anderen! Ver-
dammen Sie die Gräfin
Jolanthe nicht ungehört,
sondern treten Sie ihr gegenüber und fragen Sie
sie, wie sich das alles verhält.
Die ganze Geschichte erfuhren Sie nur aus dem
Munde eines minderwertigen Menschen, der Sie
belogen und die Gräfin verleumdet haben kann.
Tun Sie alles, was Sie können, um dem armen
Kind zu helfen. Eine Frau, die wir geliebt haben,
hat stets Anspruch auf unsere Hilfe. Und Sie sind
solch ritterliche Natur, mein lieber Davanzati! In
Gedanken drücke ich Ihnen die Hand in unwandel-
barer Freundschaft Ihr Giuseppe Garibaldi."
Davanzati schob den Brief in den Umschlag
zurück. Garibaldis Worte machten einen tiefen
Eindruck auf ihn.
Ob aber der Ausspruch wohl unanfechtbar richtig
war: „Liebende Frauen sind treu —?" Garibaldi
hatte eine starke, stolze, mutige Frau sein eigen ge-
nannt. Bei der mochte das zutreffen. Aber Jolanthe?
Der Gedanke an sie war zu einer Qual bei
Davanzati geworden, der bei der leisesten Be-
rührung nach innen blutete. Wie konnte er aus
diesem Wirrwarr widerstreitender Gefühle je wieder
herausfinden? Sollte er Garibaldis Rat folgen
und Jolanthe aufsuchen?
Er schlug die Hände vors Gesicht und stöhnte.
Die Erinnerung an all die schönen mit ihr verlebten
Stunden überkam ihn mit zwingender Gewalt. Die
alte Quälerei/
Endlich schüttelte er gewaltsam den Bann der
Erinnerungen, die ihn umspannen, von sich und
griff, um sich abzuleuken, nach dem zweiten, zuerst
achtlos beiseite gelegten Brief. Gleichgültig schnitt
er den Umschlag auf, denn er dachte, der Brief
würde irgend eine Bettelei enthalten. Aber kaum
hatte er die ersten Zeilen überflogen, als feine
Augen sich vergrößerten, seine Hände, die das Blatt
hielten, unruhig zuckten. Laut, als könne er nur
auffasseu, was in dem Brief stand, wenn er die
Worte nicht nur in Buchstaben vor sich sah, sondern
auch ihren Klang hörte, las er vor sich hin:
„Verehrter Graf!
Ein Sterbender bittet mich, seine Beichte, die
an Sie gerichtet ist, für ihn aufzufchreiben wie
folgt:
Ich, Franz Stubik, Sekretär des Grafen Cavour,
bekenne, daß ich den Grafen Davanzati belogen
und hintergangen habe. Die Briefe des Grafen
Davanzati an seine Braut, Gräfin Jolanthe Kole-
grad, sind von mir unterschlagen worden und nie-
mals in ihre Hände gelangt. Gräfin Jolanthe ver-
ließ das Haus ihres Vaters, weil ich ihr einredete,
Graf Felice Davanzati sei schwer verwundet vom
General Garibaldi auf der Flucht in einem kleinen
italienischen Dorf zurückgelassen worden. Um den
angeblich Todkranken zu pflegen, nahm Gräfin
Jolanthe meine Reisebegleitung an. Als sie sah,
daß ich sie hintergangen
hatte, stieß sie mich nut
großer Härte von sich. Nie
habe ich auch nur die Spitzen
ihrer Finger berühren dür-
fen.
Auch als ich sie jetzt nach
sechs langen Jahren wie-
dersah und nochmals zu
einer Heirat bereden wollte,
wies sie mich mit Abscheu
zurück.
Ich schwöre, daß ich die
lauterste Wahrheit gesagt
habe. Gräfin Jolanthe ist
unschuldig wie die Heiligen
des Himmels.-
Ich bitte Gott und alle,
denen ich mit meiner Hand-
lungsweise geschadet habe,
demütig um Verzeihung.
Franz Stubik."
Diesem Schreiben folgte
noch die kurze Nachschrift
des Paters Bonifazius:
„Ich verbürge mich für die
volle Wahrheit dieser Aus-
sage."
Davanzatiließ das Blatt
sinken. Wie im Traum sah
er sich um.
Jolanthe war unschuldig!
Garibaldi hatte recht ge-
habt, nur er selbst handelte
wie ein Narr, als er an
der Unschuld dieses Engels
zweifelte!
Der eiserne Reifen um
seinen Kopf, der schwere
Druck von seinem Herzen
lösten sich, und alle die
kranken, überreizten Ge-
fühle, mit denen er sich so
qualvoll gemartert hatte,
fielen von ihm ab.
Unfaßbares umspannte
seine Seele. Ein- Glück,
das fast weh tat in seinem
Überschwang, nahm er in
sich auf.
5iebenun!)rwglkrigste5
Kapitel.
Vom Straßenpflaster
stieg eine dumpfe Hitze auf.
Das Platanenlaub sah welk
und verstaubt aus. Die
weitgebauten Paläste mit
den geschlossenen Fenster-
läden schienen im Mittag-
summen einen schweren
Schlaf zu halten.
Graf Davanzati war in
seiner alten Heimatstadt
Florenz zuerst bei Riputini
abgestiegön. Trotz seines
lahmen Beines sprang der
Freund vor Freude in die
Höhe, als er den alten Ka-
meraden und Waffenbruder
vor sich sah. Davanzati erzählte kurz den Zweck
und das Ziel seiner Reise, und Riputini war ganz
Mitgefühl und Freude.
Er tat es nicht anders, Davanzati mußte bei
ihm in seinem engen Stübchen wohnen. Geschäftig
holte er eine umsponnene Flasche Lambruskerwein
herbei, um das Wohl der schönen Jolanthe Kolegrad
auszubringen.
Der Wein sah fruchtrot aus. Der Tropfen
blinkte bläulich wie das Rot der Rubinen. Er
schmeckte nach Trauben und schäumte leicht.
Riputini trank in vollen Zügen, Davanzati aber
tat dem Wein nur wenig Ehre au. Seine Gedanken
beschäftigten sich ausschließlich mit dem, was die
kommenden Stunden bringen sollten. Nur zer-
streut hörte er Riputinis Berichten zu, der über die
Nm Ziel. Nach einem NquareN von Professor L. kjenfeler.
1)35 Luch für Mle .7.77.-."7..-"-77.-/ " l)eft 27
in meinen Kopf, daß das Piemontesische Heer so
geschwächt wird durch alle diese Opfer, die der
mörderische Krieg fordert und noch fordern wird.
Brauchen wir nicht selber jeden Arm, damit er das
Schwert ergreifen kann, wenn endlich die Stunde
der Erhebung schlägt? Und alle diese tapferen
Soldaten verbluten um einer Sache willen, die uns
nichts angeht, von der wir keinen Nutzen, sondern
nur Schaden haben werden. Denn eine Ver-
brüderung mit Frankreich halte ich nun einmal
für kein Glück, sondern für ein Unglück. Napoleon
Bonaparte ist eine Verräternatur. Er wird Italien
nur beisteheu, um sich selbst
eine Beute zu sichern. Graf
Cavour sieht das nicht ein.
Hat er etwa so unter dem
Verrat der Franzosen ge-
litten, wie wir in jenen
Tagen in Rom? Wie die
Vergangenheit wieder le-
bendig wird, jene große,
furchtbare Zeit wieder greif-
bar deutlich vor mir steht!
— Vorbei! Ich darf jetzt
nicht darüber grübeln, was
hätte sein können! Mein
Verbannungsort, meine
kleine Heimat Caprera, ist
sonnenverbrannt und voll
Sonnenstaubes. Der Him-
mel im Westen ein Flam-
menmeer. Wie ein Gold-
hauch liegt es über den
Weiten.
Meine Söhne helfen
mir bei der Feldbestellung.
Beide sind groß und stark.
Ich erziehe sie zu Männern,
die einst ihren: Vaterlande
nützen werden. Wir bela-
den unsere Karren mit der
bereits zum fünften Male
gemähten, blau schillernden
Luzerne.
O dieses Land ist so
reich! Die Natur uner-
schöpflich fruchtbar!
Wir sind immer sehr
müde vom heißen Tage-
werk. Durstig und hungrig
fallen wir auf unsere Laub-
säcke.
Die kleine Teresa, jetzt
ein schlank aufgeschossenes
Mädchen mit dicken blau-
schwarzen Flechten, bringt
uns die Abendsuppe. Ein
wenig gleicht Teresa ihrer
Mutter. In ihren braunen
Augen leuchtet auch solch
goldiges Funkeln, ihr La-
chen klingt wie das Girren
der wilden Tauben. Aber
sie ist lange nicht so schön
wie Anita. Welche Frau
käme der gleich!
Sehen Sie, Davanzati,
und weil ich solche Frau
wie Anita besaß, darum
kann ich so schwer an die
Untreue einer ihrer Mit-
schwestern glauben.
Liebende Frauen sind
treu. Urteilen Sie nicht
vorschnell. Hören Sie auf
nichts als auf die Stimme
ihres eigenen Herzens, und
die muß Ihnen sagen: Eine
Frau, die mich geliebt hat,
liebt keinen anderen! Ver-
dammen Sie die Gräfin
Jolanthe nicht ungehört,
sondern treten Sie ihr gegenüber und fragen Sie
sie, wie sich das alles verhält.
Die ganze Geschichte erfuhren Sie nur aus dem
Munde eines minderwertigen Menschen, der Sie
belogen und die Gräfin verleumdet haben kann.
Tun Sie alles, was Sie können, um dem armen
Kind zu helfen. Eine Frau, die wir geliebt haben,
hat stets Anspruch auf unsere Hilfe. Und Sie sind
solch ritterliche Natur, mein lieber Davanzati! In
Gedanken drücke ich Ihnen die Hand in unwandel-
barer Freundschaft Ihr Giuseppe Garibaldi."
Davanzati schob den Brief in den Umschlag
zurück. Garibaldis Worte machten einen tiefen
Eindruck auf ihn.
Ob aber der Ausspruch wohl unanfechtbar richtig
war: „Liebende Frauen sind treu —?" Garibaldi
hatte eine starke, stolze, mutige Frau sein eigen ge-
nannt. Bei der mochte das zutreffen. Aber Jolanthe?
Der Gedanke an sie war zu einer Qual bei
Davanzati geworden, der bei der leisesten Be-
rührung nach innen blutete. Wie konnte er aus
diesem Wirrwarr widerstreitender Gefühle je wieder
herausfinden? Sollte er Garibaldis Rat folgen
und Jolanthe aufsuchen?
Er schlug die Hände vors Gesicht und stöhnte.
Die Erinnerung an all die schönen mit ihr verlebten
Stunden überkam ihn mit zwingender Gewalt. Die
alte Quälerei/
Endlich schüttelte er gewaltsam den Bann der
Erinnerungen, die ihn umspannen, von sich und
griff, um sich abzuleuken, nach dem zweiten, zuerst
achtlos beiseite gelegten Brief. Gleichgültig schnitt
er den Umschlag auf, denn er dachte, der Brief
würde irgend eine Bettelei enthalten. Aber kaum
hatte er die ersten Zeilen überflogen, als feine
Augen sich vergrößerten, seine Hände, die das Blatt
hielten, unruhig zuckten. Laut, als könne er nur
auffasseu, was in dem Brief stand, wenn er die
Worte nicht nur in Buchstaben vor sich sah, sondern
auch ihren Klang hörte, las er vor sich hin:
„Verehrter Graf!
Ein Sterbender bittet mich, seine Beichte, die
an Sie gerichtet ist, für ihn aufzufchreiben wie
folgt:
Ich, Franz Stubik, Sekretär des Grafen Cavour,
bekenne, daß ich den Grafen Davanzati belogen
und hintergangen habe. Die Briefe des Grafen
Davanzati an seine Braut, Gräfin Jolanthe Kole-
grad, sind von mir unterschlagen worden und nie-
mals in ihre Hände gelangt. Gräfin Jolanthe ver-
ließ das Haus ihres Vaters, weil ich ihr einredete,
Graf Felice Davanzati sei schwer verwundet vom
General Garibaldi auf der Flucht in einem kleinen
italienischen Dorf zurückgelassen worden. Um den
angeblich Todkranken zu pflegen, nahm Gräfin
Jolanthe meine Reisebegleitung an. Als sie sah,
daß ich sie hintergangen
hatte, stieß sie mich nut
großer Härte von sich. Nie
habe ich auch nur die Spitzen
ihrer Finger berühren dür-
fen.
Auch als ich sie jetzt nach
sechs langen Jahren wie-
dersah und nochmals zu
einer Heirat bereden wollte,
wies sie mich mit Abscheu
zurück.
Ich schwöre, daß ich die
lauterste Wahrheit gesagt
habe. Gräfin Jolanthe ist
unschuldig wie die Heiligen
des Himmels.-
Ich bitte Gott und alle,
denen ich mit meiner Hand-
lungsweise geschadet habe,
demütig um Verzeihung.
Franz Stubik."
Diesem Schreiben folgte
noch die kurze Nachschrift
des Paters Bonifazius:
„Ich verbürge mich für die
volle Wahrheit dieser Aus-
sage."
Davanzatiließ das Blatt
sinken. Wie im Traum sah
er sich um.
Jolanthe war unschuldig!
Garibaldi hatte recht ge-
habt, nur er selbst handelte
wie ein Narr, als er an
der Unschuld dieses Engels
zweifelte!
Der eiserne Reifen um
seinen Kopf, der schwere
Druck von seinem Herzen
lösten sich, und alle die
kranken, überreizten Ge-
fühle, mit denen er sich so
qualvoll gemartert hatte,
fielen von ihm ab.
Unfaßbares umspannte
seine Seele. Ein- Glück,
das fast weh tat in seinem
Überschwang, nahm er in
sich auf.
5iebenun!)rwglkrigste5
Kapitel.
Vom Straßenpflaster
stieg eine dumpfe Hitze auf.
Das Platanenlaub sah welk
und verstaubt aus. Die
weitgebauten Paläste mit
den geschlossenen Fenster-
läden schienen im Mittag-
summen einen schweren
Schlaf zu halten.
Graf Davanzati war in
seiner alten Heimatstadt
Florenz zuerst bei Riputini
abgestiegön. Trotz seines
lahmen Beines sprang der
Freund vor Freude in die
Höhe, als er den alten Ka-
meraden und Waffenbruder
vor sich sah. Davanzati erzählte kurz den Zweck
und das Ziel seiner Reise, und Riputini war ganz
Mitgefühl und Freude.
Er tat es nicht anders, Davanzati mußte bei
ihm in seinem engen Stübchen wohnen. Geschäftig
holte er eine umsponnene Flasche Lambruskerwein
herbei, um das Wohl der schönen Jolanthe Kolegrad
auszubringen.
Der Wein sah fruchtrot aus. Der Tropfen
blinkte bläulich wie das Rot der Rubinen. Er
schmeckte nach Trauben und schäumte leicht.
Riputini trank in vollen Zügen, Davanzati aber
tat dem Wein nur wenig Ehre au. Seine Gedanken
beschäftigten sich ausschließlich mit dem, was die
kommenden Stunden bringen sollten. Nur zer-
streut hörte er Riputinis Berichten zu, der über die
Nm Ziel. Nach einem NquareN von Professor L. kjenfeler.