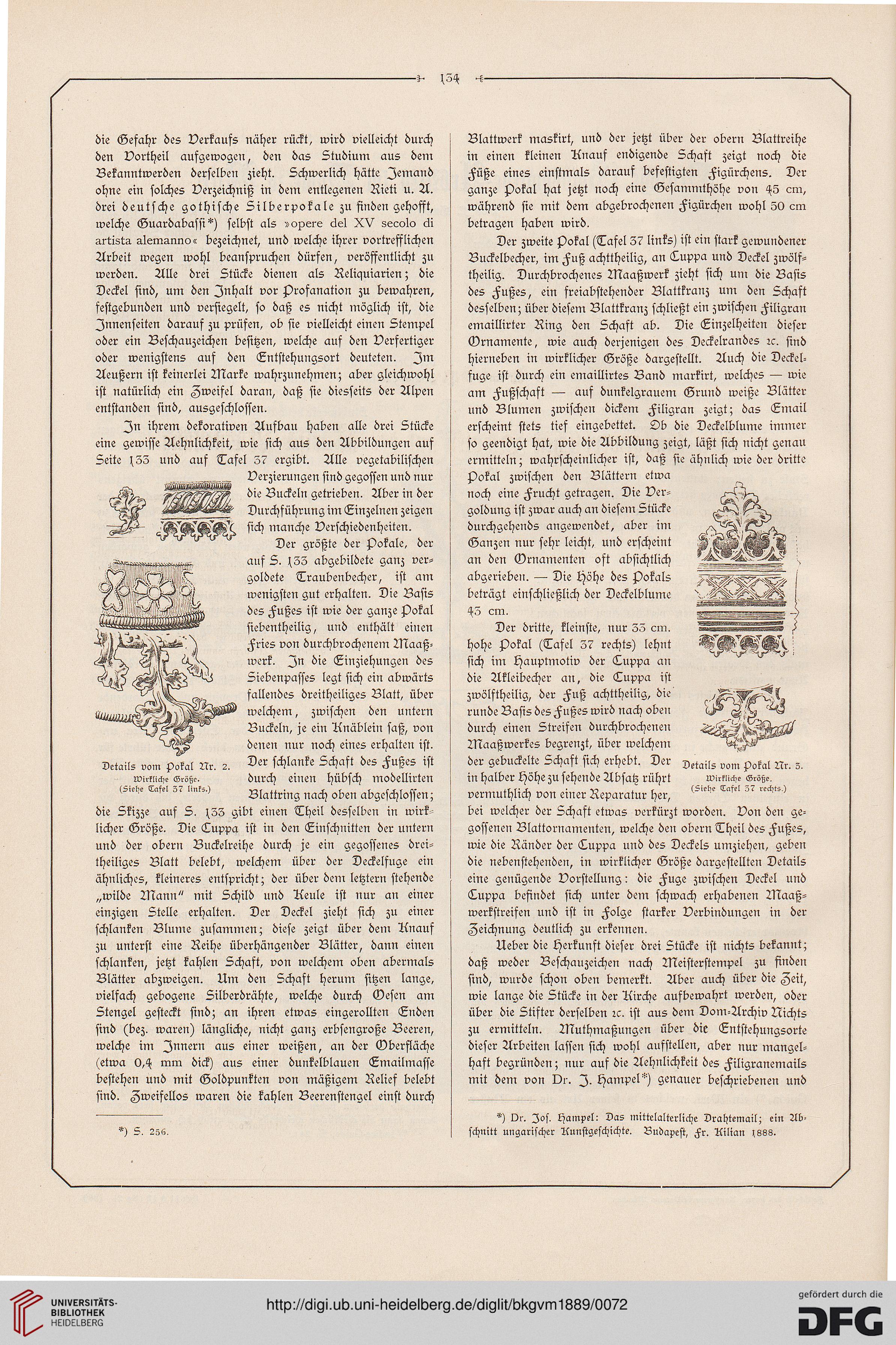4- (5^ -£•
die Gefahr des Verkaufs näher rückt, wird vielleicht durch
den Vortheil aufgewogen, den das Studium aus dein
Bekanntwerden derselben zieht. Schwerlich hätte Jemand
ohne ein solches Verzeichniß in dem entlegenen Rieti u. A.
drei deutsche gothische Silberpokale zu finden gehofft,
welche Guardabassi*) selbst als »opere del XV secolo di
artista alemanno« bezeichnet, und welche ihrer vortrefflichen
Arbeit wegen wohl beanspruchen dürfen, veröffentlicht zu
werden. Alle drei Stücke dienen als Reliquiarien; die
Deckel find, um den Inhalt vor Prosanation zu bewahren,
festgebunden und versiegelt, so daß es nicht möglich ist, die
Innenseiten darauf zu prüfen, ob sie vielleicht einen Stempel
oder ein Beschauzeichen besitzen, welche aus den Verfertiger
oder wenigstens auf den Entstehungsort deuteten. Im
Aeußern ist keinerlei Marke wahrzunehmen; aber gleichwohl
ist natürlich ein Zweifel daran, daß sie diesseits der Alpen
entstanden sind, ausgeschlossen.
In ihrem dekorativen Aufbau haben alle drei Stücke
eine gewisse Aehnlichkeit, wie sich aus den Abbildungen auf
Seite \55 und auf Tafel 57 ergibt. Alle vegetabilischen
Verzierungen sind gegossen und nur
die Buckeln getrieben. Aber in der
Durchführung im Einzelnen zeigen
sich manche Verschiedenheiten.
Der größte der Pokale, der
auf S. {55 abgebildete ganz ver-
goldete Traubenbccher, ist an:
wenigsten gut erhalten. Die Basis
des Fußes ist wie der ganze Pokal
siebentheilig, und enthält einen
Fries von durchbrochenem Maaß-
werk. In die Einziehungen des
Sicbenpaffes legt sich ein abwärts
fallendes dreitheiliges Blatt, über
welchen:, zwischen den untern
Buckeln, je ein Knäblein saß, von
denen nur noch eines erhalten ist.
Der schlanke Schaft des Fußes ist
durch einen hübsch modellirten
Blattring nach oben abgeschlossen;
die Skizze auf S. (33 gibt einen Theil desselben in wirk-
licher Größe. Die Tuppa ist in den Einschnitten der untern
und der ober» Buckclreihe durch je ein gegossenes drei-
theiliges Blatt belebt, welchem über der Deckelfuge ein
ähnliches, kleineres entspricht; der über dem letztern stehende
„wilde Mann" mit Schild und Keule ist nur an einer
einzigen Stelle erhalten. Der Deckel zieht sich zu einer
schlanken Blume zusammen; diese zeigt über dem Knauf
zu unterst eine Reihe überhängender Blätter, dann einen
schlanken, jetzt kahlen Schaft, von welchem oben abermals
Blätter abzweigen. Um den Schaft herum sitzen lange,
vielfach gebogene Silberdrähte, welche durch Oesen am
Stengel gesteckt sind; an ihren etwas eingerollten Enden
sind (bez. waren) längliche, nicht ganz erbsengroße Beeren,
welche im Innern aus einer weißen, an der Oberfläche
(etwa 0,4> mm dick) aus einer dunkelblauen Enmilmaffe
bestehen und mit Goldpunkten von mäßigem Relief belebt
sind. Zweifellos waren die kahlen Beerenstengel einst durch
Details vom Pokal Nr. 2.
wirkliche Größe.
(Siebe Tafel 37 links.)
*) S, 256.
Blattwerk maskirt, und der jetzt über der obern Blattreihe
in einen kleinen Knauf endigende Schaft zeigt noch die
Füße eines einstmals darauf befestigten Figürchens. Der
ganze Pokal hat jetzt noch eine Gesammthöhe von ^5 cm,
während sie mit dem abgebrochenen Figürcheu wohl 30 cm
betragen haben wird.
Der zweite Pokal (Tafel 57 links) ist ein stark gewundener
Buckelbecher, im Fuß achttheilig, an Tuppa und Deckel zwölf-
theilig. Durchbrochenes Maaßwerk zieht sich um die Basis
des Fußes, ein freiabstehender Blattkranz um den Schaft
desselben; über diesem Blattkranz schließt ein zwischen Filigran
emaillirter Ring den Schaft ab. Die Einzelheiten dieser
Ornamente, wie auch derjenigen des Deckelrandes re. sind
hierneben in wirklicher Größe dargestellt. Auch die Deckel-
fuge ist durch ein emaillirtes Band markirt, welches — wie
am Fußschaft — auf dunkelgrünem Grund weiße Blätter
und Blumen zwischen dickem Filigran zeigt; das Einail
erscheint stets tief eingebettet. Ob die Deckelblume immer
so geendigt hat, wie die Abbildung zeigt, läßt sich nicht genau
ermitteln; wahrscheinlicher ist, daß sie ähnlich wie der dritte
Pokal zwischen den Blättern etwa
noch eine Frucht getragen. Die Ver-
goldung ist zwar auch an diesein Stücke
durchgeheuds angewendet, aber im
Ganzen nur sehr leicht, und erscheint
an den Ornamenten oft absichtlich
abgerieben. — Die Höhe des Pokals
beträgt einschließlich der Deckelblume
H5 cm.
Der dritte, kleinste, nur 33 cm.
hohe Pokal (Tafel 57 rechts) lehnt
sich in: Hauptmotiv der Tuppa an
die Akleibecher an, die Tuppa ist
zwölftheilig, der Fuß achttheilig, die
runde Basis des Fußes wird nach oben
durch einen Streifen durchbrochenen
Maaßwerkes begrenzt, über welchen:
der gebuckelte Schaft sich erhebt. Der
in halber Höhe zu sehende Absatz rührt
vermuthlich von einer Reparatur her,
bei welcher der Schaft etwas verkürzt worden. Von den ge-
gossenen Blattornamenten, welche den obern Theil des Fußes,
wie die Ränder der Tuppa und des Deckels umziehen, geben
die nebenstehenden, in wirklicher Größe dargestellten Details
eine genügende Vorstellung: die Fuge zwischen Deckel und
Tuppa befindet sich unter dem schwach erhabenen Maaß-
werkstreifen und ist in Folge starker Verbindungen in der
Zeichnung deutlich zu erkennen.
Ueber die Herkunft dieser drei Stücke ist nichts bekannt;
daß weder Beschauzeichen nach Meisterstempel zu finden
sind, wurde schon oben bemerkt. Aber auch über die Zeit,
wie lange die Stücke in der Kirche aufbewahrt werden, oder
über die Stifter derselben rc. ist aus dein Dom-Archiv Nichts
zu ermitteln. Muthmaßungen über die Entstehungsorte
dieser Arbeiten lassen sich wohl aufstellen, aber nur mangel-
haft begründen; nur auf die Aehnlichkeit des Filigrauemails
mit dem von Dr. I. Hampel*) genauer beschriebenen und
Details vom Pokal Nr. 3.
wirkliche Größe.
(Siebe Tafel 37 rechts.)
*) Dr. Jos. tjampel: Das mittelalterliche Dralstemail; ein Ab-
schnitt ungarischer Kunstgeschichte. Budapest, Fr. Kilian ;888.
die Gefahr des Verkaufs näher rückt, wird vielleicht durch
den Vortheil aufgewogen, den das Studium aus dein
Bekanntwerden derselben zieht. Schwerlich hätte Jemand
ohne ein solches Verzeichniß in dem entlegenen Rieti u. A.
drei deutsche gothische Silberpokale zu finden gehofft,
welche Guardabassi*) selbst als »opere del XV secolo di
artista alemanno« bezeichnet, und welche ihrer vortrefflichen
Arbeit wegen wohl beanspruchen dürfen, veröffentlicht zu
werden. Alle drei Stücke dienen als Reliquiarien; die
Deckel find, um den Inhalt vor Prosanation zu bewahren,
festgebunden und versiegelt, so daß es nicht möglich ist, die
Innenseiten darauf zu prüfen, ob sie vielleicht einen Stempel
oder ein Beschauzeichen besitzen, welche aus den Verfertiger
oder wenigstens auf den Entstehungsort deuteten. Im
Aeußern ist keinerlei Marke wahrzunehmen; aber gleichwohl
ist natürlich ein Zweifel daran, daß sie diesseits der Alpen
entstanden sind, ausgeschlossen.
In ihrem dekorativen Aufbau haben alle drei Stücke
eine gewisse Aehnlichkeit, wie sich aus den Abbildungen auf
Seite \55 und auf Tafel 57 ergibt. Alle vegetabilischen
Verzierungen sind gegossen und nur
die Buckeln getrieben. Aber in der
Durchführung im Einzelnen zeigen
sich manche Verschiedenheiten.
Der größte der Pokale, der
auf S. {55 abgebildete ganz ver-
goldete Traubenbccher, ist an:
wenigsten gut erhalten. Die Basis
des Fußes ist wie der ganze Pokal
siebentheilig, und enthält einen
Fries von durchbrochenem Maaß-
werk. In die Einziehungen des
Sicbenpaffes legt sich ein abwärts
fallendes dreitheiliges Blatt, über
welchen:, zwischen den untern
Buckeln, je ein Knäblein saß, von
denen nur noch eines erhalten ist.
Der schlanke Schaft des Fußes ist
durch einen hübsch modellirten
Blattring nach oben abgeschlossen;
die Skizze auf S. (33 gibt einen Theil desselben in wirk-
licher Größe. Die Tuppa ist in den Einschnitten der untern
und der ober» Buckclreihe durch je ein gegossenes drei-
theiliges Blatt belebt, welchem über der Deckelfuge ein
ähnliches, kleineres entspricht; der über dem letztern stehende
„wilde Mann" mit Schild und Keule ist nur an einer
einzigen Stelle erhalten. Der Deckel zieht sich zu einer
schlanken Blume zusammen; diese zeigt über dem Knauf
zu unterst eine Reihe überhängender Blätter, dann einen
schlanken, jetzt kahlen Schaft, von welchem oben abermals
Blätter abzweigen. Um den Schaft herum sitzen lange,
vielfach gebogene Silberdrähte, welche durch Oesen am
Stengel gesteckt sind; an ihren etwas eingerollten Enden
sind (bez. waren) längliche, nicht ganz erbsengroße Beeren,
welche im Innern aus einer weißen, an der Oberfläche
(etwa 0,4> mm dick) aus einer dunkelblauen Enmilmaffe
bestehen und mit Goldpunkten von mäßigem Relief belebt
sind. Zweifellos waren die kahlen Beerenstengel einst durch
Details vom Pokal Nr. 2.
wirkliche Größe.
(Siebe Tafel 37 links.)
*) S, 256.
Blattwerk maskirt, und der jetzt über der obern Blattreihe
in einen kleinen Knauf endigende Schaft zeigt noch die
Füße eines einstmals darauf befestigten Figürchens. Der
ganze Pokal hat jetzt noch eine Gesammthöhe von ^5 cm,
während sie mit dem abgebrochenen Figürcheu wohl 30 cm
betragen haben wird.
Der zweite Pokal (Tafel 57 links) ist ein stark gewundener
Buckelbecher, im Fuß achttheilig, an Tuppa und Deckel zwölf-
theilig. Durchbrochenes Maaßwerk zieht sich um die Basis
des Fußes, ein freiabstehender Blattkranz um den Schaft
desselben; über diesem Blattkranz schließt ein zwischen Filigran
emaillirter Ring den Schaft ab. Die Einzelheiten dieser
Ornamente, wie auch derjenigen des Deckelrandes re. sind
hierneben in wirklicher Größe dargestellt. Auch die Deckel-
fuge ist durch ein emaillirtes Band markirt, welches — wie
am Fußschaft — auf dunkelgrünem Grund weiße Blätter
und Blumen zwischen dickem Filigran zeigt; das Einail
erscheint stets tief eingebettet. Ob die Deckelblume immer
so geendigt hat, wie die Abbildung zeigt, läßt sich nicht genau
ermitteln; wahrscheinlicher ist, daß sie ähnlich wie der dritte
Pokal zwischen den Blättern etwa
noch eine Frucht getragen. Die Ver-
goldung ist zwar auch an diesein Stücke
durchgeheuds angewendet, aber im
Ganzen nur sehr leicht, und erscheint
an den Ornamenten oft absichtlich
abgerieben. — Die Höhe des Pokals
beträgt einschließlich der Deckelblume
H5 cm.
Der dritte, kleinste, nur 33 cm.
hohe Pokal (Tafel 57 rechts) lehnt
sich in: Hauptmotiv der Tuppa an
die Akleibecher an, die Tuppa ist
zwölftheilig, der Fuß achttheilig, die
runde Basis des Fußes wird nach oben
durch einen Streifen durchbrochenen
Maaßwerkes begrenzt, über welchen:
der gebuckelte Schaft sich erhebt. Der
in halber Höhe zu sehende Absatz rührt
vermuthlich von einer Reparatur her,
bei welcher der Schaft etwas verkürzt worden. Von den ge-
gossenen Blattornamenten, welche den obern Theil des Fußes,
wie die Ränder der Tuppa und des Deckels umziehen, geben
die nebenstehenden, in wirklicher Größe dargestellten Details
eine genügende Vorstellung: die Fuge zwischen Deckel und
Tuppa befindet sich unter dem schwach erhabenen Maaß-
werkstreifen und ist in Folge starker Verbindungen in der
Zeichnung deutlich zu erkennen.
Ueber die Herkunft dieser drei Stücke ist nichts bekannt;
daß weder Beschauzeichen nach Meisterstempel zu finden
sind, wurde schon oben bemerkt. Aber auch über die Zeit,
wie lange die Stücke in der Kirche aufbewahrt werden, oder
über die Stifter derselben rc. ist aus dein Dom-Archiv Nichts
zu ermitteln. Muthmaßungen über die Entstehungsorte
dieser Arbeiten lassen sich wohl aufstellen, aber nur mangel-
haft begründen; nur auf die Aehnlichkeit des Filigrauemails
mit dem von Dr. I. Hampel*) genauer beschriebenen und
Details vom Pokal Nr. 3.
wirkliche Größe.
(Siebe Tafel 37 rechts.)
*) Dr. Jos. tjampel: Das mittelalterliche Dralstemail; ein Ab-
schnitt ungarischer Kunstgeschichte. Budapest, Fr. Kilian ;888.