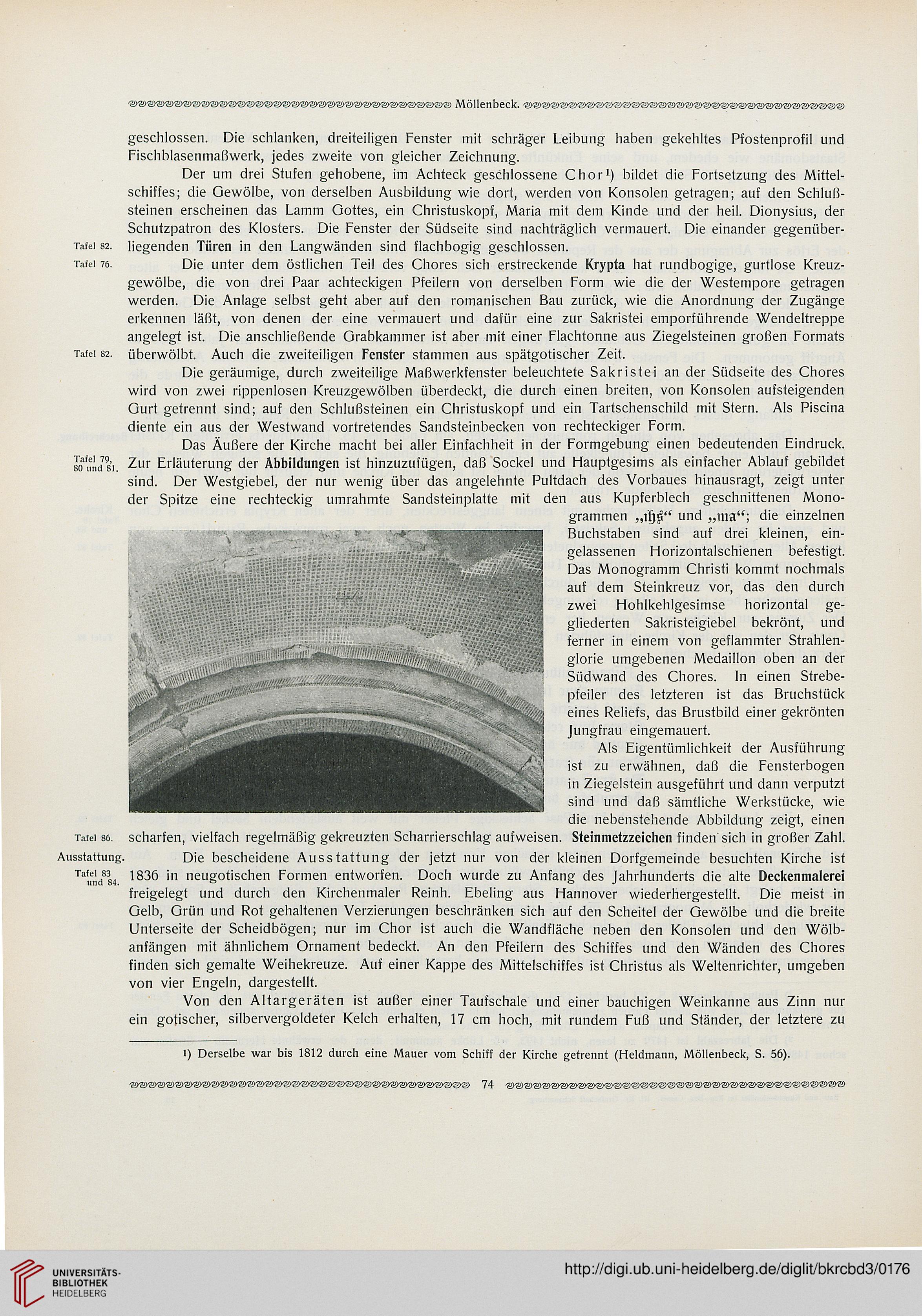/^^'&^>^y&^ys>^>>&^>&^^ Möllenbeck. ■a>@>®®^!)®®®xs)®®®s>s>a)®®®®e>@>e>s^
Tafel 79,
80 und 81.
geschlossen. Die schlanken, dreiteiligen Fenster mit schräger Leibung haben gekehltes Pfostenprofil und
Fischblasenmaßwerk, jedes zweite von gleicher Zeichnung.
Der um drei Stufen gehobene, im Achteck geschlossene Chor') bildet die Fortsetzung des Mittel-
schiffes; die Gewölbe, von derselben Ausbildung wie dort, werden von Konsolen getragen; auf den Schluß-
steinen erscheinen das Lamm Gottes, ein Christuskopf, Maria mit dem Kinde und der heil. Dionysius, der
Schutzpatron des Klosters. Die Fenster der Südseite sind nachträglich vermauert. Die einander gegenüber-
Tafei 82. liegenden Türen in den Langwänden sind flachbogig geschlossen.
Tafel 76. Die unter dem östlichen Teil des Chores sich erstreckende Krypta hat rundbogige, gurtlose Kreuz-
gewölbe, die von drei Paar achteckigen Pfeilern von derselben Form wie die der Westempore getragen
werden. Die Anlage selbst geht aber auf den romanischen Bau zurück, wie die Anordnung der Zugänge
erkennen läßt, von denen der eine vermauert und dafür eine zur Sakristei emporführende Wendeltreppe
angelegt ist. Die anschließende Grabkammer ist aber mit einer Flachtonne aus Ziegelsteinen großen Formats
Tafci 82. überwölbt. Auch die zweiteiligen Fenster stammen aus spätgotischer Zeit.
Die geräumige, durch zweiteilige Maßwerkfenster beleuchtete Sakristei an der Südseite des Chores
wird von zwei rippenlosen Kreuzgewölben überdeckt, die durch einen breiten, von Konsolen aufsteigenden
Gurt getrennt sind; auf den Schlußsteinen ein Christuskopf und ein Tartschenschild mit Stern. Als Piscina
diente ein aus der Westwand vortretendes Sandsteinbecken von rechteckiger Form.
Das Äußere der Kirche macht bei aller Einfachheit in der Formgebung einen bedeutenden Eindruck.
Zur Erläuterung der Abbildungen ist hinzuzufügen, daß Sockel und Hauptgesims als einfacher Ablauf gebildet
sind. Der Westgiebel, der nur wenig über das angelehnte Pultdach des Vorbaues hinausragt, zeigt unter
der Spitze eine rechteckig umrahmte Sandsteinplatte mit den aus Kupferblech geschnittenen Mono-
grammen „il)*i" und „ma"; die einzelnen
Buchstaben sind auf drei kleinen, ein-
gelassenen Horizontalschienen befestigt.
Das Monogramm Christi kommt nochmals
auf dem Steinkreuz vor, das den durch
zwei Hohlkehlgesimse horizontal ge-
gliederten Sakristeigiebel bekrönt, und
ferner in einem von geflammter Strahlen-
glorie umgebenen Medaillon oben an der
Südwand des Chores. In einen Strebe-
pfeiler des letzteren ist das Bruchstück
eines Reliefs, das Brustbild einer gekrönten
Jungfrau eingemauert.
Als Eigentümlichkeit der Ausführung
ist zu erwähnen, daß die Fensterbogen
in Ziegelstein ausgeführt und dann verputzt
sind und daß sämtliche Werkstücke, wie
die nebenstehende Abbildung zeigt, einen
Tatei 86. scharfen, vielfach regelmäßig gekreuzten Scharrierschlag aufweisen. Steinmetzzeichen finden sich in großer Zahl.
Ausstattung. Die bescheidene Ausstattung der jetzt nur von der kleinen Dorfgemeinde besuchten Kirche ist
Taumi88-i in neugotischen Formen entworfen. Doch wurde zu Anfang des Jahrhunderts die alte Deckenmalerei
freigelegt und durch den Kirchenmaler Reinh. Ebeling aus Hannover wiederhergestellt. Die meist in
Gelb, Grün und Rot gehaltenen Verzierungen beschränken sich auf den Scheitel der Gewölbe und die breite
Unterseite der Scheidbögen; nur im Chor ist auch die Wandfläche neben den Konsolen und den Wölb-
anfängen mit ähnlichem Ornament bedeckt. An den Pfeilern des Schiffes und den Wänden des Chores
finden sich gemalte Weihekreuze. Auf einer Kappe des Mittelschiffes ist Christus als Weltenrichter, umgeben
von vier Engeln, dargestellt.
Von den Altargeräten ist außer einer Taufschale und einer bauchigen Weinkanne aus Zinn nur
ein gotischer, silbervergoldeter Kelch erhalten, 17 cm hoch, mit rundem Fuß und Ständer, der letztere zu
l) Derselbe war bis 1812 durch eine Mauer vom Schiff der Kirche getrennt (Heldmann, Möllenbeck, S. 56).
Tafel 79,
80 und 81.
geschlossen. Die schlanken, dreiteiligen Fenster mit schräger Leibung haben gekehltes Pfostenprofil und
Fischblasenmaßwerk, jedes zweite von gleicher Zeichnung.
Der um drei Stufen gehobene, im Achteck geschlossene Chor') bildet die Fortsetzung des Mittel-
schiffes; die Gewölbe, von derselben Ausbildung wie dort, werden von Konsolen getragen; auf den Schluß-
steinen erscheinen das Lamm Gottes, ein Christuskopf, Maria mit dem Kinde und der heil. Dionysius, der
Schutzpatron des Klosters. Die Fenster der Südseite sind nachträglich vermauert. Die einander gegenüber-
Tafei 82. liegenden Türen in den Langwänden sind flachbogig geschlossen.
Tafel 76. Die unter dem östlichen Teil des Chores sich erstreckende Krypta hat rundbogige, gurtlose Kreuz-
gewölbe, die von drei Paar achteckigen Pfeilern von derselben Form wie die der Westempore getragen
werden. Die Anlage selbst geht aber auf den romanischen Bau zurück, wie die Anordnung der Zugänge
erkennen läßt, von denen der eine vermauert und dafür eine zur Sakristei emporführende Wendeltreppe
angelegt ist. Die anschließende Grabkammer ist aber mit einer Flachtonne aus Ziegelsteinen großen Formats
Tafci 82. überwölbt. Auch die zweiteiligen Fenster stammen aus spätgotischer Zeit.
Die geräumige, durch zweiteilige Maßwerkfenster beleuchtete Sakristei an der Südseite des Chores
wird von zwei rippenlosen Kreuzgewölben überdeckt, die durch einen breiten, von Konsolen aufsteigenden
Gurt getrennt sind; auf den Schlußsteinen ein Christuskopf und ein Tartschenschild mit Stern. Als Piscina
diente ein aus der Westwand vortretendes Sandsteinbecken von rechteckiger Form.
Das Äußere der Kirche macht bei aller Einfachheit in der Formgebung einen bedeutenden Eindruck.
Zur Erläuterung der Abbildungen ist hinzuzufügen, daß Sockel und Hauptgesims als einfacher Ablauf gebildet
sind. Der Westgiebel, der nur wenig über das angelehnte Pultdach des Vorbaues hinausragt, zeigt unter
der Spitze eine rechteckig umrahmte Sandsteinplatte mit den aus Kupferblech geschnittenen Mono-
grammen „il)*i" und „ma"; die einzelnen
Buchstaben sind auf drei kleinen, ein-
gelassenen Horizontalschienen befestigt.
Das Monogramm Christi kommt nochmals
auf dem Steinkreuz vor, das den durch
zwei Hohlkehlgesimse horizontal ge-
gliederten Sakristeigiebel bekrönt, und
ferner in einem von geflammter Strahlen-
glorie umgebenen Medaillon oben an der
Südwand des Chores. In einen Strebe-
pfeiler des letzteren ist das Bruchstück
eines Reliefs, das Brustbild einer gekrönten
Jungfrau eingemauert.
Als Eigentümlichkeit der Ausführung
ist zu erwähnen, daß die Fensterbogen
in Ziegelstein ausgeführt und dann verputzt
sind und daß sämtliche Werkstücke, wie
die nebenstehende Abbildung zeigt, einen
Tatei 86. scharfen, vielfach regelmäßig gekreuzten Scharrierschlag aufweisen. Steinmetzzeichen finden sich in großer Zahl.
Ausstattung. Die bescheidene Ausstattung der jetzt nur von der kleinen Dorfgemeinde besuchten Kirche ist
Taumi88-i in neugotischen Formen entworfen. Doch wurde zu Anfang des Jahrhunderts die alte Deckenmalerei
freigelegt und durch den Kirchenmaler Reinh. Ebeling aus Hannover wiederhergestellt. Die meist in
Gelb, Grün und Rot gehaltenen Verzierungen beschränken sich auf den Scheitel der Gewölbe und die breite
Unterseite der Scheidbögen; nur im Chor ist auch die Wandfläche neben den Konsolen und den Wölb-
anfängen mit ähnlichem Ornament bedeckt. An den Pfeilern des Schiffes und den Wänden des Chores
finden sich gemalte Weihekreuze. Auf einer Kappe des Mittelschiffes ist Christus als Weltenrichter, umgeben
von vier Engeln, dargestellt.
Von den Altargeräten ist außer einer Taufschale und einer bauchigen Weinkanne aus Zinn nur
ein gotischer, silbervergoldeter Kelch erhalten, 17 cm hoch, mit rundem Fuß und Ständer, der letztere zu
l) Derselbe war bis 1812 durch eine Mauer vom Schiff der Kirche getrennt (Heldmann, Möllenbeck, S. 56).