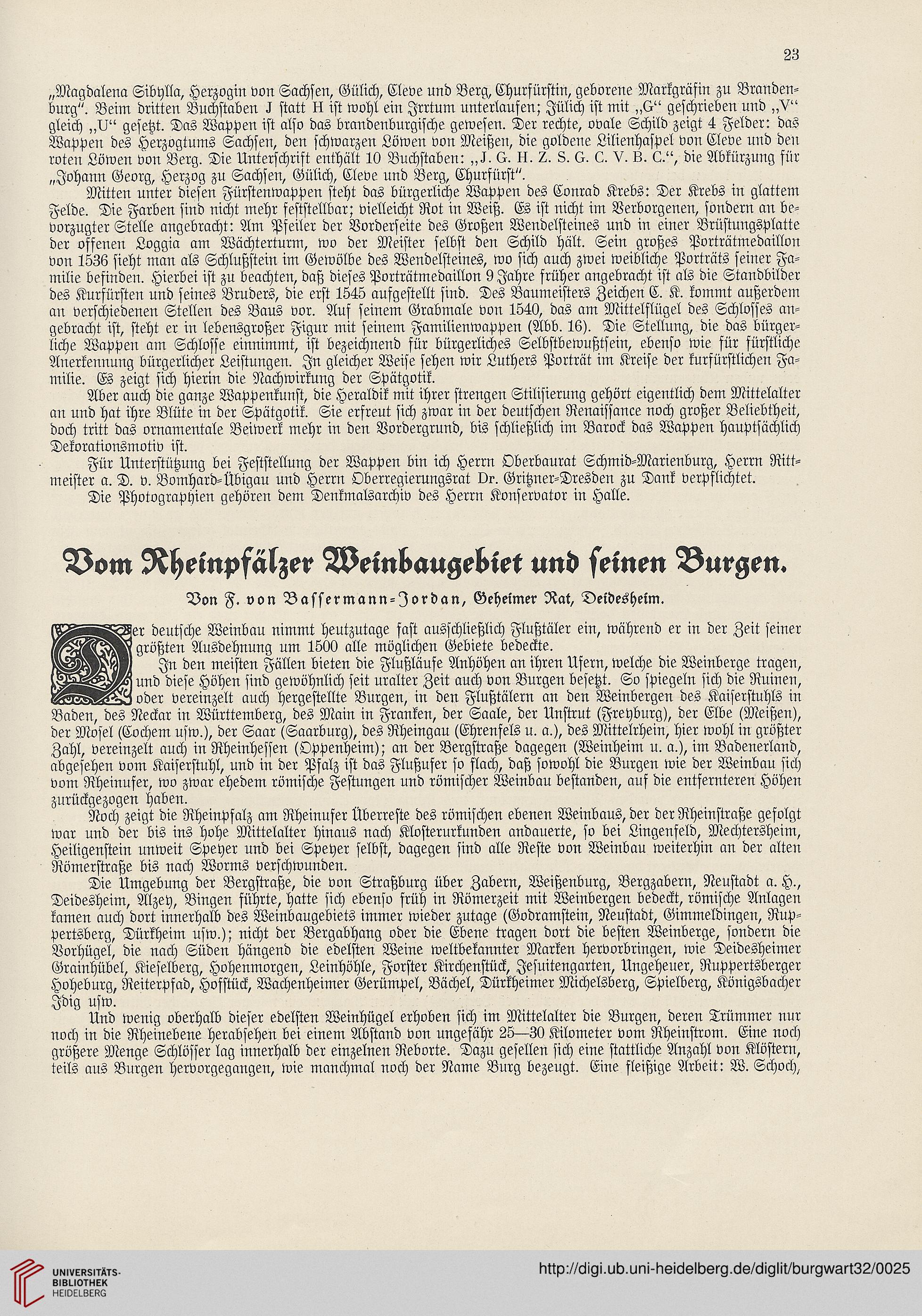23
„Magdalena Sibylla, Herzogin von Sachsen, Gülich, Cleve und Berg, Churfürstin, geborene Markgräfin zu Branden-
burg". Beim dritten Buchstaben 1 statt II ist wohl ein Irrtum unterlaufen; Jülich ist mit „O" geschrieben und „V"
gleich „II" gesetzt. Das Wappen ist also das brandenburgische gewesen. Der rechte, ovale Schild zeigt 4 Felder: das
Wappen des Herzogtums Sachsen, den schwarzen Löwen von Meißen, die goldene Lilienhaspel von Cleve und den
roten Löwen von Berg. Die Unterschrift enthält 10 Buchstaben: „1. O. II. 2. 8. O. L. V. H. 6.", die Abkürzung für
„Johann Georg, Herzog zu Sachsen, Gülich, Cleve und Berg, Churfürst".
Mitten unter diesen Fürstenwappen steht das bürgerliche Wappen des Conrad Krebs: Der Krebs in glattem
Felde. Die Farben sind nicht mehr feststellbar; vielleicht Rot in Weiß. Es ist nicht im Verborgenen, sondern an be-
vorzugter Stelle angebracht: Am Pfeiler der Vorderseite des Großen Wendelsteines und in einer Brüstungsplatte
der offenen Loggia am Wächterturm, wo der Meister selbst den Schild hält. Sein großes Porträtmedaillon
von 1536 sieht man als Schlußstein im Gewölbe des Wendelsteines, wo sich auch zwei weibliche Porträts seiner Fa-
milie befinden. Hierbei ist zu beachten, daß dieses Porträtmedaillon 9 Jahre früher angebracht ist als die Standbilder
des Kurfürsten und seines Bruders, die erst 1545 aufgestellt sind. Des Baumeisters Zeichen C. K. kommt außerdem
an verschiedener: Stellen des Baus vor. Auf seinem Grabmale vor: 1540, das am Mittelflügel des Schlosses air-
gebracht ist, steht er in lebensgroßer Figur mit seinem Familienwappen (Abb. 16). Die Stellung, die das bürger-
liche Wappen am Schlosse einnimmt, ist bezeichnend für bürgerliches Selbstbewußtseiu, eberrso wie für fürstliche
Anerkennung bürgerlicher Leistungen. In gleicher Weise sehen wir Luthers Porträt im Kreise der kurfürstlichen Fa-
milie. Es zeigt sich hierirr die Nachwirkung der Spätgotik.
Aber auch die ganze Wapperrkunst, die Heraldik nrit ihrer strengen Stilisierung gehört eigentlich dem Mittelalter
arr und hat ihre Blüte in der Spätgotik. Sie erfreut sich zwar in der deutschen Renaissance noch großer Beliebtheit,
doch tritt das ornamentale Beiwerk mehr in der: Vordergrund, bis schließlich im Barock das Wappen hauptsächlich
Dekorationsmotiv ist.
Für Unterstützung bei Feststellung der Wappen bin ich Herrn Oberbaurat Schmid-Marienburg, Herrn Ritt-
meister a. D. v. Bomhard-Ubigau mrd Herrn Oberregierungsrat Di-. Gritzuer-Dresdeu zu Dank verpflichtet.
Die Photographien gehören dem Denkmalsarchiv des Herrn Konservator in Halle.
Vom Rheknpfälzer Weinbaugebiet und seinen Burgen.
Von F. von Bassermann-Zordan, Geheimer Rat, Deidesheim.
?er deutsche Weinbau nimmt heutzutage fast ausschließlich Flußtäler ein, während er in der Zeit seiner
^ größten Ausdehnung um 1500 alle möglichen Gebiete bedeckte.
In den meisten Fällen bieten die Flußläufe Anhöhen an ihren Ufern, welche die Weinberge tragen,
! und diese Höhen sind gewöhnlich seit uralter Zeit auch von Burgen besetzt. So spiegeln sich die Ruinen,
I oder vereinzelt auch hergestellte Burgen, in den Flußtälern an den Weinbergen des Kaiserstuhls irr
Baden, des Neckar in Württemberg, des Main in Franken, der Saale, der Unstrut (Freyburg), der Elbe (Meißen),
der Mosel (Cochem usw.), der Saar (Saarburg), des Rheingau (Ehrenfels u. a.), des Mittelrhein, hier wohl in größter
Zahl, vereinzelt auch in Rheinhessen (Oppenheim); an der Bergstraße dagegen (Weinheim u. a.), im Baderrerland,
abgesehen vom Kaiserstuhl, und in der Pfalz ist das Flußufer so flach, daß sowohl die Burgen wie der Weinbau sich
vom Rheinufer, wo zwar ehedem römische Festungen und römischer Weinbau bestanden, ans die entfernteren Höhen
zurückgezogen haben.
Noch zeigt die Rheinpfalz am Rheinufer Überreste des römischen ebenen Weinbaus, der der Rheinstraße gefolgt
war und der bis ins hohe Mittelalter hinaus nach Klosterurkunden airdauerte, so bei Lingerrfeld, Mechtersheim,
Heiligenstein unweit Speyer und bei Speyer selbst, dagegen sind alle Reste von Weinbau weiterhin an der alten
Römerstraße bis nach Worms verschwunden.
Die Umgebung der Bergstraße, die von Straßburg über Zabern, Weißenburg, Bergzabern, Neustadt a. H.,
Deidesheim, Alzey, Bingen führte, hatte sich ebenso früh in Römerzeit mit Weinbergen bedeckt, römische Anlagen
kamen auch dort innerhalb des Weinbaugebiets immer wieder zutage (Godramstein, Neustadt, Gimmeldingen, Rup-
pertsberg, Dürkheim nsw.); nicht der Bergabhang oder die Ebene tragen dort die besten Weinberge, sondern die
Vorhügel, die nach Süden hängend die edelsten Weine weltbekannter Marken hervorbringen, wie Deidesheimer
Grairrhübel, Kieselberg, Hohennrorgen, Leinhöhle, Förster Kirchenstück, Jesuitengarten, Ungeheuer, Ruppertsberger
Hoheburg, Reiterpfad, Hofstück, Wachenheimer Gerümpel, Bächel, Dürkheimer Michelsberg, Spielberg, Königsbacher
Jdig nsw.
Und wenig oberhalb dieser edelsten Weinhügel erhoben sich im Mittelalter die Bürger:, deren Trümmer nur
noch in die Rheinebene herabsehen bei einem Abstand von ungefähr 25—30 Kilometer vom Rheinstrom. Eine noch
größere Menge Schlösser lag innerhalb der einzelnen Reborte. Dazu gesellen sich eine stattliche Anzahl von Klöstern,
teils aus Burgen hervorgegangerr, wie manchmal noch der Name Brirg bezeugt. Eine fleißige Arbeit: W. Schoch,
„Magdalena Sibylla, Herzogin von Sachsen, Gülich, Cleve und Berg, Churfürstin, geborene Markgräfin zu Branden-
burg". Beim dritten Buchstaben 1 statt II ist wohl ein Irrtum unterlaufen; Jülich ist mit „O" geschrieben und „V"
gleich „II" gesetzt. Das Wappen ist also das brandenburgische gewesen. Der rechte, ovale Schild zeigt 4 Felder: das
Wappen des Herzogtums Sachsen, den schwarzen Löwen von Meißen, die goldene Lilienhaspel von Cleve und den
roten Löwen von Berg. Die Unterschrift enthält 10 Buchstaben: „1. O. II. 2. 8. O. L. V. H. 6.", die Abkürzung für
„Johann Georg, Herzog zu Sachsen, Gülich, Cleve und Berg, Churfürst".
Mitten unter diesen Fürstenwappen steht das bürgerliche Wappen des Conrad Krebs: Der Krebs in glattem
Felde. Die Farben sind nicht mehr feststellbar; vielleicht Rot in Weiß. Es ist nicht im Verborgenen, sondern an be-
vorzugter Stelle angebracht: Am Pfeiler der Vorderseite des Großen Wendelsteines und in einer Brüstungsplatte
der offenen Loggia am Wächterturm, wo der Meister selbst den Schild hält. Sein großes Porträtmedaillon
von 1536 sieht man als Schlußstein im Gewölbe des Wendelsteines, wo sich auch zwei weibliche Porträts seiner Fa-
milie befinden. Hierbei ist zu beachten, daß dieses Porträtmedaillon 9 Jahre früher angebracht ist als die Standbilder
des Kurfürsten und seines Bruders, die erst 1545 aufgestellt sind. Des Baumeisters Zeichen C. K. kommt außerdem
an verschiedener: Stellen des Baus vor. Auf seinem Grabmale vor: 1540, das am Mittelflügel des Schlosses air-
gebracht ist, steht er in lebensgroßer Figur mit seinem Familienwappen (Abb. 16). Die Stellung, die das bürger-
liche Wappen am Schlosse einnimmt, ist bezeichnend für bürgerliches Selbstbewußtseiu, eberrso wie für fürstliche
Anerkennung bürgerlicher Leistungen. In gleicher Weise sehen wir Luthers Porträt im Kreise der kurfürstlichen Fa-
milie. Es zeigt sich hierirr die Nachwirkung der Spätgotik.
Aber auch die ganze Wapperrkunst, die Heraldik nrit ihrer strengen Stilisierung gehört eigentlich dem Mittelalter
arr und hat ihre Blüte in der Spätgotik. Sie erfreut sich zwar in der deutschen Renaissance noch großer Beliebtheit,
doch tritt das ornamentale Beiwerk mehr in der: Vordergrund, bis schließlich im Barock das Wappen hauptsächlich
Dekorationsmotiv ist.
Für Unterstützung bei Feststellung der Wappen bin ich Herrn Oberbaurat Schmid-Marienburg, Herrn Ritt-
meister a. D. v. Bomhard-Ubigau mrd Herrn Oberregierungsrat Di-. Gritzuer-Dresdeu zu Dank verpflichtet.
Die Photographien gehören dem Denkmalsarchiv des Herrn Konservator in Halle.
Vom Rheknpfälzer Weinbaugebiet und seinen Burgen.
Von F. von Bassermann-Zordan, Geheimer Rat, Deidesheim.
?er deutsche Weinbau nimmt heutzutage fast ausschließlich Flußtäler ein, während er in der Zeit seiner
^ größten Ausdehnung um 1500 alle möglichen Gebiete bedeckte.
In den meisten Fällen bieten die Flußläufe Anhöhen an ihren Ufern, welche die Weinberge tragen,
! und diese Höhen sind gewöhnlich seit uralter Zeit auch von Burgen besetzt. So spiegeln sich die Ruinen,
I oder vereinzelt auch hergestellte Burgen, in den Flußtälern an den Weinbergen des Kaiserstuhls irr
Baden, des Neckar in Württemberg, des Main in Franken, der Saale, der Unstrut (Freyburg), der Elbe (Meißen),
der Mosel (Cochem usw.), der Saar (Saarburg), des Rheingau (Ehrenfels u. a.), des Mittelrhein, hier wohl in größter
Zahl, vereinzelt auch in Rheinhessen (Oppenheim); an der Bergstraße dagegen (Weinheim u. a.), im Baderrerland,
abgesehen vom Kaiserstuhl, und in der Pfalz ist das Flußufer so flach, daß sowohl die Burgen wie der Weinbau sich
vom Rheinufer, wo zwar ehedem römische Festungen und römischer Weinbau bestanden, ans die entfernteren Höhen
zurückgezogen haben.
Noch zeigt die Rheinpfalz am Rheinufer Überreste des römischen ebenen Weinbaus, der der Rheinstraße gefolgt
war und der bis ins hohe Mittelalter hinaus nach Klosterurkunden airdauerte, so bei Lingerrfeld, Mechtersheim,
Heiligenstein unweit Speyer und bei Speyer selbst, dagegen sind alle Reste von Weinbau weiterhin an der alten
Römerstraße bis nach Worms verschwunden.
Die Umgebung der Bergstraße, die von Straßburg über Zabern, Weißenburg, Bergzabern, Neustadt a. H.,
Deidesheim, Alzey, Bingen führte, hatte sich ebenso früh in Römerzeit mit Weinbergen bedeckt, römische Anlagen
kamen auch dort innerhalb des Weinbaugebiets immer wieder zutage (Godramstein, Neustadt, Gimmeldingen, Rup-
pertsberg, Dürkheim nsw.); nicht der Bergabhang oder die Ebene tragen dort die besten Weinberge, sondern die
Vorhügel, die nach Süden hängend die edelsten Weine weltbekannter Marken hervorbringen, wie Deidesheimer
Grairrhübel, Kieselberg, Hohennrorgen, Leinhöhle, Förster Kirchenstück, Jesuitengarten, Ungeheuer, Ruppertsberger
Hoheburg, Reiterpfad, Hofstück, Wachenheimer Gerümpel, Bächel, Dürkheimer Michelsberg, Spielberg, Königsbacher
Jdig nsw.
Und wenig oberhalb dieser edelsten Weinhügel erhoben sich im Mittelalter die Bürger:, deren Trümmer nur
noch in die Rheinebene herabsehen bei einem Abstand von ungefähr 25—30 Kilometer vom Rheinstrom. Eine noch
größere Menge Schlösser lag innerhalb der einzelnen Reborte. Dazu gesellen sich eine stattliche Anzahl von Klöstern,
teils aus Burgen hervorgegangerr, wie manchmal noch der Name Brirg bezeugt. Eine fleißige Arbeit: W. Schoch,