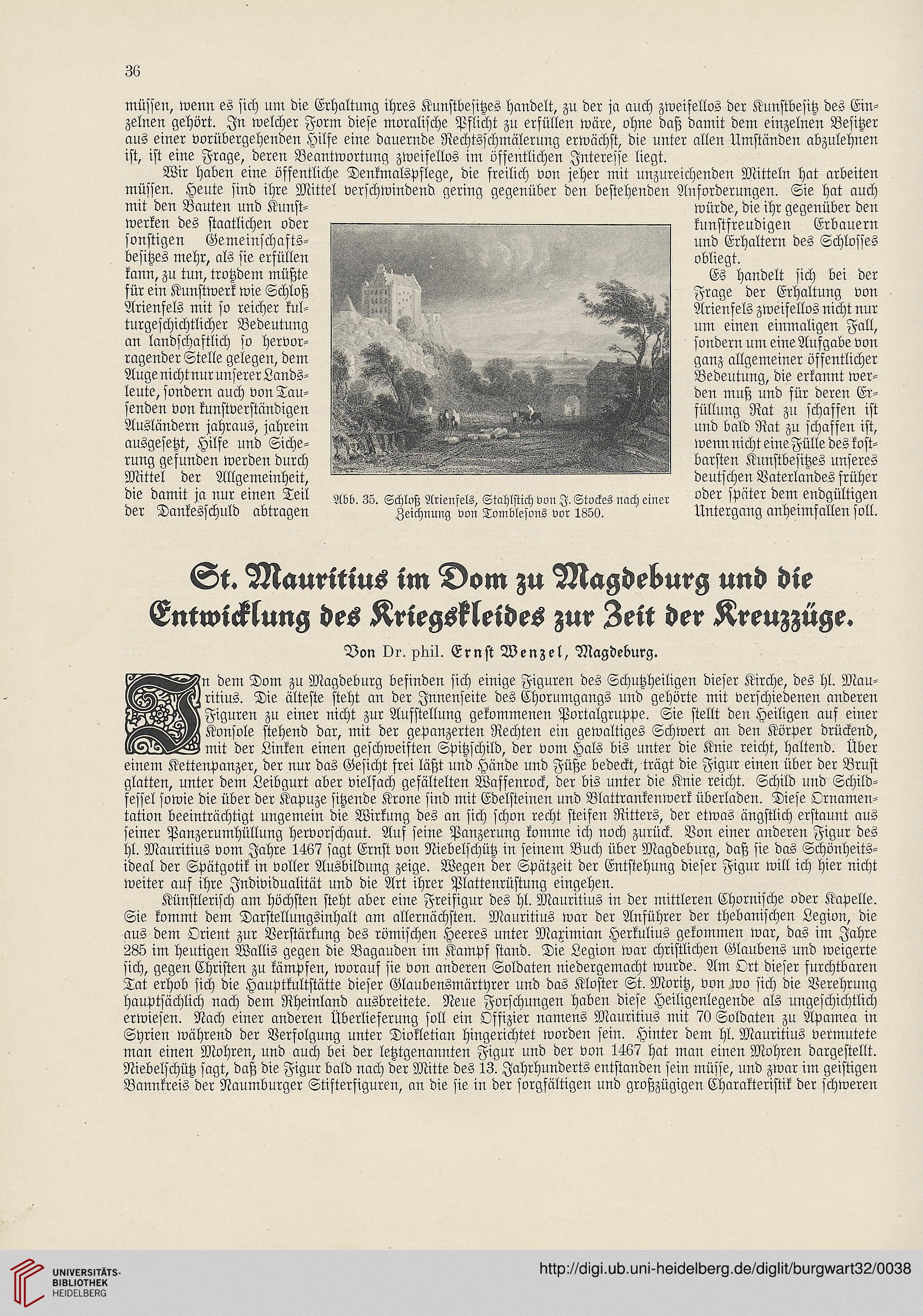36
müssen, wenn es sich um die Erhaltung ihres Kunstbesitzes handelt, zu der ja auch zweifellos der Kunstbesitz des Ein-
zelnen gehört. In welcher Form diese moralische Pflicht zu erfüllen wäre, ohne daß damit dem einzelnen Besitzer
aus einer vorübergehenden Hilfe eine dauernde Rechtsschmälerung erwächst, die unter allen Umständen abznlehnen
ist, ist eine Frage, deren Beantwortung zweifellos im öffentlichen Interesse liegt.
Wir haben eine öffentliche Denkmalspflege, die freilich von jeher mit unzureichenden Mitteln hat arbeiten
müssen. Heute sind ihre Mittel verschwindend gering gegenüber den bestehenden Anforderungen. Sie hat auch
mit den Bauten und Kunst-
werken des staatlichen oder
sonstigen Gemeinschafts-
besitzes mehr, als sie erfüllen
kann, zu tun, trotzdem müßte
für ein Kunstwerk wie Schloß
Arienfels mit so reicher kul-
turgeschichtlicher Bedeutung
an landschaftlich so hervor-
ragender Stelle gelegen, dem
Auge nichtnur unserer Lands-
leute, sondern auch von Tau-
senden von kunstverständigen
Ausländern jahraus, jahrein
ausgesetzt, Hilfe und Siche-
rung gefunden werden durch
Mittel der Allgemeinheit,
die damit ja nur einen Teil
der Dankesschuld abtragen
Abb. 35. Schloß Arienfels, Stahlstich von I. Stockes nach einer
Zeichnung von Tomblesons vor 1850.
würde, die ihr gegenüber den
kunstfreudigen Erbauern
und Erhaltern des Schlosses
obliegt.
Es handelt sich bei der
Frage der Erhaltung von
Arienfels zweifellos nicht nur
um einen einmaligen Fall,
sondern um eine Aufgabe von
ganz allgemeiner öffentlicher
Bedeutung, die erkannt wer-
den muß und für deren Er-
füllung Rat zu schaffen ist
und bald Rat zu schaffen ist,
wenn nicht eine Fülle des kost-
barsten Kunstbesitzes unseres
deutschen Vaterlandes früher
oder später dem endgültigen
Untergang anheimfallen soll.
St. Mauritius im Dom zu Magdeburg und die
Entwicklung des KriegskletdeS zur Zeit der Kreuzzüge.
Von vr. piril. Ernst Wenzel, Magdeburg.
!n dem Dom zu Magdeburg befinden sich einige Figuren des Schutzheiligen dieser Kirche, des hl. Mau-
ritius. Die älteste steht an der Innenseite des Chorumgangs und gehörte mit verschiedenen anderen
. Figuren zu einer nicht zur Aufstellung gekommenen Portalgruppe. Sie stellt den Heiligen auf einer
Konsole stehend dar, mit der gepanzerten Rechten ein gewaltiges Schwert an den Körper drückend,
! mit der Linken einen geschweiften Spitzschild, der vom Hals bis unter die Knie reicht, haltend. Uber
einem Kettenpanzer, der nur das Gesicht frei läßt und Hände und Füße bedeckt, trägt die Figur einen über der Brust
glatten, unter dem Leibgurt aber vielfach gefältelten Waffenrock, der bis unter die Knie reicht. Schild und Schild-
fessel sowie die über der Kapuze sitzende Krone sind mit Edelsteinen und Blattrankenwerk überladen. Diese Ornamen-
tation beeinträchtigt ungemein die Wirkung des an sich schon recht steifen Ritters, der etwas ängstlich erstaunt aus
seiner Panzerumhüllung hervorschaut. Auf seine Panzerung komme ich noch zurück. Bon einer anderen Figur des
hl. Mauritius vom Jahre 1467 sagt Ernst von Niebelschütz in seinem Buch über Magdeburg, daß sie das Schönheits-
ideal der Spätgotik in voller Ausbildung zeige. Wegen der Spätzeit der Entstehung dieser Figur will ich hier nicht
weiter auf ihre Individualität und die Art ihrer Plattenrüstung eingehen.
Künstlerisch am höchsten steht aber eine Freifigur des hl. Mauritius in der mittleren Chornische oder Kapelle.
Sie kommt dem Darstellungsinhalt am allernächsten. Mauritius war der Anführer der thebanischen Legion, die
aus dem Orient zur Verstärkung des römischen Heeres unter Maximian Herkulius gekommen war, das im Jahre
285 im heutigen Wallis gegen die Bagauden im Kampf stand. Die Legion war christlichen Glaubens und weigerte
sich, gegen Christen zu kämpfen, worauf sie von anderen Soldaten niedergemacht wurde. Am Ort dieser furchtbaren
Tat erhob sich die Hauptkultstätte dieser Glaubensmärtyrer und das Kloster St. Moritz, von wo sich die Verehrung
hauptsächlich nach dem Rheinland ausbreitete. Neue Forschungen haben diese Heiligenlegende als ungeschichtlich
erwiesen. Nach einer anderen Überlieferung soll ein Offizier namens Mauritius mit 70 Soldaten zu Apamea in
Syrien während der Verfolgung unter Diokletian hingerichtet worden sein. Hinter dem hl. Mauritius vermutete
man einen Mohren, und auch bei der letztgenannten Figur und der von 1467 hat man einen Mohren dargestellt.
Niebelschütz sagt, daß die Figur bald nach der Mitte des 13. Jahrhunderts entstanden sein müsse, und zwar im geisügen
Bannkreis der Naumburger Stifterfiguren, an die sie in der sorgfältigen und großzügigen Charakteristik der schweren
müssen, wenn es sich um die Erhaltung ihres Kunstbesitzes handelt, zu der ja auch zweifellos der Kunstbesitz des Ein-
zelnen gehört. In welcher Form diese moralische Pflicht zu erfüllen wäre, ohne daß damit dem einzelnen Besitzer
aus einer vorübergehenden Hilfe eine dauernde Rechtsschmälerung erwächst, die unter allen Umständen abznlehnen
ist, ist eine Frage, deren Beantwortung zweifellos im öffentlichen Interesse liegt.
Wir haben eine öffentliche Denkmalspflege, die freilich von jeher mit unzureichenden Mitteln hat arbeiten
müssen. Heute sind ihre Mittel verschwindend gering gegenüber den bestehenden Anforderungen. Sie hat auch
mit den Bauten und Kunst-
werken des staatlichen oder
sonstigen Gemeinschafts-
besitzes mehr, als sie erfüllen
kann, zu tun, trotzdem müßte
für ein Kunstwerk wie Schloß
Arienfels mit so reicher kul-
turgeschichtlicher Bedeutung
an landschaftlich so hervor-
ragender Stelle gelegen, dem
Auge nichtnur unserer Lands-
leute, sondern auch von Tau-
senden von kunstverständigen
Ausländern jahraus, jahrein
ausgesetzt, Hilfe und Siche-
rung gefunden werden durch
Mittel der Allgemeinheit,
die damit ja nur einen Teil
der Dankesschuld abtragen
Abb. 35. Schloß Arienfels, Stahlstich von I. Stockes nach einer
Zeichnung von Tomblesons vor 1850.
würde, die ihr gegenüber den
kunstfreudigen Erbauern
und Erhaltern des Schlosses
obliegt.
Es handelt sich bei der
Frage der Erhaltung von
Arienfels zweifellos nicht nur
um einen einmaligen Fall,
sondern um eine Aufgabe von
ganz allgemeiner öffentlicher
Bedeutung, die erkannt wer-
den muß und für deren Er-
füllung Rat zu schaffen ist
und bald Rat zu schaffen ist,
wenn nicht eine Fülle des kost-
barsten Kunstbesitzes unseres
deutschen Vaterlandes früher
oder später dem endgültigen
Untergang anheimfallen soll.
St. Mauritius im Dom zu Magdeburg und die
Entwicklung des KriegskletdeS zur Zeit der Kreuzzüge.
Von vr. piril. Ernst Wenzel, Magdeburg.
!n dem Dom zu Magdeburg befinden sich einige Figuren des Schutzheiligen dieser Kirche, des hl. Mau-
ritius. Die älteste steht an der Innenseite des Chorumgangs und gehörte mit verschiedenen anderen
. Figuren zu einer nicht zur Aufstellung gekommenen Portalgruppe. Sie stellt den Heiligen auf einer
Konsole stehend dar, mit der gepanzerten Rechten ein gewaltiges Schwert an den Körper drückend,
! mit der Linken einen geschweiften Spitzschild, der vom Hals bis unter die Knie reicht, haltend. Uber
einem Kettenpanzer, der nur das Gesicht frei läßt und Hände und Füße bedeckt, trägt die Figur einen über der Brust
glatten, unter dem Leibgurt aber vielfach gefältelten Waffenrock, der bis unter die Knie reicht. Schild und Schild-
fessel sowie die über der Kapuze sitzende Krone sind mit Edelsteinen und Blattrankenwerk überladen. Diese Ornamen-
tation beeinträchtigt ungemein die Wirkung des an sich schon recht steifen Ritters, der etwas ängstlich erstaunt aus
seiner Panzerumhüllung hervorschaut. Auf seine Panzerung komme ich noch zurück. Bon einer anderen Figur des
hl. Mauritius vom Jahre 1467 sagt Ernst von Niebelschütz in seinem Buch über Magdeburg, daß sie das Schönheits-
ideal der Spätgotik in voller Ausbildung zeige. Wegen der Spätzeit der Entstehung dieser Figur will ich hier nicht
weiter auf ihre Individualität und die Art ihrer Plattenrüstung eingehen.
Künstlerisch am höchsten steht aber eine Freifigur des hl. Mauritius in der mittleren Chornische oder Kapelle.
Sie kommt dem Darstellungsinhalt am allernächsten. Mauritius war der Anführer der thebanischen Legion, die
aus dem Orient zur Verstärkung des römischen Heeres unter Maximian Herkulius gekommen war, das im Jahre
285 im heutigen Wallis gegen die Bagauden im Kampf stand. Die Legion war christlichen Glaubens und weigerte
sich, gegen Christen zu kämpfen, worauf sie von anderen Soldaten niedergemacht wurde. Am Ort dieser furchtbaren
Tat erhob sich die Hauptkultstätte dieser Glaubensmärtyrer und das Kloster St. Moritz, von wo sich die Verehrung
hauptsächlich nach dem Rheinland ausbreitete. Neue Forschungen haben diese Heiligenlegende als ungeschichtlich
erwiesen. Nach einer anderen Überlieferung soll ein Offizier namens Mauritius mit 70 Soldaten zu Apamea in
Syrien während der Verfolgung unter Diokletian hingerichtet worden sein. Hinter dem hl. Mauritius vermutete
man einen Mohren, und auch bei der letztgenannten Figur und der von 1467 hat man einen Mohren dargestellt.
Niebelschütz sagt, daß die Figur bald nach der Mitte des 13. Jahrhunderts entstanden sein müsse, und zwar im geisügen
Bannkreis der Naumburger Stifterfiguren, an die sie in der sorgfältigen und großzügigen Charakteristik der schweren