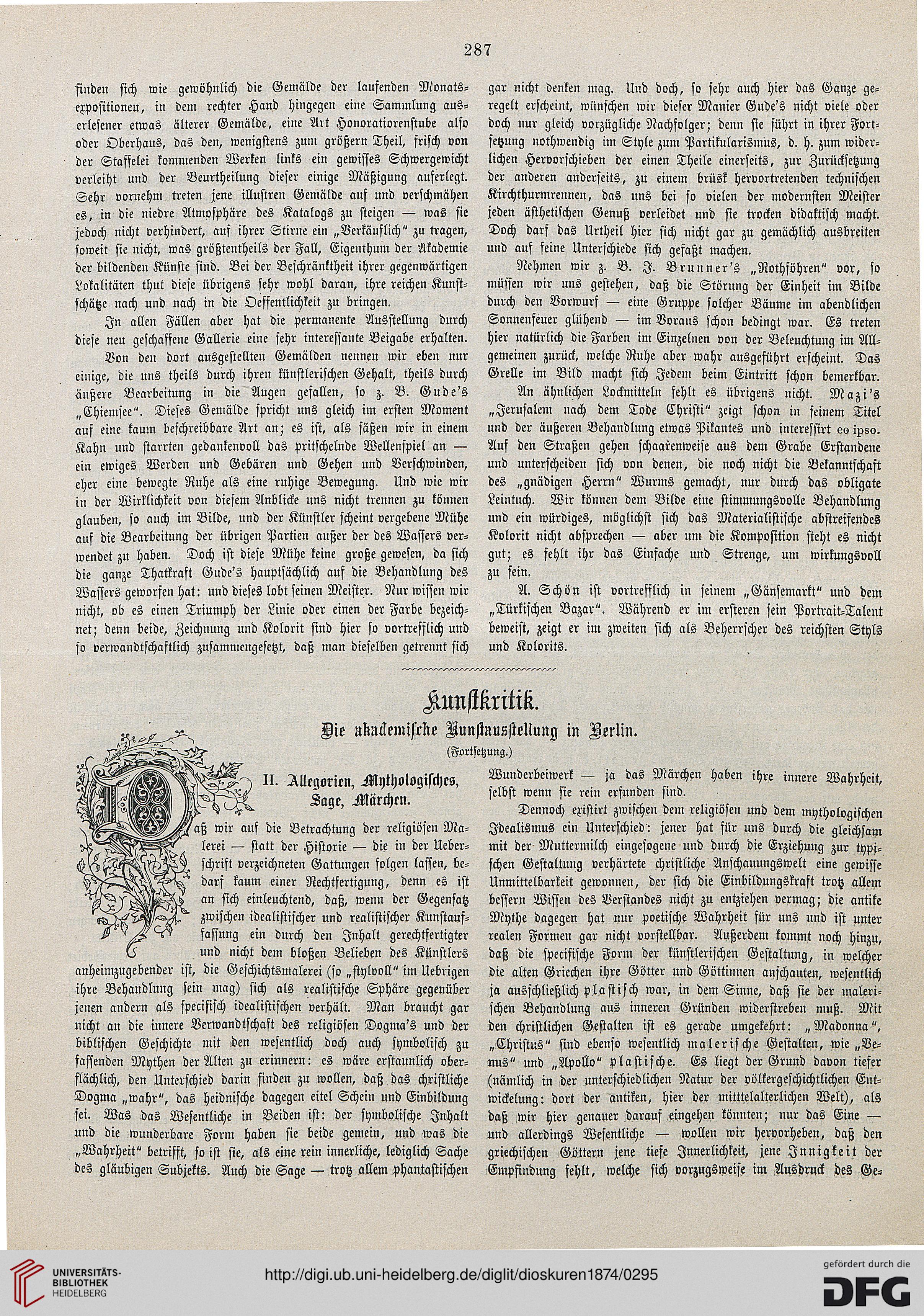287
finde» sich wie gewöhnlich die Gemälde der laufenden Monats-
expositioneu, in dem rechter Hand hingegen eine Sammlung aus-
erlesener etwas älterer Gemälde, eine Art Honoratiorenstube also
oder Oberhaus, das den, wenigstens zum größern Theil, frisch von
der Staffelei komnienden Werken links ein gewisses Schwergewicht
verleiht und der Beurtheilnng dieser einige Mäßigung auferlegt.
Sehr vornehm treten jene illustren Gemälde auf und verschmähen
es, in die niedre Atmosphäre des Katalogs zu steigen — was sie
jedoch nicht verhindert, auf ihrer Stirne ein „Verkäuflich" zu tragen,
soweit sie nicht, was größtentheils der Fall, Eigenthum der Akademie
der bildenden Künste sind. Bei der Beschränktheit ihrer gegenwärtigen
Lokalitäten thut diese übrigens sehr wohl daran, ihre reichen Kunst-
schätze nach und nach in die Oeffentlichkeit zu bringen.
In allen Fällen aber hat die permanente Ausstellung durch
diese neu geschaffene Gallerie eine sehr interessante Beigabe erhalten.
Von den dort ausgestellten Gemälden nennen wir eben nur
einige, die uns theils durch ihren künstlerischen Gehalt, theils durch
äußere Bearbeitung in die Augen gefallen, so z. B. Gude's
„Chiemsee". Dieses Gemälde spricht uns gleich im ersten Moment
auf eine kaum beschreibbare Art an; es ist, als säßen wir in einem
Kahn und starrten gedankenvoll das pritschelnde Wellenspiel an —
et« ewiges Werden und Gebären und Gehen und Verschwinden,
eher eine bewegte Ruhe als eine ruhige Bewegung. Und wie wir
in der Wirklichkeit von diesem Anblicke uns nicht trennen zu können
glauben, so auch im Bilde, und der Künstler scheint vergebene Mühe
auf die Bearbeitung der übrigen Partien außer der des Wassers ver-
wendet zu haben. Doch ist diese Mühe keine große gewesen, da sich
die ganze Thatkraft Gude's hauptsächlich auf die Behandlung des
Wassers geworfen hat: und dieses lobt seinen Meister. Nur wissen wir
nicht, ob es einen Triumph der Linie oder einen der Farbe bezeich-
net; denn beide, Zeichnung und Kolorit sind hier so vortrefflich und
so verwandtschaftlich zusammengesetzt, daß man dieselben getrennt sich
gar nicht denken mag. Und doch, so sehr auch hier das Ganze ge-
regelt erscheint, wünschen wir dieser Manier Gude's nicht viele oder
doch nur gleich vorzügliche Nachfolger; denn sie führt in ihrer Fort-
setzung nothwendig im Style zum Partikularismüs, d. h. zum wider-
lichen Hervorschieben der einen Theile einerseits, zur Zurücksetzung
der anderen anderseits, zu einem brüsk hervortretenden technischen
Kirchthurmrennen, das uns bei so vielen der modernsten Meister
jeden ästhetischen Genuß verleidet und sie trocken didaktisch macht.
Doch darf das Urtheil hier sich nicht gar zu gemächlich ausbreiten
und auf feine Unterschiede sich gefaßt machen.
Nehmen wir z. B. I. Brunner's „Rothföhren" vor, so
müsien wir uns gestehen, daß die Störung der Einheit im Bilde
durch den Vorwurf — eine Gruppe solcher Bäume im abendlichen
Sonnenfeuer glühend — im Voraus schon bedingt war. Es treten
hier natürlich die Farben im Einzelnen von der Beleuchtung im All-
gemeinen zurück, welche Ruhe aber wahr ausgeführt erscheint. Das
Grelle im Bild macht sich Jedein beim Eintritt schon bemerkbar.
An ähnlichen Lockmitteln fehlt es übrigens nicht. Mazi's
„Jerusalem nach dem Tode Christi" zeigt schon in seinem Titel
und der äußeren Behandlung etwas Pikantes und interessirt so ipso.
Auf den Straßen gehen schaarenweife aus dem Grabe Erstandene
und unterscheiden sich von denen, die noch nicht die Bekanntschaft
des „gnädigen Herrn" Wurms gemacht, nur durch das obligate
Leintuch. Wir können dem Bilde eine stimmungsvolle Behandlung
und ein würdiges, möglichst sich das Materialistische abstreifendes
Kolorit nicht absprechen — aber um die Komposition steht es nicht
gut; es fehlt ihr das Einfache und Strenge, um wirkungsvoll
zu sein.
A. Schön ist vortrefflich in seinem „Gänsemarkt" und dem
„Türkischen Bazar". Während er im ersteren sein Portrait-Talent
beweist, zeigt er im zweiten sich als Beherrscher des reichsten Styls
und Kolorits.
Kunstkritik.
Die llkittlemMle Bunstnuk-stellung in Berlin.
(Fortsetzung.)
II. (Allegorien, Mythologisches,
Zage, Märchen.
taß wir auf die Betrachtung der religiösen Ma-
lerei — statt der Historie — die in der Ueber-
schrift verzeichneten Gattungen folgen lassen, be-
darf kaum einer Rechtfertigung, denn es ist
an sich einleuchtend, daß, wenn der Gegensatz
zwischen idealistischer und realistischer Kunstauf-
fassung ein durch den Inhalt gerechtfertigter
und nicht dem bloßen Belieben des Künstlers
anheimzugebender ist, die Geschichtsmalerei (so „stylvoll" im klebrigen
ihre Behandlung sein mag) sich als realistische Sphäre gegenüber
jenen andern als specisisch idealistischen verhält. Man braucht gar
nicht an die innere Verwandtschaft des religiösen Dogma's und der
biblischen Geschichte mit den wesentlich doch auch syntbolisch zu
fassenden Mythen der Alten zu erinnern: es wäre erstaunlich ober-
flächlich, den Unterschied darin finden zu wollen, daß das christliche
Dogma „wahr", das heidnische dagegen eitel Schein und Einbildung
sei. Was das Wesentliche in Beiden ist: der symbolische Inhalt
und die wunderbare Form haben sie beide gemein, und was die
„Wahrheit" betrifft, so ist sie, als eine rein innerliche, lediglich Sache
des gläubigen Subjekts. Auch die Sage — trotz allem phantastischen
Wunderbeiwerk — ja das Märchen haben ihre innere Wahrheit,
selbst wenn sie rein erfunden sind.
Dennoch existirt zwischen dein religiösen und dem mythologischen
Idealismus ein Unterschied : jener hat für uns durch die gleichsam
mit der Muttermilch eingesogene und durch die Erziehung zur typi-
schen Gestaltung verhärtete christliche Anschauungswelt eine gewisse
Unmittelbarkeit gewonnen, der sich die Einbildungskraft trotz allem
bessern Wissen des Verstandes nicht zu entziehen vermag; die antike
Mythe dagegen hat nur poetische Wahrheit für uns und ist unter
realen Formen gar nicht vorstellbar. Außerdem kommt noch hinzu,
daß die specifische Form der künstlerischen Gestaltung, in welcher
die alten Griechen ihre Götter und Göttinnen anschauten, wesentlich
ja ausschließlich plastisch war, in dem Sinne, daß sie der maleri-
schen Behandlung aus inneren Gründen widerstreben muß. Mit
den christlichen Gestalten ist es gerade umgekehrt: „ Madonna",
„Christus" sind ebenso wesentlich malerische Gestalten, wie „Ve-
nns" und „Apollo" plastische. Es liegt der Grund davon tiefer
(nämlich in der unterschiedlichen Natur der völkergeschichtlichen Ent-
wickelung: dort der antiken, hier der mitttelalterlichen Welt), als
daß wir hier genauer darauf cingehen könnten; nur das Eine —
und allerdings Wesentliche — wollen wir hervorheben, daß den
griechischen Göttern jene tiefe Innerlichkeit, jene Innigkeit der
Empfindung fehlt, welche sich vorzugsweise im Ausdruck des Ge-
finde» sich wie gewöhnlich die Gemälde der laufenden Monats-
expositioneu, in dem rechter Hand hingegen eine Sammlung aus-
erlesener etwas älterer Gemälde, eine Art Honoratiorenstube also
oder Oberhaus, das den, wenigstens zum größern Theil, frisch von
der Staffelei komnienden Werken links ein gewisses Schwergewicht
verleiht und der Beurtheilnng dieser einige Mäßigung auferlegt.
Sehr vornehm treten jene illustren Gemälde auf und verschmähen
es, in die niedre Atmosphäre des Katalogs zu steigen — was sie
jedoch nicht verhindert, auf ihrer Stirne ein „Verkäuflich" zu tragen,
soweit sie nicht, was größtentheils der Fall, Eigenthum der Akademie
der bildenden Künste sind. Bei der Beschränktheit ihrer gegenwärtigen
Lokalitäten thut diese übrigens sehr wohl daran, ihre reichen Kunst-
schätze nach und nach in die Oeffentlichkeit zu bringen.
In allen Fällen aber hat die permanente Ausstellung durch
diese neu geschaffene Gallerie eine sehr interessante Beigabe erhalten.
Von den dort ausgestellten Gemälden nennen wir eben nur
einige, die uns theils durch ihren künstlerischen Gehalt, theils durch
äußere Bearbeitung in die Augen gefallen, so z. B. Gude's
„Chiemsee". Dieses Gemälde spricht uns gleich im ersten Moment
auf eine kaum beschreibbare Art an; es ist, als säßen wir in einem
Kahn und starrten gedankenvoll das pritschelnde Wellenspiel an —
et« ewiges Werden und Gebären und Gehen und Verschwinden,
eher eine bewegte Ruhe als eine ruhige Bewegung. Und wie wir
in der Wirklichkeit von diesem Anblicke uns nicht trennen zu können
glauben, so auch im Bilde, und der Künstler scheint vergebene Mühe
auf die Bearbeitung der übrigen Partien außer der des Wassers ver-
wendet zu haben. Doch ist diese Mühe keine große gewesen, da sich
die ganze Thatkraft Gude's hauptsächlich auf die Behandlung des
Wassers geworfen hat: und dieses lobt seinen Meister. Nur wissen wir
nicht, ob es einen Triumph der Linie oder einen der Farbe bezeich-
net; denn beide, Zeichnung und Kolorit sind hier so vortrefflich und
so verwandtschaftlich zusammengesetzt, daß man dieselben getrennt sich
gar nicht denken mag. Und doch, so sehr auch hier das Ganze ge-
regelt erscheint, wünschen wir dieser Manier Gude's nicht viele oder
doch nur gleich vorzügliche Nachfolger; denn sie führt in ihrer Fort-
setzung nothwendig im Style zum Partikularismüs, d. h. zum wider-
lichen Hervorschieben der einen Theile einerseits, zur Zurücksetzung
der anderen anderseits, zu einem brüsk hervortretenden technischen
Kirchthurmrennen, das uns bei so vielen der modernsten Meister
jeden ästhetischen Genuß verleidet und sie trocken didaktisch macht.
Doch darf das Urtheil hier sich nicht gar zu gemächlich ausbreiten
und auf feine Unterschiede sich gefaßt machen.
Nehmen wir z. B. I. Brunner's „Rothföhren" vor, so
müsien wir uns gestehen, daß die Störung der Einheit im Bilde
durch den Vorwurf — eine Gruppe solcher Bäume im abendlichen
Sonnenfeuer glühend — im Voraus schon bedingt war. Es treten
hier natürlich die Farben im Einzelnen von der Beleuchtung im All-
gemeinen zurück, welche Ruhe aber wahr ausgeführt erscheint. Das
Grelle im Bild macht sich Jedein beim Eintritt schon bemerkbar.
An ähnlichen Lockmitteln fehlt es übrigens nicht. Mazi's
„Jerusalem nach dem Tode Christi" zeigt schon in seinem Titel
und der äußeren Behandlung etwas Pikantes und interessirt so ipso.
Auf den Straßen gehen schaarenweife aus dem Grabe Erstandene
und unterscheiden sich von denen, die noch nicht die Bekanntschaft
des „gnädigen Herrn" Wurms gemacht, nur durch das obligate
Leintuch. Wir können dem Bilde eine stimmungsvolle Behandlung
und ein würdiges, möglichst sich das Materialistische abstreifendes
Kolorit nicht absprechen — aber um die Komposition steht es nicht
gut; es fehlt ihr das Einfache und Strenge, um wirkungsvoll
zu sein.
A. Schön ist vortrefflich in seinem „Gänsemarkt" und dem
„Türkischen Bazar". Während er im ersteren sein Portrait-Talent
beweist, zeigt er im zweiten sich als Beherrscher des reichsten Styls
und Kolorits.
Kunstkritik.
Die llkittlemMle Bunstnuk-stellung in Berlin.
(Fortsetzung.)
II. (Allegorien, Mythologisches,
Zage, Märchen.
taß wir auf die Betrachtung der religiösen Ma-
lerei — statt der Historie — die in der Ueber-
schrift verzeichneten Gattungen folgen lassen, be-
darf kaum einer Rechtfertigung, denn es ist
an sich einleuchtend, daß, wenn der Gegensatz
zwischen idealistischer und realistischer Kunstauf-
fassung ein durch den Inhalt gerechtfertigter
und nicht dem bloßen Belieben des Künstlers
anheimzugebender ist, die Geschichtsmalerei (so „stylvoll" im klebrigen
ihre Behandlung sein mag) sich als realistische Sphäre gegenüber
jenen andern als specisisch idealistischen verhält. Man braucht gar
nicht an die innere Verwandtschaft des religiösen Dogma's und der
biblischen Geschichte mit den wesentlich doch auch syntbolisch zu
fassenden Mythen der Alten zu erinnern: es wäre erstaunlich ober-
flächlich, den Unterschied darin finden zu wollen, daß das christliche
Dogma „wahr", das heidnische dagegen eitel Schein und Einbildung
sei. Was das Wesentliche in Beiden ist: der symbolische Inhalt
und die wunderbare Form haben sie beide gemein, und was die
„Wahrheit" betrifft, so ist sie, als eine rein innerliche, lediglich Sache
des gläubigen Subjekts. Auch die Sage — trotz allem phantastischen
Wunderbeiwerk — ja das Märchen haben ihre innere Wahrheit,
selbst wenn sie rein erfunden sind.
Dennoch existirt zwischen dein religiösen und dem mythologischen
Idealismus ein Unterschied : jener hat für uns durch die gleichsam
mit der Muttermilch eingesogene und durch die Erziehung zur typi-
schen Gestaltung verhärtete christliche Anschauungswelt eine gewisse
Unmittelbarkeit gewonnen, der sich die Einbildungskraft trotz allem
bessern Wissen des Verstandes nicht zu entziehen vermag; die antike
Mythe dagegen hat nur poetische Wahrheit für uns und ist unter
realen Formen gar nicht vorstellbar. Außerdem kommt noch hinzu,
daß die specifische Form der künstlerischen Gestaltung, in welcher
die alten Griechen ihre Götter und Göttinnen anschauten, wesentlich
ja ausschließlich plastisch war, in dem Sinne, daß sie der maleri-
schen Behandlung aus inneren Gründen widerstreben muß. Mit
den christlichen Gestalten ist es gerade umgekehrt: „ Madonna",
„Christus" sind ebenso wesentlich malerische Gestalten, wie „Ve-
nns" und „Apollo" plastische. Es liegt der Grund davon tiefer
(nämlich in der unterschiedlichen Natur der völkergeschichtlichen Ent-
wickelung: dort der antiken, hier der mitttelalterlichen Welt), als
daß wir hier genauer darauf cingehen könnten; nur das Eine —
und allerdings Wesentliche — wollen wir hervorheben, daß den
griechischen Göttern jene tiefe Innerlichkeit, jene Innigkeit der
Empfindung fehlt, welche sich vorzugsweise im Ausdruck des Ge-