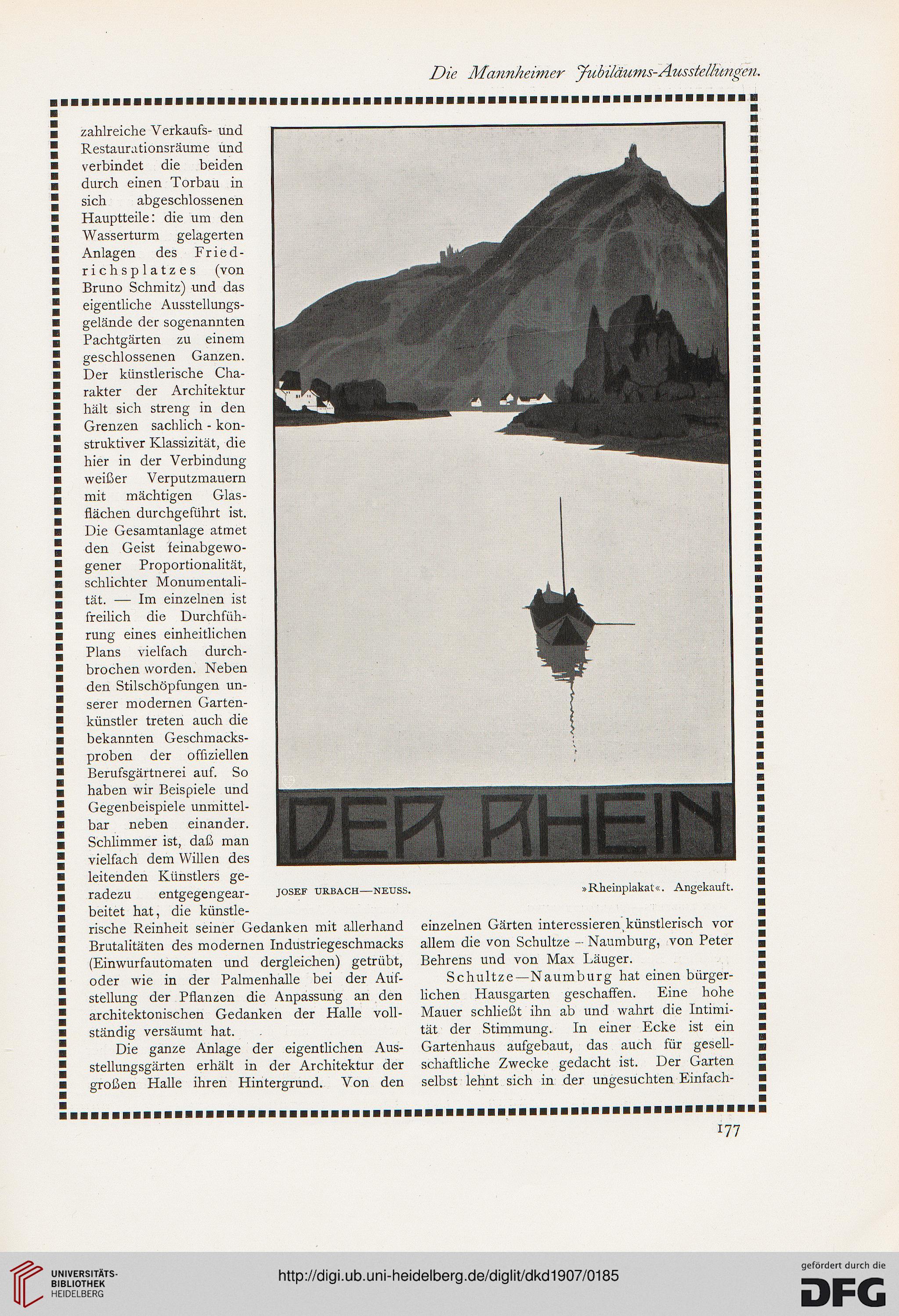Die Mannheimer Jubiläums-Ausstellungen.
zahlreiche Verkaufs- und
Restaurationsräume und
verbindet die beiden
durch einen Torbau in
sich abgeschlossenen
Hauptteile: die um den
Wasserturm gelagerten
Anlagen des Fried-
richsplatzes (von
Bruno Schmitz) und das
eigentliche Ausstellungs-
gelände der sogenannten
Pachtgärten zu einem
geschlossenen Ganzen.
Der künstlerische Cha-
rakter der Architektur
hält sich streng in den
Grenzen sachlich - kon-
struktiver Klassizität, die
hier in der Verbindung
weißer Verputzmauern
mit mächtigen Glas-
flächen durchgeführt ist.
Die Gesamtanlage atmet
den Geist feinabgewo-
gener Proportionalität,
schlichter Monumentali-
tät. — Im einzelnen ist
freilich die Durchfüh-
rung eines einheitlichen
Plans vielfach durch-
brochen worden. Neben
den Stilschöpfungen un-
serer modernen Garten-
künstler treten auch die
bekannten Geschmacks-
proben der offiziellen
Berufsgärtnerei auf. So
haben wir Beispiele und
Gegenbeispiele unmittel-
bar neben einander.
Schlimmer ist, daß man
vielfach dem Willen des
leitenden Künstlers ge-
radezu entgegengear-
beitet hat, die künstle-
rische Reinheit seiner Gedanken mit allerhand
Brutalitäten des modernen Industriegeschmacks
(Einwurfautomaten und dergleichen) getrübt,
oder wie in der Palmenhalle bei der Auf-
stellung der Pflanzen die Anpassung an den
architektonischen Gedanken der Halle voll-
ständig versäumt hat.
Die ganze Anlage der eigentlichen Aus-
stellungsgärten erhält in der Architektur der
großen Halle ihren Hintergrund. Von den
JOSEF URBACH—NEUSS.
»Rheinplakat«. Angekauft.
einzelnen Gärten interessieren künstlerisch vor
allem die von Schultze - Naumburg, von Peter
Behrens und von Max Läuger.
Schultze—Naumburg hat einen bürger-
lichen Hausgarten geschaffen. Eine hohe
Mauer schließt ihn ab und wahrt die Intimi-
tät der Stimmung. In einer Ecke ist ein
Gartenhaus aufgebaut, das auch für gesell-
schaftliche Zwecke gedacht ist. Der Garten
selbst lehnt sich in der ungesuchten Einfach-
177
zahlreiche Verkaufs- und
Restaurationsräume und
verbindet die beiden
durch einen Torbau in
sich abgeschlossenen
Hauptteile: die um den
Wasserturm gelagerten
Anlagen des Fried-
richsplatzes (von
Bruno Schmitz) und das
eigentliche Ausstellungs-
gelände der sogenannten
Pachtgärten zu einem
geschlossenen Ganzen.
Der künstlerische Cha-
rakter der Architektur
hält sich streng in den
Grenzen sachlich - kon-
struktiver Klassizität, die
hier in der Verbindung
weißer Verputzmauern
mit mächtigen Glas-
flächen durchgeführt ist.
Die Gesamtanlage atmet
den Geist feinabgewo-
gener Proportionalität,
schlichter Monumentali-
tät. — Im einzelnen ist
freilich die Durchfüh-
rung eines einheitlichen
Plans vielfach durch-
brochen worden. Neben
den Stilschöpfungen un-
serer modernen Garten-
künstler treten auch die
bekannten Geschmacks-
proben der offiziellen
Berufsgärtnerei auf. So
haben wir Beispiele und
Gegenbeispiele unmittel-
bar neben einander.
Schlimmer ist, daß man
vielfach dem Willen des
leitenden Künstlers ge-
radezu entgegengear-
beitet hat, die künstle-
rische Reinheit seiner Gedanken mit allerhand
Brutalitäten des modernen Industriegeschmacks
(Einwurfautomaten und dergleichen) getrübt,
oder wie in der Palmenhalle bei der Auf-
stellung der Pflanzen die Anpassung an den
architektonischen Gedanken der Halle voll-
ständig versäumt hat.
Die ganze Anlage der eigentlichen Aus-
stellungsgärten erhält in der Architektur der
großen Halle ihren Hintergrund. Von den
JOSEF URBACH—NEUSS.
»Rheinplakat«. Angekauft.
einzelnen Gärten interessieren künstlerisch vor
allem die von Schultze - Naumburg, von Peter
Behrens und von Max Läuger.
Schultze—Naumburg hat einen bürger-
lichen Hausgarten geschaffen. Eine hohe
Mauer schließt ihn ab und wahrt die Intimi-
tät der Stimmung. In einer Ecke ist ein
Gartenhaus aufgebaut, das auch für gesell-
schaftliche Zwecke gedacht ist. Der Garten
selbst lehnt sich in der ungesuchten Einfach-
177