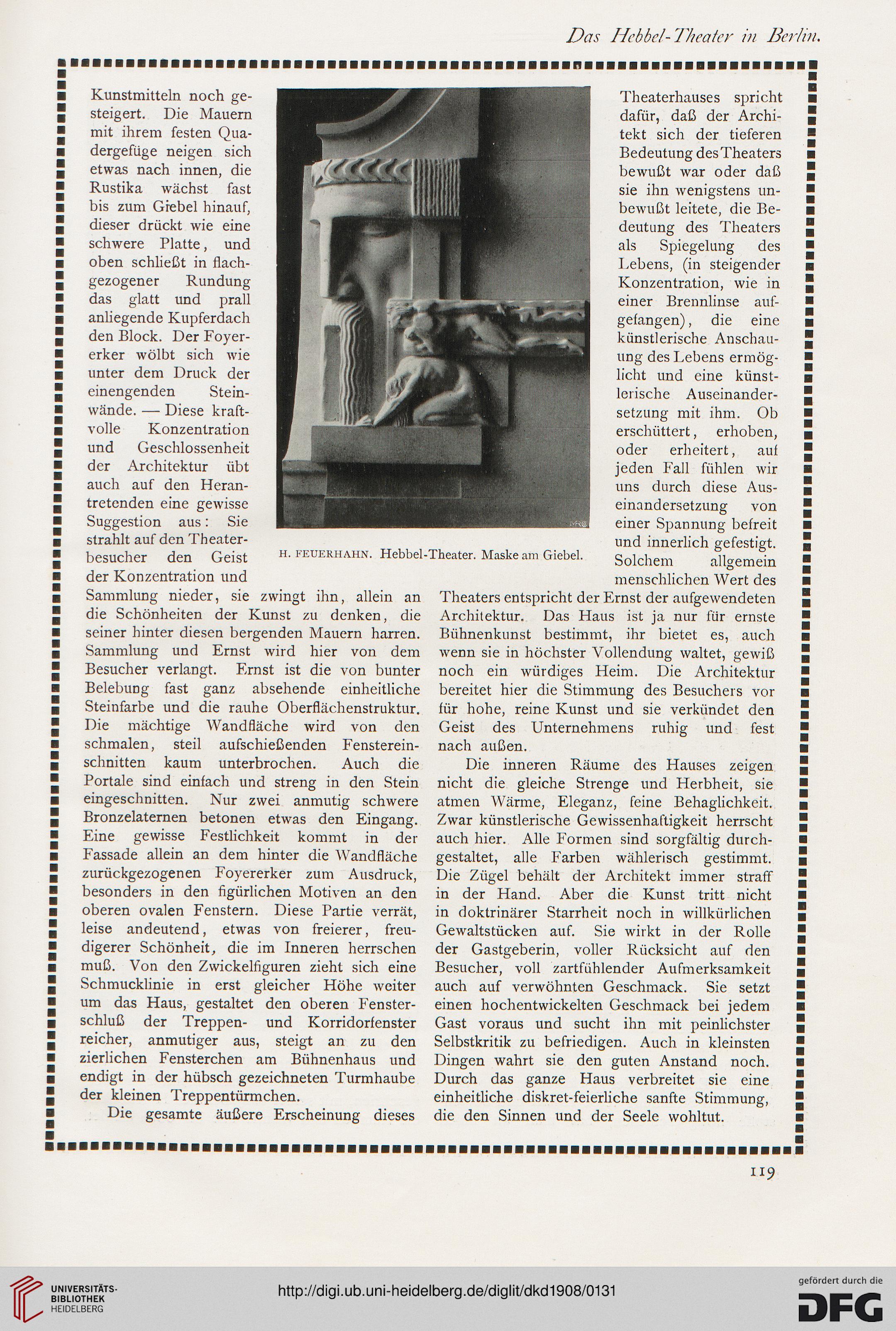Das Hebbel-Theater in Berlin.
H. FEUERHAHN. Hebbel-Theater. Maske am Giebel
Kunstmitteln noch ge-
steigert. Die Mauern
mit ihrem festen Qua-
dergefüge neigen sich
etwas nach innen, die
Rustika wächst fast
bis zum Giebel hinauf,
dieser drückt wie eine
schwere Platte, und
oben schließt in Aach-
gezogener Rundung
das glatt und prall
anliegende Kupferdach
den Block. Der Foyer-
erker wölbt sich wie
unter dem Druck der
einengenden Stein-
wände. ■— Diese kraft-
volle Konzentration
und Geschlossenheit
der Architektur übt
auch auf den Heran-
tretenden eine gewisse
Suggestion aus: Sie
strahlt auf den Theater-
besucher den Geist
der Konzentration und
Sammlung nieder, sie zwingt ihn, allein an
die Schönheiten der Kunst zu denken, die
seiner hinter diesen bergenden Mauern harren.
Sammlung und Ernst wird hier von dem
Besucher verlangt. Ernst ist die von bunter
Belebung fast ganz absehende einheitliche
Steinfarbe und die rauhe Oberflächenstruktur.
Die mächtige Wandfläche wird von den
schmalen, steil aufschießenden Fensterein-
schnitten kaum unterbrochen. Auch die
Portale sind einfach und streng in den Stein
eingeschnitten. Nur zwei anmutig schwere
Bronzelaternen betonen etwas den Eingang.
Eine gewisse Festlichkeit kommt in der
Fassade allein an dem hinter die Wandfläche
zurückgezogenen Foyererker zum Ausdruck,
besonders in den figürlichen Motiven an den
oberen ovalen Fenstern. Diese Partie verrät,
leise andeutend, etwas von freierer, freu-
digerer Schönheit, die im Inneren herrschen
muß. Von den Zwickelfiguren zieht sich eine
Schmucklinie in erst gleicher Höhe weiter
um das Haus, gestaltet den oberen Fenster-
schluß der Treppen- und Korridorfenster
reicher, anmutiger aus, steigt an zu den
zierlichen Fensterchen am Bühnenhaus und
endigt in der hübsch gezeichneten Turmhaube
der kleinen Treppentürmchen.
Die gesamte äußere Erscheinung dieses
Theaterhauses spricht
dafür, daß der Archi-
tekt sich der tieferen
Bedeutung des Theaters
bewußt war oder daß
sie ihn wenigstens un-
bewußt leitete, die Be-
deutung des Theaters
als Spiegelung des
Lebens, (in steigender
Konzentration, wie in
einer Brennlinse auf-
gefangen) , die eine
künstlerische Anschau-
ung des Lebens ermög-
licht und eine künst-
lerische Auseinander-
setzung mit ihm. Ob
erschüttert, erhoben,
oder erheitert, auf
jeden Fall fühlen wir
uns durch diese Aus-
einandersetzung von
einer Spannung befreit
und innerlich gefestigt.
Solchem allgemein
menschlichen Wert des
Theaters entspricht der Ernst der aufgewendeten
Architektur. Das Haus ist ja nur für ernste
Bühnenkunst bestimmt, ihr bietet es, auch
wenn sie in höchster Vollendung waltet, gewiß
noch ein würdiges Heim. Die Architektur
bereitet hier die Stimmung des Besuchers vor
für hohe, reine Kunst und sie verkündet den
Geist des Unternehmens ruhig und fest
nach außen.
Die inneren Räume des Hauses zeigen
nicht die gleiche Strenge und Herbheit, sie
atmen Wärme, Eleganz, feine Behaglichkeit.
Zwar künstlerische Gewissenhaftigkeit herrscht
auch hier. Alle Formen sind sorgfältig durch-
gestaltet, alle Farben wählerisch gestimmt.
Die Zügel behält der Architekt immer straff
in der Hand. Aber die Kunst tritt nicht
in doktrinärer Starrheit noch in willkürlichen
Gewaltstücken auf. Sie wirkt in der Rolle
der Gastgeberin, voller Rücksicht auf den
Besucher, voll zartfühlender Aufmerksamkeit
auch auf verwöhnten Geschmack. Sie setzt
einen hochentwickelten Geschmack bei jedem
Gast voraus und sucht ihn mit peinlichster
Selbstkritik zu befriedigen. Auch in kleinsten
Dingen wahrt sie den guten Anstand noch.
Durch das ganze Haus verbreitet sie eine
einheitliche diskret-feierliche sanfte Stimmung,
die den Sinnen und der Seele wohltut.
119
H. FEUERHAHN. Hebbel-Theater. Maske am Giebel
Kunstmitteln noch ge-
steigert. Die Mauern
mit ihrem festen Qua-
dergefüge neigen sich
etwas nach innen, die
Rustika wächst fast
bis zum Giebel hinauf,
dieser drückt wie eine
schwere Platte, und
oben schließt in Aach-
gezogener Rundung
das glatt und prall
anliegende Kupferdach
den Block. Der Foyer-
erker wölbt sich wie
unter dem Druck der
einengenden Stein-
wände. ■— Diese kraft-
volle Konzentration
und Geschlossenheit
der Architektur übt
auch auf den Heran-
tretenden eine gewisse
Suggestion aus: Sie
strahlt auf den Theater-
besucher den Geist
der Konzentration und
Sammlung nieder, sie zwingt ihn, allein an
die Schönheiten der Kunst zu denken, die
seiner hinter diesen bergenden Mauern harren.
Sammlung und Ernst wird hier von dem
Besucher verlangt. Ernst ist die von bunter
Belebung fast ganz absehende einheitliche
Steinfarbe und die rauhe Oberflächenstruktur.
Die mächtige Wandfläche wird von den
schmalen, steil aufschießenden Fensterein-
schnitten kaum unterbrochen. Auch die
Portale sind einfach und streng in den Stein
eingeschnitten. Nur zwei anmutig schwere
Bronzelaternen betonen etwas den Eingang.
Eine gewisse Festlichkeit kommt in der
Fassade allein an dem hinter die Wandfläche
zurückgezogenen Foyererker zum Ausdruck,
besonders in den figürlichen Motiven an den
oberen ovalen Fenstern. Diese Partie verrät,
leise andeutend, etwas von freierer, freu-
digerer Schönheit, die im Inneren herrschen
muß. Von den Zwickelfiguren zieht sich eine
Schmucklinie in erst gleicher Höhe weiter
um das Haus, gestaltet den oberen Fenster-
schluß der Treppen- und Korridorfenster
reicher, anmutiger aus, steigt an zu den
zierlichen Fensterchen am Bühnenhaus und
endigt in der hübsch gezeichneten Turmhaube
der kleinen Treppentürmchen.
Die gesamte äußere Erscheinung dieses
Theaterhauses spricht
dafür, daß der Archi-
tekt sich der tieferen
Bedeutung des Theaters
bewußt war oder daß
sie ihn wenigstens un-
bewußt leitete, die Be-
deutung des Theaters
als Spiegelung des
Lebens, (in steigender
Konzentration, wie in
einer Brennlinse auf-
gefangen) , die eine
künstlerische Anschau-
ung des Lebens ermög-
licht und eine künst-
lerische Auseinander-
setzung mit ihm. Ob
erschüttert, erhoben,
oder erheitert, auf
jeden Fall fühlen wir
uns durch diese Aus-
einandersetzung von
einer Spannung befreit
und innerlich gefestigt.
Solchem allgemein
menschlichen Wert des
Theaters entspricht der Ernst der aufgewendeten
Architektur. Das Haus ist ja nur für ernste
Bühnenkunst bestimmt, ihr bietet es, auch
wenn sie in höchster Vollendung waltet, gewiß
noch ein würdiges Heim. Die Architektur
bereitet hier die Stimmung des Besuchers vor
für hohe, reine Kunst und sie verkündet den
Geist des Unternehmens ruhig und fest
nach außen.
Die inneren Räume des Hauses zeigen
nicht die gleiche Strenge und Herbheit, sie
atmen Wärme, Eleganz, feine Behaglichkeit.
Zwar künstlerische Gewissenhaftigkeit herrscht
auch hier. Alle Formen sind sorgfältig durch-
gestaltet, alle Farben wählerisch gestimmt.
Die Zügel behält der Architekt immer straff
in der Hand. Aber die Kunst tritt nicht
in doktrinärer Starrheit noch in willkürlichen
Gewaltstücken auf. Sie wirkt in der Rolle
der Gastgeberin, voller Rücksicht auf den
Besucher, voll zartfühlender Aufmerksamkeit
auch auf verwöhnten Geschmack. Sie setzt
einen hochentwickelten Geschmack bei jedem
Gast voraus und sucht ihn mit peinlichster
Selbstkritik zu befriedigen. Auch in kleinsten
Dingen wahrt sie den guten Anstand noch.
Durch das ganze Haus verbreitet sie eine
einheitliche diskret-feierliche sanfte Stimmung,
die den Sinnen und der Seele wohltut.
119