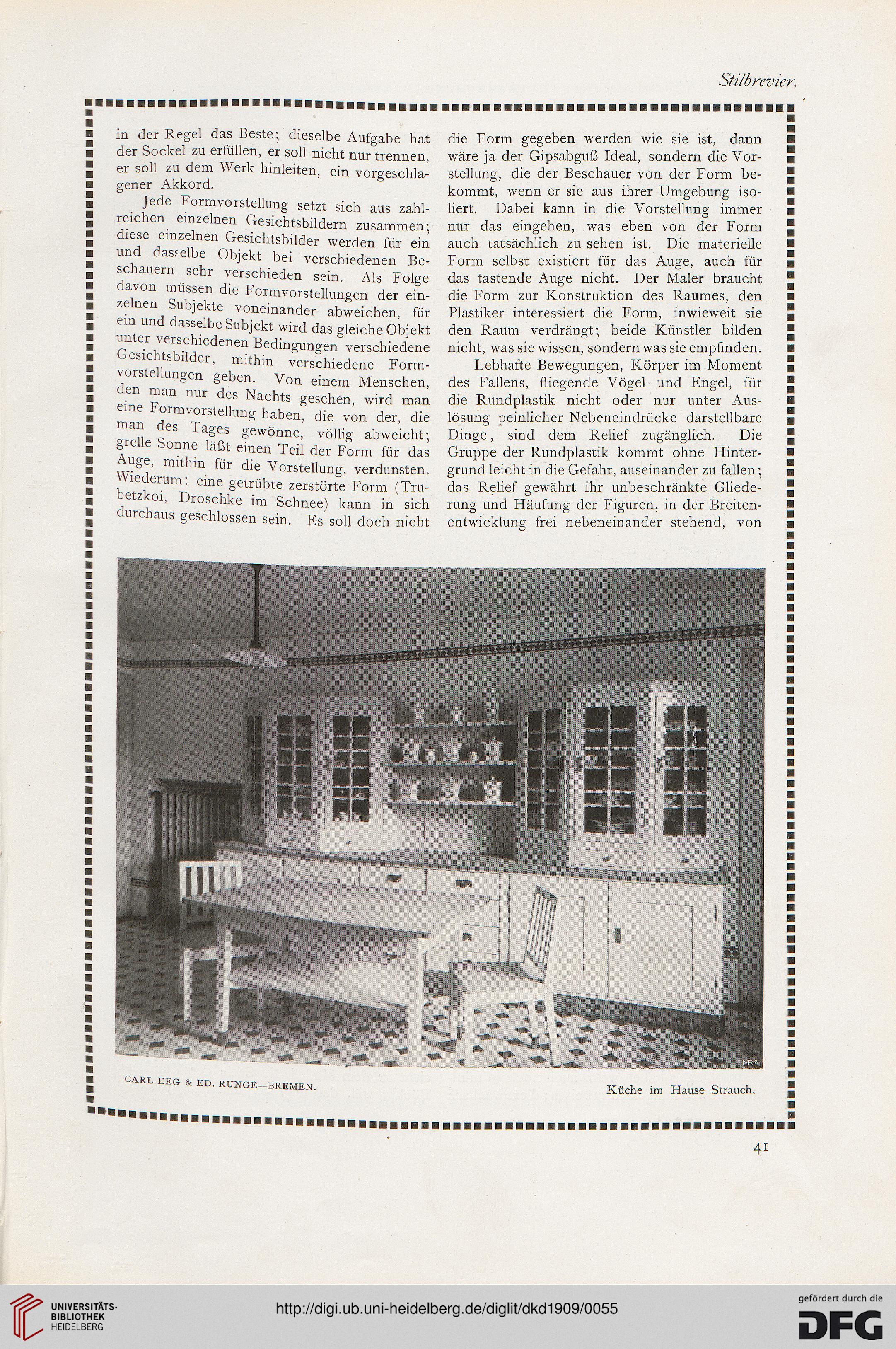Stilbrevier.
in der Regel das Beste-, dieselbe Aufgabe hat
der Sockel zu erfüllen, er soll nicht nur trennen,
er soll zu dem Werk hinleiten, ein vorgeschla-
gener Akkord.
Jede Formvorstellung setzt sich aus zahl-
reichen einzelnen Gesichtsbildern zusammen;
diese einzelnen Gesichtsbilder werden für ein
und dasselbe Objekt bei verschiedenen Be-
schauern sehr verschieden sein. Als Folge
davon müssen die Formvorstellungen der ein-
zelnen Subjekte voneinander abweichen, für
ein und dasselbe Subjekt wird das gleiche Objekt
unter verschiedenen Bedingungen verschiedene
Gesichtsbilder, mithin verschiedene Form-
vorstellungen geben. Von einem Menschen,
den man nur des Nachts gesehen, wird man
eine Formvorslellung haben, die von der, die
man des Tages gewönne, völlig abweicht;
grelle Sonne läßt einen Teil der Form für das
Auge, mithin für die Vorstellung, verdunsten.
Wiederum: eine getrübte zerstörte Form (Tru-
betzkoi, Droschke im Schnee) kann in sich
durchaus geschlossen sein. Es soll doch nicht
die Form gegeben werden wie sie ist, dann
wäre ja der Gipsabguß Ideal, sondern die Vor-
stellung, die der Beschauer von der Form be-
kommt, wenn er sie aus ihrer Umgebung iso-
liert. Dabei kann in die Vorstellung immer
nur das eingehen, was eben von der Form
auch tatsächlich zu sehen ist. Die materielle
Form selbst existiert für das Auge, auch für
das tastende Auge nicht. Der Maler braucht
die Form zur Konstruktion des Raumes, den
Plastiker interessiert die Form, inwieweit sie
den Raum verdrängt; beide Künstler bilden
nicht, was sie wissen, sondern was sie empfinden.
Lebhafte Bewegungen, Körper im Moment
des Fallens, fliegende Vögel und Engel, für
die Rundplastik nicht oder nur unter Aus-
lösung peinlicher Nebeneindrücke darstellbare
Dinge, sind dem Relief zugänglich. Die
Gruppe der Rundplastik kommt ohne Hinter-
grund leicht in die Gefahr, auseinander zu fallen ;
das Relief gewährt ihr unbeschränkte Gliede-
rung und Häufung der Figuren, in der Breiten-
entwicklung frei nebeneinander stehend, von
in der Regel das Beste-, dieselbe Aufgabe hat
der Sockel zu erfüllen, er soll nicht nur trennen,
er soll zu dem Werk hinleiten, ein vorgeschla-
gener Akkord.
Jede Formvorstellung setzt sich aus zahl-
reichen einzelnen Gesichtsbildern zusammen;
diese einzelnen Gesichtsbilder werden für ein
und dasselbe Objekt bei verschiedenen Be-
schauern sehr verschieden sein. Als Folge
davon müssen die Formvorstellungen der ein-
zelnen Subjekte voneinander abweichen, für
ein und dasselbe Subjekt wird das gleiche Objekt
unter verschiedenen Bedingungen verschiedene
Gesichtsbilder, mithin verschiedene Form-
vorstellungen geben. Von einem Menschen,
den man nur des Nachts gesehen, wird man
eine Formvorslellung haben, die von der, die
man des Tages gewönne, völlig abweicht;
grelle Sonne läßt einen Teil der Form für das
Auge, mithin für die Vorstellung, verdunsten.
Wiederum: eine getrübte zerstörte Form (Tru-
betzkoi, Droschke im Schnee) kann in sich
durchaus geschlossen sein. Es soll doch nicht
die Form gegeben werden wie sie ist, dann
wäre ja der Gipsabguß Ideal, sondern die Vor-
stellung, die der Beschauer von der Form be-
kommt, wenn er sie aus ihrer Umgebung iso-
liert. Dabei kann in die Vorstellung immer
nur das eingehen, was eben von der Form
auch tatsächlich zu sehen ist. Die materielle
Form selbst existiert für das Auge, auch für
das tastende Auge nicht. Der Maler braucht
die Form zur Konstruktion des Raumes, den
Plastiker interessiert die Form, inwieweit sie
den Raum verdrängt; beide Künstler bilden
nicht, was sie wissen, sondern was sie empfinden.
Lebhafte Bewegungen, Körper im Moment
des Fallens, fliegende Vögel und Engel, für
die Rundplastik nicht oder nur unter Aus-
lösung peinlicher Nebeneindrücke darstellbare
Dinge, sind dem Relief zugänglich. Die
Gruppe der Rundplastik kommt ohne Hinter-
grund leicht in die Gefahr, auseinander zu fallen ;
das Relief gewährt ihr unbeschränkte Gliede-
rung und Häufung der Figuren, in der Breiten-
entwicklung frei nebeneinander stehend, von