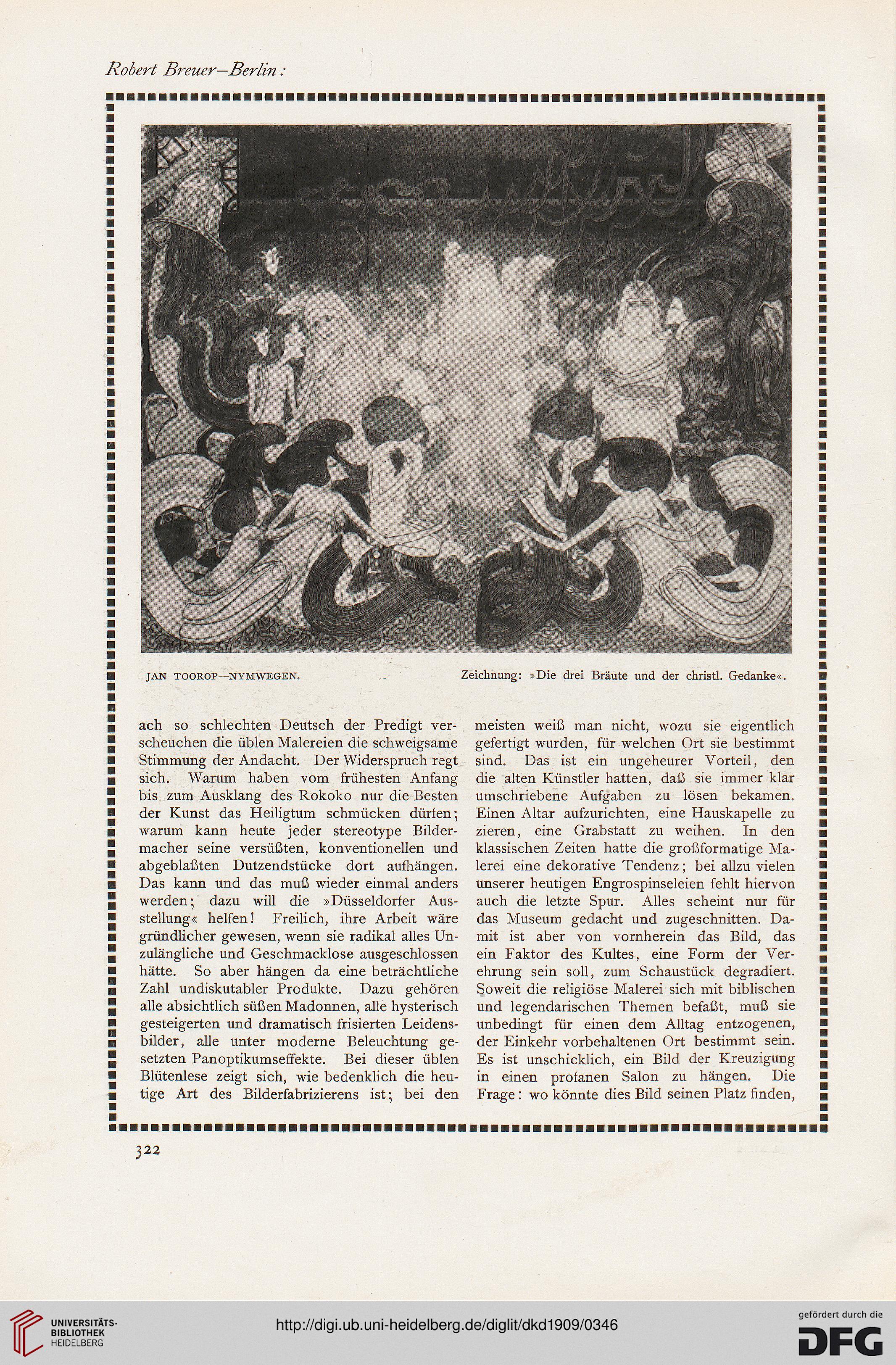Robert Breuer—Berlin:
ach so schlechten Deutsch der Predigt ver-
scheuchen die üblen Malereien die schweigsame
Stimmung der Andacht. Der Widerspruch regt
sich. Warum haben vom frühesten Anfang
bis zum Ausklang des Rokoko nur die Besten
der Kunst das Heiligtum schmücken dürfen;
warum kann heute jeder stereotype Bilder-
macher seine versüßten, konventionellen und
abgeblaßten Dutzendstücke dort aufhängen.
Das kann und das muß wieder einmal anders
werden; dazu will die »Düsseldorfer Aus-
stellung« helfen! Freilich, ihre Arbeit wäre
gründlicher gewesen, wenn sie radikal alles Un-
zulängliche und Geschmacklose ausgeschlossen
hätte. So aber hängen da eine beträchtliche
Zahl undiskutabler Produkte. Dazu gehören
alle absichtlich süßen Madonnen, alle hysterisch
gesteigerten und dramatisch frisierten Leidens-
bilder, alle unter moderne Beleuchtung ge-
setzten Panoptikumseffekte. Bei dieser üblen
Blütenlese zeigt sich, wie bedenklich die heu-
tige Art des Bilderfabrizierens ist; bei den
meisten weiß man nicht, wozu sie eigentlich
gefertigt wurden, für welchen Ort sie bestimmt
sind. Das ist ein ungeheurer Vorteil, den
die alten Künstler hatten, daß sie immer klar
umschriebene Aufgaben zu lösen bekamen.
Einen Altar aufzurichten, eine Hauskapelle zu
zieren, eine Grabstatt zu weihen. In den
klassischen Zeiten hatte die großformatige Ma-
lerei eine dekorative Tendenz; bei allzu vielen
unserer heutigen Engrospinseleien fehlt hiervon
auch die letzte Spur. Alles scheint nur für
das Museum gedacht und zugeschnitten. Da-
mit ist aber von vornherein das Bild, das
ein Faktor des Kultes, eine Form der Ver-
ehrung sein soll, zum Schaustück degradiert.
Soweit die religiöse Malerei sich mit biblischen
und legendarischen Themen befaßt, muß sie
unbedingt für einen dem Alltag entzogenen,
der Einkehr vorbehaltenen Ort bestimmt sein.
Es ist unschicklich, ein Bild der Kreuzigung
in einen profanen Salon zu hängen. Die
Frage : wo könnte dies Bild seinen Platz finden,
322
ach so schlechten Deutsch der Predigt ver-
scheuchen die üblen Malereien die schweigsame
Stimmung der Andacht. Der Widerspruch regt
sich. Warum haben vom frühesten Anfang
bis zum Ausklang des Rokoko nur die Besten
der Kunst das Heiligtum schmücken dürfen;
warum kann heute jeder stereotype Bilder-
macher seine versüßten, konventionellen und
abgeblaßten Dutzendstücke dort aufhängen.
Das kann und das muß wieder einmal anders
werden; dazu will die »Düsseldorfer Aus-
stellung« helfen! Freilich, ihre Arbeit wäre
gründlicher gewesen, wenn sie radikal alles Un-
zulängliche und Geschmacklose ausgeschlossen
hätte. So aber hängen da eine beträchtliche
Zahl undiskutabler Produkte. Dazu gehören
alle absichtlich süßen Madonnen, alle hysterisch
gesteigerten und dramatisch frisierten Leidens-
bilder, alle unter moderne Beleuchtung ge-
setzten Panoptikumseffekte. Bei dieser üblen
Blütenlese zeigt sich, wie bedenklich die heu-
tige Art des Bilderfabrizierens ist; bei den
meisten weiß man nicht, wozu sie eigentlich
gefertigt wurden, für welchen Ort sie bestimmt
sind. Das ist ein ungeheurer Vorteil, den
die alten Künstler hatten, daß sie immer klar
umschriebene Aufgaben zu lösen bekamen.
Einen Altar aufzurichten, eine Hauskapelle zu
zieren, eine Grabstatt zu weihen. In den
klassischen Zeiten hatte die großformatige Ma-
lerei eine dekorative Tendenz; bei allzu vielen
unserer heutigen Engrospinseleien fehlt hiervon
auch die letzte Spur. Alles scheint nur für
das Museum gedacht und zugeschnitten. Da-
mit ist aber von vornherein das Bild, das
ein Faktor des Kultes, eine Form der Ver-
ehrung sein soll, zum Schaustück degradiert.
Soweit die religiöse Malerei sich mit biblischen
und legendarischen Themen befaßt, muß sie
unbedingt für einen dem Alltag entzogenen,
der Einkehr vorbehaltenen Ort bestimmt sein.
Es ist unschicklich, ein Bild der Kreuzigung
in einen profanen Salon zu hängen. Die
Frage : wo könnte dies Bild seinen Platz finden,
322