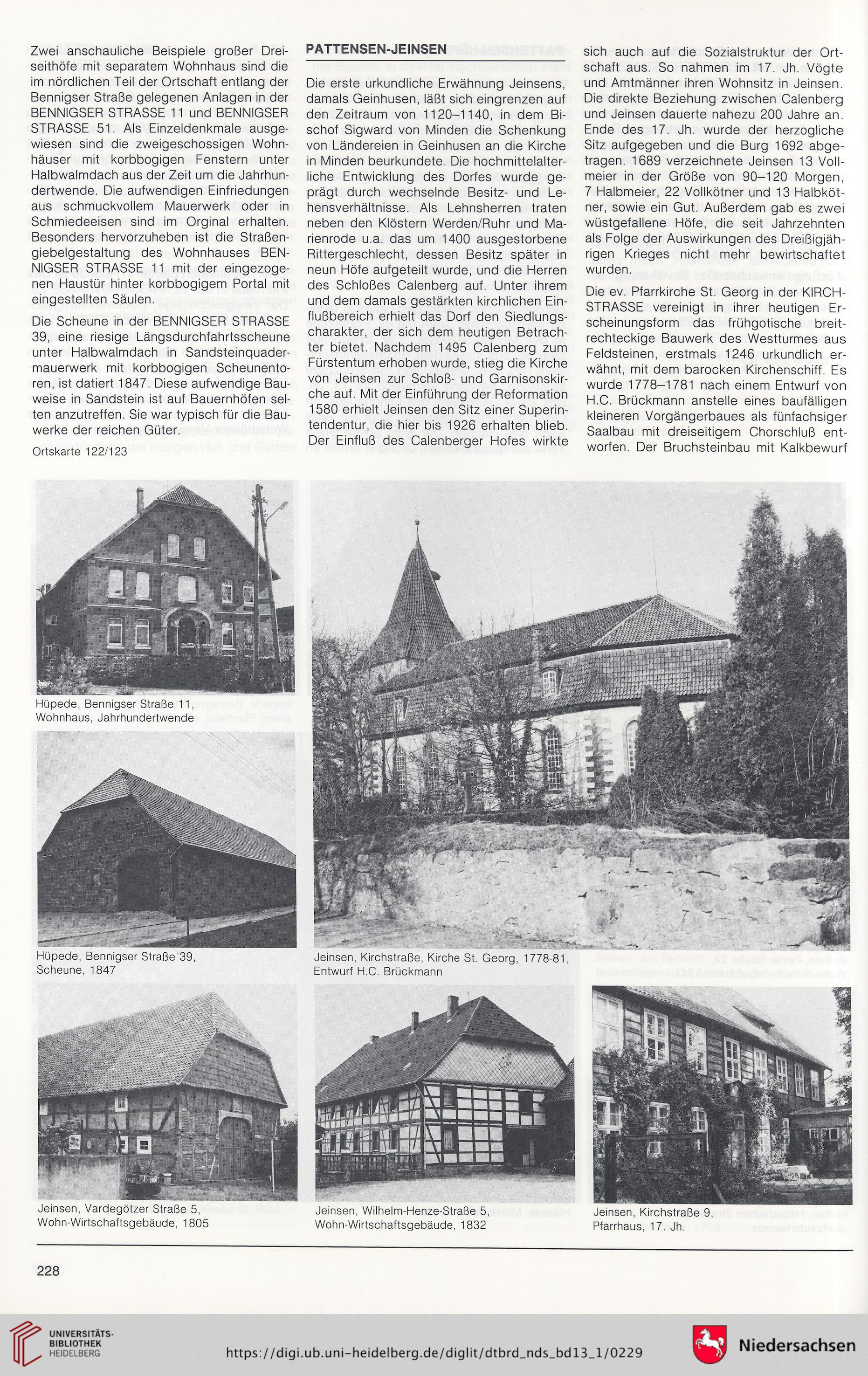Zwei anschauliche Beispiele großer Drei-
seithöfe mit separatem Wohnhaus sind die
im nördlichen Teil der Ortschaft entlang der
Bennigser Straße gelegenen Anlagen in der
BENNIGSER STRASSE 11 und BENNIGSER
STRASSE 51. Als Einzeldenkmale ausge-
wiesen sind die zweigeschossigen Wohn-
häuser mit korbbogigen Fenstern unter
Halbwalmdach aus der Zeit um die Jahrhun-
dertwende. Die aufwendigen Einfriedungen
aus schmuckvollem Mauerwerk oder in
Schmiedeeisen sind im Orginal erhalten.
Besonders hervorzuheben ist die Straßen-
giebelgestaltung des Wohnhauses BEN-
NIGSER STRASSE 11 mit der eingezoge-
nen Haustür hinter korbbogigem Portal mit
eingestellten Säulen.
Die Scheune in der BENNIGSER STRASSE
39, eine riesige Längsdurchfahrtsscheune
unter Halbwalmdach in Sandsteinquader-
mauerwerk mit korbbogigen Scheunento-
ren, ist datiert 1847. Diese aufwendige Bau-
weise in Sandstein ist auf Bauernhöfen sel-
ten anzutreffen. Sie war typisch für die Bau-
werke der reichen Güter.
Ortskarte 122/123
PATTENSEN-JEINSEN
Die erste urkundliche Erwähnung Jeinsens,
damals Geinhusen, läßt sich eingrenzen auf
den Zeitraum von 1120-1140, in dem Bi-
schof Sigward von Minden die Schenkung
von Ländereien in Geinhusen an die Kirche
in Minden beurkundete. Die hochmittelalter-
liche Entwicklung des Dorfes wurde ge-
prägt durch wechselnde Besitz- und Le-
hensverhältnisse. Als Lehnsherren traten
neben den Klöstern Werden/Ruhr und Ma-
rienrode u.a. das um 1400 ausgestorbene
Rittergeschlecht, dessen Besitz später in
neun Höfe aufgeteilt wurde, und die Herren
des Schloßes Calenberg auf. Unter ihrem
und dem damals gestärkten kirchlichen Ein-
flußbereich erhielt das Dorf den Siedlungs-
charakter, der sich dem heutigen Betrach-
ter bietet. Nachdem 1495 Calenberg zum
Fürstentum erhoben wurde, stieg die Kirche
von Jeinsen zur Schloß- und Garnisonskir-
che auf. Mit der Einführung der Reformation
1580 erhielt Jeinsen den Sitz einer Superin-
tendentur, die hier bis 1926 erhalten blieb.
Der Einfluß des Calenberger Hofes wirkte
sich auch auf die Sozialstruktur der Ort-
schaft aus. So nahmen im 17. Jh. Vögte
und Amtmänner ihren Wohnsitz in Jeinsen.
Die direkte Beziehung zwischen Calenberg
und Jeinsen dauerte nahezu 200 Jahre an.
Ende des 17. Jh. wurde der herzogliche
Sitz aufgegeben und die Burg 1692 abge-
tragen. 1689 verzeichnete Jeinsen 13 Voll-
meier in der Größe von 90-120 Morgen,
7 Halbmeier, 22 Vollkötner und 13 Halbköt-
ner, sowie ein Gut. Außerdem gab es zwei
wüstgefallene Höfe, die seit Jahrzehnten
als Folge der Auswirkungen des Dreißigjäh-
rigen Krieges nicht mehr bewirtschaftet
wurden.
Die ev. Pfarrkirche St. Georg in der KIRCH-
STRASSE vereinigt in ihrer heutigen Er-
scheinungsform das frühgotische breit-
rechteckige Bauwerk des Westturmes aus
Feldsteinen, erstmals 1246 urkundlich er-
wähnt, mit dem barocken Kirchenschiff. Es
wurde 1778-1781 nach einem Entwurf von
H.C. Brückmann anstelle eines baufälligen
kleineren Vorgängerbaues als fünfachsiger
Saalbau mit dreiseitigem Chorschluß ent-
worfen. Der Bruchsteinbau mit Kalkbewurf
Hüpede, Bennigser Straße 11,
Wohnhaus, Jahrhundertwende
Hüpede, Bennigser Straße'39,
Scheune, 1847
Jeinsen, Vardegötzer Straße 5,
Wohn-Wirtschaftsgebäude, 1805
Jeinsen, Kirchstraße, Kirche St. Georg, 1778-81,
Entwurf H.C. Brückmann
Jeinsen, Wilhelm-Henze-Straße 5,
Wohn-Wirtschaftsgebäude, 1832
Jeinsen, Kirchstraße 9,
Pfarrhaus, 17. Jh.
228
seithöfe mit separatem Wohnhaus sind die
im nördlichen Teil der Ortschaft entlang der
Bennigser Straße gelegenen Anlagen in der
BENNIGSER STRASSE 11 und BENNIGSER
STRASSE 51. Als Einzeldenkmale ausge-
wiesen sind die zweigeschossigen Wohn-
häuser mit korbbogigen Fenstern unter
Halbwalmdach aus der Zeit um die Jahrhun-
dertwende. Die aufwendigen Einfriedungen
aus schmuckvollem Mauerwerk oder in
Schmiedeeisen sind im Orginal erhalten.
Besonders hervorzuheben ist die Straßen-
giebelgestaltung des Wohnhauses BEN-
NIGSER STRASSE 11 mit der eingezoge-
nen Haustür hinter korbbogigem Portal mit
eingestellten Säulen.
Die Scheune in der BENNIGSER STRASSE
39, eine riesige Längsdurchfahrtsscheune
unter Halbwalmdach in Sandsteinquader-
mauerwerk mit korbbogigen Scheunento-
ren, ist datiert 1847. Diese aufwendige Bau-
weise in Sandstein ist auf Bauernhöfen sel-
ten anzutreffen. Sie war typisch für die Bau-
werke der reichen Güter.
Ortskarte 122/123
PATTENSEN-JEINSEN
Die erste urkundliche Erwähnung Jeinsens,
damals Geinhusen, läßt sich eingrenzen auf
den Zeitraum von 1120-1140, in dem Bi-
schof Sigward von Minden die Schenkung
von Ländereien in Geinhusen an die Kirche
in Minden beurkundete. Die hochmittelalter-
liche Entwicklung des Dorfes wurde ge-
prägt durch wechselnde Besitz- und Le-
hensverhältnisse. Als Lehnsherren traten
neben den Klöstern Werden/Ruhr und Ma-
rienrode u.a. das um 1400 ausgestorbene
Rittergeschlecht, dessen Besitz später in
neun Höfe aufgeteilt wurde, und die Herren
des Schloßes Calenberg auf. Unter ihrem
und dem damals gestärkten kirchlichen Ein-
flußbereich erhielt das Dorf den Siedlungs-
charakter, der sich dem heutigen Betrach-
ter bietet. Nachdem 1495 Calenberg zum
Fürstentum erhoben wurde, stieg die Kirche
von Jeinsen zur Schloß- und Garnisonskir-
che auf. Mit der Einführung der Reformation
1580 erhielt Jeinsen den Sitz einer Superin-
tendentur, die hier bis 1926 erhalten blieb.
Der Einfluß des Calenberger Hofes wirkte
sich auch auf die Sozialstruktur der Ort-
schaft aus. So nahmen im 17. Jh. Vögte
und Amtmänner ihren Wohnsitz in Jeinsen.
Die direkte Beziehung zwischen Calenberg
und Jeinsen dauerte nahezu 200 Jahre an.
Ende des 17. Jh. wurde der herzogliche
Sitz aufgegeben und die Burg 1692 abge-
tragen. 1689 verzeichnete Jeinsen 13 Voll-
meier in der Größe von 90-120 Morgen,
7 Halbmeier, 22 Vollkötner und 13 Halbköt-
ner, sowie ein Gut. Außerdem gab es zwei
wüstgefallene Höfe, die seit Jahrzehnten
als Folge der Auswirkungen des Dreißigjäh-
rigen Krieges nicht mehr bewirtschaftet
wurden.
Die ev. Pfarrkirche St. Georg in der KIRCH-
STRASSE vereinigt in ihrer heutigen Er-
scheinungsform das frühgotische breit-
rechteckige Bauwerk des Westturmes aus
Feldsteinen, erstmals 1246 urkundlich er-
wähnt, mit dem barocken Kirchenschiff. Es
wurde 1778-1781 nach einem Entwurf von
H.C. Brückmann anstelle eines baufälligen
kleineren Vorgängerbaues als fünfachsiger
Saalbau mit dreiseitigem Chorschluß ent-
worfen. Der Bruchsteinbau mit Kalkbewurf
Hüpede, Bennigser Straße 11,
Wohnhaus, Jahrhundertwende
Hüpede, Bennigser Straße'39,
Scheune, 1847
Jeinsen, Vardegötzer Straße 5,
Wohn-Wirtschaftsgebäude, 1805
Jeinsen, Kirchstraße, Kirche St. Georg, 1778-81,
Entwurf H.C. Brückmann
Jeinsen, Wilhelm-Henze-Straße 5,
Wohn-Wirtschaftsgebäude, 1832
Jeinsen, Kirchstraße 9,
Pfarrhaus, 17. Jh.
228