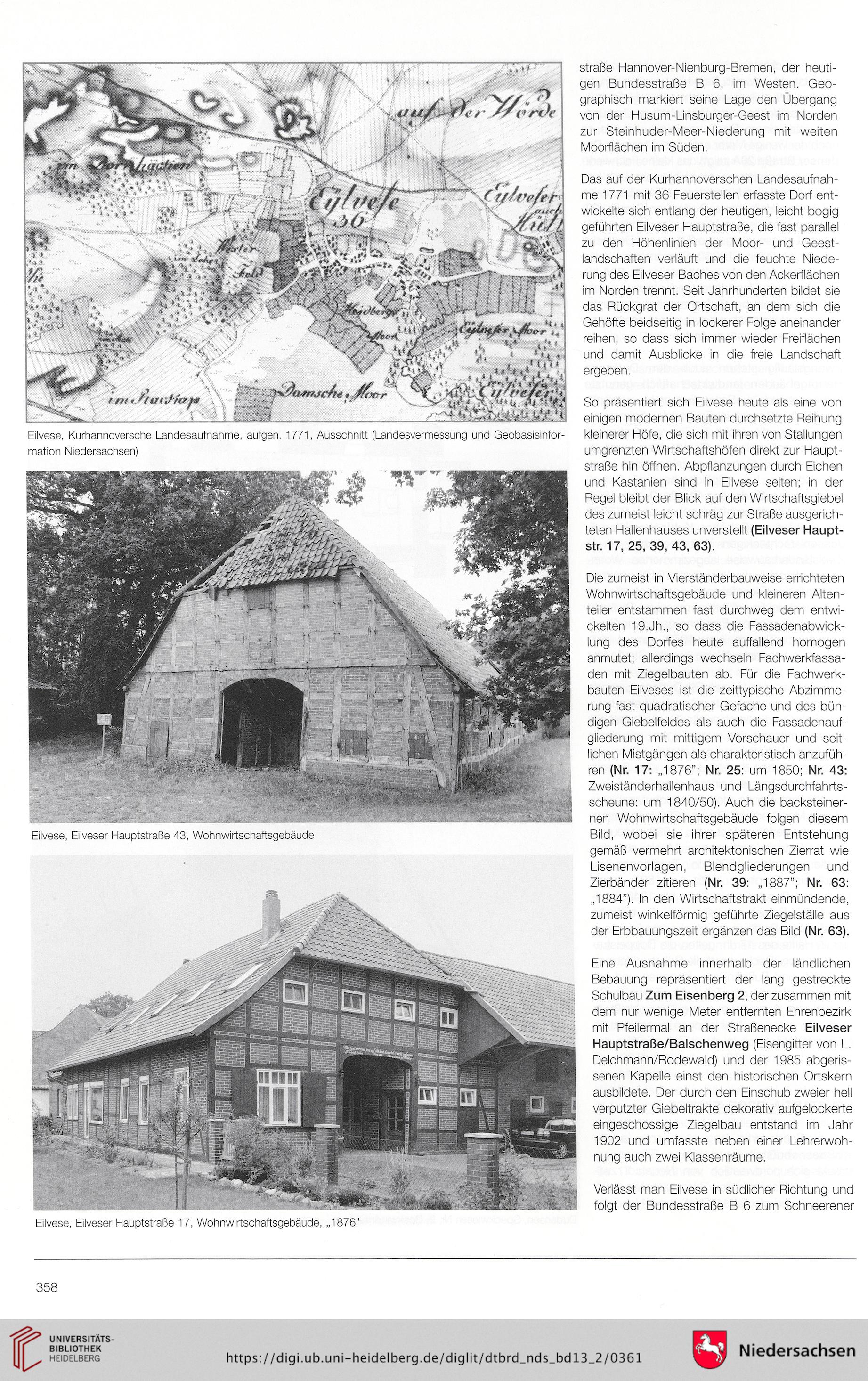Eilvese, Kurhannoversche Landesaufnahme, aufgen. 1771, Ausschnitt (Landesvermessung und Geobasisinfor-
mation Niedersachsen)
Straße Hannover-Nienburg-Bremen, der heuti-
gen Bundesstraße B 6, im Westen. Geo-
graphisch markiert seine Lage den Übergang
von der Husum-Linsburger-Geest im Norden
zur Steinhuder-Meer-Niederung mit weiten
Moorflächen im Süden.
Das auf der Kurhannoverschen Landesaufnah-
me 1771 mit 36 Feuerstellen erfasste Dorf ent-
wickelte sich entlang der heutigen, leicht bogig
geführten Eilveser Hauptstraße, die fast parallel
zu den Höhenlinien der Moor- und Geest-
landschaften verläuft und die feuchte Niede-
rung des Eilveser Baches von den Ackerflächen
im Norden trennt. Seit Jahrhunderten bildet sie
das Rückgrat der Ortschaft, an dem sich die
Gehöfte beidseitig in lockerer Folge aneinander
reihen, so dass sich immer wieder Freiflächen
und damit Ausblicke in die freie Landschaft
ergeben.
So präsentiert sich Eilvese heute als eine von
einigen modernen Bauten durchsetzte Reihung
kleinerer Höfe, die sich mit ihren von Stallungen
umgrenzten Wirtschaftshöfen direkt zur Haupt-
straße hin öffnen. Abpflanzungen durch Eichen
und Kastanien sind in Eilvese selten; in der
Regel bleibt der Blick auf den Wirtschaftsgiebel
des zumeist leicht schräg zur Straße ausgerich-
teten Hallenhauses unverstellt (Eilveser Haupt-
str. 17, 25, 39, 43, 63).
Die zumeist in Vierständerbauweise errichteten
Wohnwirtschaftsgebäude und kleineren Alten-
teiler entstammen fast durchweg dem entwi-
ckelten 19.Jh., so dass die Fassadenabwick-
lung des Dorfes heute auffallend homogen
anmutet; allerdings wechseln Fachwerkfassa-
den mit Ziegelbauten ab. Für die Fachwerk-
bauten Eilveses ist die zeittypische Abzimme-
rung fast quadratischer Gefache und des bün-
digen Giebelfeldes als auch die Fassadenauf-
gliederung mit mittigem Vorschauer und seit-
lichen Mistgängen als charakteristisch anzufüh-
ren (Nr. 17: „1876”; Nr. 25: um 1850; Nr. 43:
Zweiständerhallenhaus und Längsdurchfahrts-
scheune: um 1840/50). Auch die backsteiner-
nen Wohnwirtschaftsgebäude folgen diesem
Eilvese, Eilveser Hauptstraße 43, Wohnwirtschaftsgebäude
Bild, wobei sie ihrer späteren Entstehung
gemäß vermehrt architektonischen Zierrat wie
Lisenenvorlagen, Blendgliederungen und
Zierbänder zitieren (Nr. 39: „1887”; Nr. 63:
„1884”). In den Wirtschaftstrakt einmündende,
zumeist winkelförmig geführte Ziegelställe aus
der Erbbauungszeit ergänzen das Bild (Nr. 63).
Eine Ausnahme innerhalb der ländlichen
Bebauung repräsentiert der lang gestreckte
Schulbau Zum Eisenberg 2, der zusammen mit
dem nur wenige Meter entfernten Ehrenbezirk
mit Pfeilermal an der Straßenecke Eilveser
Hauptstraße/Balschenweg (Eisengitter von L.
Delchmann/Rodewald) und der 1985 abgeris-
senen Kapelle einst den historischen Ortskern
ausbildete. Der durch den Einschub zweier hell
verputzter Giebeltrakte dekorativ aufgelockerte
eingeschossige Ziegelbau entstand im Jahr
1902 und umfasste neben einer Lehrerwoh-
nung auch zwei Klassenräume.
Verlässt man Eilvese in südlicher Richtung und
folgt der Bundesstraße B 6 zum Schneerener
Eilvese, Eilveser Hauptstraße 17, Wohnwirtschaftsgebäude, „1876"
358
mation Niedersachsen)
Straße Hannover-Nienburg-Bremen, der heuti-
gen Bundesstraße B 6, im Westen. Geo-
graphisch markiert seine Lage den Übergang
von der Husum-Linsburger-Geest im Norden
zur Steinhuder-Meer-Niederung mit weiten
Moorflächen im Süden.
Das auf der Kurhannoverschen Landesaufnah-
me 1771 mit 36 Feuerstellen erfasste Dorf ent-
wickelte sich entlang der heutigen, leicht bogig
geführten Eilveser Hauptstraße, die fast parallel
zu den Höhenlinien der Moor- und Geest-
landschaften verläuft und die feuchte Niede-
rung des Eilveser Baches von den Ackerflächen
im Norden trennt. Seit Jahrhunderten bildet sie
das Rückgrat der Ortschaft, an dem sich die
Gehöfte beidseitig in lockerer Folge aneinander
reihen, so dass sich immer wieder Freiflächen
und damit Ausblicke in die freie Landschaft
ergeben.
So präsentiert sich Eilvese heute als eine von
einigen modernen Bauten durchsetzte Reihung
kleinerer Höfe, die sich mit ihren von Stallungen
umgrenzten Wirtschaftshöfen direkt zur Haupt-
straße hin öffnen. Abpflanzungen durch Eichen
und Kastanien sind in Eilvese selten; in der
Regel bleibt der Blick auf den Wirtschaftsgiebel
des zumeist leicht schräg zur Straße ausgerich-
teten Hallenhauses unverstellt (Eilveser Haupt-
str. 17, 25, 39, 43, 63).
Die zumeist in Vierständerbauweise errichteten
Wohnwirtschaftsgebäude und kleineren Alten-
teiler entstammen fast durchweg dem entwi-
ckelten 19.Jh., so dass die Fassadenabwick-
lung des Dorfes heute auffallend homogen
anmutet; allerdings wechseln Fachwerkfassa-
den mit Ziegelbauten ab. Für die Fachwerk-
bauten Eilveses ist die zeittypische Abzimme-
rung fast quadratischer Gefache und des bün-
digen Giebelfeldes als auch die Fassadenauf-
gliederung mit mittigem Vorschauer und seit-
lichen Mistgängen als charakteristisch anzufüh-
ren (Nr. 17: „1876”; Nr. 25: um 1850; Nr. 43:
Zweiständerhallenhaus und Längsdurchfahrts-
scheune: um 1840/50). Auch die backsteiner-
nen Wohnwirtschaftsgebäude folgen diesem
Eilvese, Eilveser Hauptstraße 43, Wohnwirtschaftsgebäude
Bild, wobei sie ihrer späteren Entstehung
gemäß vermehrt architektonischen Zierrat wie
Lisenenvorlagen, Blendgliederungen und
Zierbänder zitieren (Nr. 39: „1887”; Nr. 63:
„1884”). In den Wirtschaftstrakt einmündende,
zumeist winkelförmig geführte Ziegelställe aus
der Erbbauungszeit ergänzen das Bild (Nr. 63).
Eine Ausnahme innerhalb der ländlichen
Bebauung repräsentiert der lang gestreckte
Schulbau Zum Eisenberg 2, der zusammen mit
dem nur wenige Meter entfernten Ehrenbezirk
mit Pfeilermal an der Straßenecke Eilveser
Hauptstraße/Balschenweg (Eisengitter von L.
Delchmann/Rodewald) und der 1985 abgeris-
senen Kapelle einst den historischen Ortskern
ausbildete. Der durch den Einschub zweier hell
verputzter Giebeltrakte dekorativ aufgelockerte
eingeschossige Ziegelbau entstand im Jahr
1902 und umfasste neben einer Lehrerwoh-
nung auch zwei Klassenräume.
Verlässt man Eilvese in südlicher Richtung und
folgt der Bundesstraße B 6 zum Schneerener
Eilvese, Eilveser Hauptstraße 17, Wohnwirtschaftsgebäude, „1876"
358